  |
|
| Autor |
Nachricht |
Strichpunkt
 Leseratte Leseratte
S
Beiträge: 166
|
S  02.01.2016 22:59 02.01.2016 22:59
von Strichpunkt
|
 |
|
Hallo Leveret Pale
Ich habe mir nur deine neuste Version angesehen. Ich kommentiere den Text beim Lesen direkt durch, dann kannst du direkt sehen, was ich denke und wo ich dir Verbesserungsvorschläge mache.
| Zitat: | Theodor
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend Das "schmatzend" passt für mich so gar nicht zum nachfolgenden Donnern und Beben, das die Reiter erzeugen. Ich würde das "schmatzend" einfach streichen, sehe nicht, was da verloren ginge. den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten Das ist doppelt gemoppelt. Natürlich ist die Stadtmauer entfernt, wenn sie am Horizont ist- auch das "entfertn" liesse sich streichen. "zu donnerten" -> zudonnerten.. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern Es ist ein bisschen seltsam, wenn zuerst von den Pferden gesprochen wird. Man hat das Gefühl, du sprichst aus der Tierperspektive.Auch die zweite Bemerkung, "mit ebenso vielen Reitern", das nimmt der Leser doch sowieso als selbstverständlich an. Normalerweise reiten nicht noch extra Pferde mit., die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen dunkelgrünUmhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune haselnussbraun ist etwas too much. Warum nicht einfach "seine braune Mähne"? Eine Mähne ist ja schon was Wildes, da denke ich an einen Löwen. Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und seine berühmte, weiche Schönheit. Da fehlt etwas.
An seiner Seite ritten er Das "er" ist hier wohl zu viel., Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt -das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg "Festung" fände ich im Sinne des Textduktus passender., an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Dieser Satz ist vollkommen überflüssig. Könnte man ersatzlos streichen.Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen Dieses Wort wirkt hier sehr seltsam, zu modern. Und auch sehr sperrig. darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette Holzskelette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände Das ist sehr dramatisch geschildert. Aber wie kann eine Pfütze getrocknet sein? Eine Pfütze ist eigentlich immer feucht. Auch das dunkelrot könnte man streichen; das wirkt überstilisiert.. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken Kommavon wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen Klingt holprig, Vorschlag: Sie sassen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus neugierig zu beobachten. Wobei der Rhythmus hier auch nicht so schön ist..
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander aneinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten.Sie blickten sahen sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Du wechselst hier die Erzählstimme. Das ist nicht Theodor, der erzählt - jedenfalls nicht für mich. Das ist ein allwissender Erzähler, der dir da in den Text gerutscht ist. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig Da stimmt was nicht, das "mehr" müsste weg., auch wenn Niemand niemandvon ihnen solche Ausmaße ein solches Ausmasserwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum.Normalerweise sagt man: etwas ist geschehen, aber niemand wusste, was genau! Oder wissen sie, was die Ghule nun gefährlich macht? Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den dem Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken Die Metapher ist ein bisschen ausgeluscht., fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe Auch das ist redundant. An der Aussenseite werden sie kaum kleben!, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn Das klingt sehr gestelzt und passt nicht zu "einen Blick rüberwerfen".. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand hinterm Horizont. Das kam doch schon einmal vor im Text?! Am Nachhimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora zwischen den Wolkenfetzen.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufen "der Hufe" unter.
|
Einmal bis hier. Der Text ist sehr lang fürs Forum, wenn man wirklich intensiv daran arbeiten möchte. Manchmal ist mir die Erzählstimme zu inkonsequent, bzw. vermischt verschiedene Stile. Ich weiss nicht, ob wirklich aus der Sicht von Theodor erzählt wird. Manchmal ist das der Fall, ja, aber über grosse Strecken spricht hier ein anderer - so kommt es mir jedenfalls vor.
Ein anderes Ding sind die vielen Redundanzen und Adjektive, die dem Text meiner Meinung nach überhaupt nicht guttun. Gewisse Dinge sind klar, die musst du nicht extra erwähnen; anderes ist überstilisiert (wie das dunkelrote Blut in Pfützen). Ich sehe, dass du sehr engagiert an deinen Texten arbeitest und ich denke du hast Potential! Ich werde sicher wieder einmal bei dir vorbeischauen!
Liebe Grüsse
Strichpunkt
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  02.01.2016 23:20 02.01.2016 23:20
von Leveret Pale
|
 |
|
Danke für die ausführlichen Kommentare. Die Ausrutscher in den allwissenden Erzähler sind bis jetzt weder mir, noch jemand anderen wirklich aufgefallen. Mittlerweile hat das Buch 25 Kapitel - das ist lediglich das Erste und Älteste ( daher auch am meisten Bearbeitungsbedarf)- aber zum Glück ist diese Erzählperspektivenschwankung, wenn ich so durchscroll und nachdenke, vor allem ins erste Kapitel gerutscht, danach wird mein Stil konsequenter.
Ich überlege mal wie ich das umgehen beziehungsweise richten kann.
| Zitat: | | Ich sehe, dass du sehr engagiert an deinen Texten arbeitest und ich denke du hast Potential! Ich werde sicher wieder einmal bei dir vorbeischauen! |
Danke! Dein Lob ehrt mich 
|
|
| Nach oben |
|
 |
nothingisreal
 Bücherwurm Bücherwurm
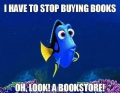
Beiträge: 3994
Wohnort: unter einer Brücke
|
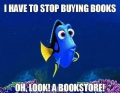  03.01.2016 00:08 03.01.2016 00:08
von nothingisreal
|
 |
|
Hallo Leveret,
ich schaffe nicht alles. Hundert Prozentig. Aber ich fange mal an, okay? Nimm, was du brauchst.
| Leveret Pale hat Folgendes geschrieben: | Hab nochmal daran gearbeitet.
Theodor
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. |
Das Bild ist schön. Das Wort schmatzend zerstört es meines Erachtens. Denn a) klingt es nicht so, wenn Pferde das tun - zu mindestens meiner Erfahrung aus Filmen nach - und b) hört sich das für mich einfach nach einer alten Dame an, die es nie gelernt hatte, den Mund beim Kauen geschlossen zu halten.
| Zitat: | | Der Boden bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. |
Wirklich am Horizont? Das erscheint mir sehr weit. Zudem kannst du das entfernt dann weglassen, den die Distanz ist klar definiert.
| Zitat: | | Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. |
Jetzt wiederholst du dich unnötig. Wie wäre es, wenn du beide Sätze verbindest, zum Beispiel:
Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der wenige Meilen entfernten Hauptstadt Hoorn zu donnerten.
Das königlich erscheint mir überflüssig. Das Setting lässt eh darauf schließen, dass sich dort der König aufhält bzw. es wenigstens einen gibt.
| Zitat: |
Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. |
Bis hierhin finde ich es sehr schön. Ab jetzt verlierst du dich in Details.
| Zitat: |
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. |
Vielleicht: An der Spitze von über acht Dutzend berittener Pferde galoppierte ein Reiter in prunkvoll verzierter Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn.
Dass sie Kettenhemden tragen, ist absolut klar. Welche Farbe ihre Umhänge haben, kannst du noch später einbauen.
| Zitat: |
Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und seine berühmte, weiche Schönheit. |
Den letzten Satz verstehe ich nicht.
| Zitat: |
An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs. |
Warum steht da "er"? Ich bin kein Genreleser, aber ist es wirklich notwendig sofort zu erwähnen, wer wer ist? Ich kann mir das zum Beispiel nicht merken.
Bis hierhin, arbeite jetzt weiter. Vielleicht konnte ich dennoch helfen. Ich mag den sehr bildlichen Schreibstil.
_________________
"Es gibt drei Regeln, wie man einen Roman schreibt. Unglücklicherweise weiß niemand, wie sie lauten." - William Somerset Maugham |
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  03.01.2016 22:25 03.01.2016 22:25
von Leveret Pale
|
 |
|
Ich hab nochmal den Text überarbeitet, wobei ich diese leichten Perspektivenwechsel mehr oder wenig dringelassen habe. Ich mag das irgendwie. Hat was von so einer Panoramaaufnahme.
Übrigens suche ich zurzeit einen Lektor für das ganze Buch, also wenn einer das hier liest und Interesse daran hat, dann kann er mir ein PN schicken.
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der wenige Meilen entfernten Hauptstadt Hoorn zu donnerten. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand über die sechshundert Fuß hohen Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
An der Spitze von über acht Dutzend berittener Pferde galoppierte ein Reiter in prunkvoll verzierter Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und hatte seine berühmte, weiche Schönheit.
An seiner Seite ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf.
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns.
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte darauf bestanden.
Resigniert stieß Theodor einem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder gar in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus neugierig zu beobachten.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was. Theodor schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Theodor feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft.
Das Meer verschluckte den Letzen Lichtstrahl der Sonne. Am Nachhimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora zwischen den Wolkenfetzen.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war die Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter.
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu erkennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken, doch andere übernahmen das für ihn.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und stieß dessen Körper mit einem Schnitt zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben.
Theodor sah aus den Augenwinkel, wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Sein Pferd scherte aus. Mit einem hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sich mehrere Ghule auf sein Pferd stürzten. Theodors Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an.
Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich im Umhang und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach. Woher kamen sie?
Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Formation noch den Ansturm standhielt.
Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim spritzte auf Theodors Rüstung und Krallen schabten über Stahl. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. So zog er seine blutigen Bahnen durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste dutzende von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule stürmten an ihm vorbei zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte.
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen die Todesschreie abrupt ab. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an seinem Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt. Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schultern und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig.
Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte in seinen Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob sich etwas Mächtiges und absolut Tödliches ihnen nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren. Theodor stärkte den Griff um das Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass und gräulich. Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren.
Am meisten verstörten Theodor die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien ihn zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:.
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?« Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Spitze des Schwertes. Dampf zischte unter seinen knochigen Finger, an denen, anstelle von Fingernägeln schwarze Klauen waren, hervor. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbeln durch den Nebel davon.
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte der Fremde ihn am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzen Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor und während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten es.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor und einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihn, wie zwei Fohlen hinter ihre Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer waghalsiger Mut, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diesen klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig. Aber dennoch ein Narr. Für eure Unhöflichkeit müsste ich euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch Häuten und Pfählen bevorzugen würde. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald«
Den Namen kannte Theodor, wie wahrscheinlich jeder im südlichen Königreich. Er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghuleepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahre auslöschte, entsandte ihn der König dorthin um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und abzubrennen.
Er kehrte niemals zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. All diese Gedanken schossen durch Theodors Kopf, doch aus seinem trockenen Mund kam nur ein undeutlicher Laut, der bei Ignacio höhnisches Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe, hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie die entsprechende Huldigung.«
»Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade als Vaenyr bezeichnet? Als einen der ausgestorbenen Totengötter? Doch der Mann ging gar nicht weiter darauf ein, sondern setzte unbekümmert fort »Nun wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, den mein König duldet keine Überlebenden.«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Toten von einem König gesprochen? Hoorn war seit jeher neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Theodors Herz schien für einen Moment auszusetzen und bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an du Scheusal«
Die beiden Männer hinter ihm stürmten zum Angriff hervor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrt, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte: »Für Hoorn, du Bestie.«
Die Hand des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss. Mit einer schnellen für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung durchtrennte sie den Schaft der Axt, sodass das Blatt wirbelnd an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte er das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte.
Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit dem Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte ihn und eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Immer wieder schlug er auf dem Boden auf, wie ein flacher Stein, der über einen See springt, und die Explosion schleuderte Theodor immer weiter, bis er gegen irgendetwas Festes prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass er dachte, er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerung wieder zusammensetzte und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesogen im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine Birke gelehnt. Sein ganzer Körper schmerzte und war mit einer Kruste aus verbranntem und geronnenem Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeult und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte. Aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge floss Blut über sein Gesicht. Theodor hatte einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgreiz ankämpfte.
Es war still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die Blätter der Birken und dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing in der Luft und er glaubte von abertausenden, schwarzen Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang Theodor sich dazu aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und das Metall klirrte. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er allein nicht rankam.
Jedes Geräusch welches er verursachte, erschien ihm unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte.
Doch es geschah nichts und so fasste er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung, in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung und er wagte es nicht seinen Blick nach links oder nach rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs. Bei diesen Gedanken allein bekam er bereits feuchte Hände.
Während er den Weg starr fixierte, kam ihn irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er, was es war.
Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jegliche Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und Theodor bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war, noch als Untoter wiederauferstehen konnte.
Sogar einen Krater, den die Explosion, die ihn weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen, konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten.
Seine Gedanken schweiften hin und her während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben.
Aber Vaenyr und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyr, die nekromantischen Menschengötter, waren wie die anderen Götter in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Seine Gedanken kreisten wild und irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte wahr sein konnte oder ob er den Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch ein dunkler Weg zur Festung Hoorn, die über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihn griffen und er erwachte aus seinem tranceartigen Zustand.
Den Rest des Weges rannte er vor Angst um sein Leben. Alles schien nach ihn greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie und seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Mooren, über die Große Brücke, die über den Vyl führte, dem großen Fluss der die Stadt nicht nur mit Wasser versorgte sondern sich auf vor ihr gabelte und so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser bildete.
Als er das große Stadttor erreichte, hämmerte er wild dagegen. Das Tor war riesig, ein ganzer Belagerungsturm hätte hineingepasst und es war halb so dick wie ein Mann hoch und ließ sich nur mittels eines komplizierten Flaschenzugmechanismus innerhalb der Mauer durch mehrere Männer öffnen und schließen. Die ganze Festung Hoorn war die größte der bekannten Welt und noch nie wurde sie eingenommen.
Aus den Schießscharten über ihm riefen Soldaten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Theodor schrie bis seine Lungen fast versagten, dass er ein hoher Ritter sei, der Sohn des Grafen von Absborgen, und er würde wichtige Kunde für den König bringen. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Dahinter erwartete ihn ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet. Nur durch viele vage Erklärungen und dem Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust konnte er die Männer letztendlich davon überzeugen ihn nicht ins Verlies zu werfen.
Ein Mann der über und über mit geronnen Blut überzogen war und der wirr und zitternd redete, war schwer zu vertrauen.
Theodor verlangte, dass man ihm sofort zum König brachte, wenn auch er nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstvorschriften der Mauer vorsahen.
Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die, selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten, Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zum Schöpfer, welcher die Welt erschaffen hatte, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen.
Hoorn war das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber kein Auge. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er den König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihn Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen und man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Das hielt ihn nicht davon ab weiterzugrübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um ihn zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, der die ganze Zeit lächelte, wusch Theodors Verletzung am Kopf aus und nähte sie mit einer heißen Nadel zu, doch Theodor war sogar zu erschöpft um vor Schmerzen zu schreien und ließ alles über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihm noch einen Aufguss aus beruhigenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und während die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen einige Momente einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken und die schrecklichen Erinnerungen im Rausch zu vergessen war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte.
Angewidert schüttete er den Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er, wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Doch fand Sir Theodor Absborgen kaum Schlaf. Wann immer er die Augen schloss, sah er wieder die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer. Sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen. Er erinnerte sich über den rätselhaften Blutrausch der ihn gepackt hatte, aber so musste es sich voll anfühlen wenn man in einem Kampf versinkt. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulichster als alles, was er zuvor erlebt hatte.
Wie viele Untote hatte er erschlagen? Er wusste es nicht, aber dabei waren sie alle einst Menschen gewesen. Das Gesicht des Jungen, in dem sein Schwert stecken geblieben war, erschien ihm vor seinen inneren Augen. Theodor fühlte sich dreckig.
All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch mit dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyre und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen drang. Zu seiner Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets schimpfte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihn seine Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Diener Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen um seine Familie zu warnen und brach nach einigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwachte schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwecken kam Niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Theodors ganzer Körper verkrampfte sich und er rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung ihn übermannte und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Lapidar
 Exposéadler Exposéadler

Alter: 61
Beiträge: 2699
Wohnort: in der Diaspora
|
  04.01.2016 08:42 04.01.2016 08:42
von Lapidar
|
 |
|
| Leveret Pale hat Folgendes geschrieben: | Ich hab nochmal den Text überarbeitet, wobei ich diese leichten Perspektivenwechsel mehr oder wenig dringelassen habe. Ich mag das irgendwie. Hat was von so einer Panoramaaufnahme.
Übrigens suche ich zurzeit einen Lektor für das ganze Buch, also wenn einer das hier liest und Interesse daran hat, dann kann er mir ein PN schicken.
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der wenige Meilen entfernten Hauptstadt Hoorn zu donnerten. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand über die sechshundert Fuß hohen Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
An der Spitze von über acht Dutzend berittener Pferde galoppierte ein Reiter in prunkvoll verzierter Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. logisch, dass wenn er lange Haare hat, die sich im Reit/Fahrtwind nach hinten legen.. aber hier kommt ein bild auf, als würde sein Haar Eigenleben entwickeln.. mir ist schon klar, dass du den Kontrast beschreiben möchtest, zwischen dem glattrasiertem gesicht und dem langen Haar aber naja..rüber kommt bei Mir: Modenschau bei Ritters..  Sein Gesicht war glatt rasiert und hatte seine berühmte, weiche Schönheit.[/u]ich weiß nicht, der Satz ist etwas nichtssagend.. vor allem warum so ins Detail gehen, wenn der Typ nacher eh tot ist.? Sein Gesicht war glatt rasiert und hatte seine berühmte, weiche Schönheit.[/u]ich weiß nicht, der Satz ist etwas nichtssagend.. vor allem warum so ins Detail gehen, wenn der Typ nacher eh tot ist.?
An seiner Seite ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf.
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns.
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte darauf bestanden.
Resigniert stieß Theodor einem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder gar in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus neugierig zu beobachten. mir wird immer wieder gesagt, ich neige dazu zuviele Hilfsverben auf einmal zu benutzen, meistens fällt mir das nicht auf, und wenn, dann weiß ich nicht, wie ich es ändern könnte, hier sehe ich das gleiche Problem...
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was. Theodor schüttelte den Kopf. ich habe es mal durchgestrichen, ließ es mal ohne den durchgestrichenen Teil. Meiner Meinung nach brauchst du den Teil nicht
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Theodor feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes Ist die Farbe wichtig?umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling siehste, ich denke, da bräuchtest den Satz oben mit dem glattrasierten und der Schönheit gar nicht.. und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft.
Das Meer verschluckte den Letzen Lichtstrahl der Sonne. Am Nachhimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora zwischen den Wolkenfetzen.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war die Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter.
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu erkennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken, doch andere übernahmen das für ihn. etwas unglücklich formuliert, mir ist klar, was du sagen willst, aber das Bild das ich sehe,ist jemand mit Megglezange, der dem armen Theo im Schlund rumstochert, um den Schrei rauszuholen..Sorry. hab manchmal eine ausschweifende Phantasie. Hier denke ich, wäre es beser, ausführlicher zus ein oder den zweiten Teil des Satzes wegzulassen.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Auch hier ist die Formulierung nicht wirklich gelungen.. heult der Stahl?
Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. ich glaube ich hatte das mit der Sicht unter Visieren schon mal angemerkt.. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Bleib im Klischee und mach sie rot.. bzw.. wie kan Theo das alles sehen, durch die engen visierschlitze?Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf sagt man so? ihn zugesprungen kam, und stieß dessen Körper mit einem Schnitt zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten.
Naja, das kann ja nichts werden, wenn ein Teil nur rumsteht und jammert..
Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. und der Rest, darf der leben bleiben?
Theodor sah aus den Augenwinkel, mit heruntergeklappten Visier.? wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt. armes Pferd..
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Sein Pferd scherte aus. Mit einem hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sich mehrere Ghule auf sein Pferd stürzten. Theodors Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Wenn ein Ritter in schwerer Rüstung vom Pferd fällt, dreht er sich nicht mehr allzu viel, sollte er aber so doof sein, sich auf den Rücken zu drehen, dann hast du die menschliche Entsprechung einer Schildkröte auf dem Rückenpanzer liegend. Da rappelt sich keiner mehr auf..
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor. naja, wenn das dings schmerz empfinden konnte, dann war das Hirn noch iwie funktionsfähig..
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel aufpassen hier könnte es auch Theos Schädel sein, aber der dürfte eigentlich inzwischen an Überanstrengung gestorben sein.. mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an.
Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich im Umhang/Stoff und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach. Woher kamen sie?
Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Formation noch den Ansturm standhielt.
Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim spritzte auf Theodors Rüstung und Krallen schabten über Stahl. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. So zog er seine blutigen Bahnen durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste dutzende von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges/Umgangssprache, passt nicht in die epik mehr. Nur einige Ghule stürmten an ihm vorbei zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte.
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen die Todesschreie abrupt ab. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an seinem Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt. Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schultern und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig.
Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte in seinen Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch das Similie ist etwas unglücklich gewählt..war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob sich etwas Mächtiges und absolut Tödliches ihnen nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren. Theodor stärkte den Griff um das Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Und sonst ist er nackig?Seine Haut war blass und gräulich. Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren.
Am meisten verstörten Theodor die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien ihn zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:.
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?« Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Spitze des Schwertes. Dampf zischte unter seinen knochigen Finger, an denen, anstelle von Fingernägeln schwarze Klauen waren, hervor. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbeln durch den Nebel davon.
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte der Fremde ihn am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzen Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor und während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten es.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor und einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihn, wie zwei Fohlen hinter ihre Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer waghalsiger Mut, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diesen klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig. Aber dennoch ein Narr. Für eure Unhöflichkeit müsste ich euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch Häuten und Pfählen bevorzugen würde. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald«
Den Namen kannte Theodor, wie wahrscheinlich jeder im südlichen Königreich. Er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghuleepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahre auslöschte, entsandte ihn der König dorthin um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und abzubrennen.
|
sorry, bin nur bis hierher gekommen.
entschuldige meine Schreib und Tippfehler, ich hab zur Zeit grad Probleme mit dem Arm.
Nun: ich sehe die Epik aber ganz ehrlich: sehr viel weiter würde ich nicht lesen. Liegt aber vielleicht einfach an mir. Ich mag so detailliert beschriebene Schlachtszenen nicht. Mein Magen dreht sich und mein innerer Komentator fängt an zu krittel (wie du oben gesehen hast)
Ich hoffe, es ist ein bisschen was hilfreiches dabei. Ich kommentiere in der Regel einfach meinen Eindruck beim Lesen.
_________________
"Dem Bruder des Schwagers seine Schwester und von der der Onkel dessen Nichte Bogenschützin Lapidar" Kiara
If you can't say something nice... don't say anything at all. Anonym. |
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  04.01.2016 10:59 04.01.2016 10:59
von Leveret Pale
|
 |
|
| Zitat: | sorry, bin nur bis hierher gekommen.
entschuldige meine Schreib und Tippfehler, ich hab zur Zeit grad Probleme mit dem Arm.
|
Kein Problem. Ich bin dankbar für jeden Kommentar und ein paar Tippfehler machen ihn ja nicht wertlos. Das mit dem Arm ist hoffentlich nichts ernstes.
| Zitat: |
Nun: ich sehe die Epik aber ganz ehrlich: sehr viel weiter würde ich nicht lesen. Liegt aber vielleicht einfach an mir. Ich mag so detailliert beschriebene Schlachtszenen nicht. Mein Magen dreht sich und mein innerer Komentator fängt an zu krittel (wie du oben gesehen hast)
Ich hoffe, es ist ein bisschen was hilfreiches dabei. Ich kommentiere in der Regel einfach meinen Eindruck beim Lesen |
Jeder Eindruck eines Leser hilft mir meinen Text zu verbessern und auch hier habe ich ein paar nützliche Hinweise gefunden. Danke dafür!
Da mir bewusst ist, dass meine Geschichte nicht ganz für jeden etwas ist, fängt sie bereits recht blutig an ( wenn auch nach dem ersten Kapitel hundert Seiten lang keinen einziger Tropfen Blut fließt), aber ansonsten hätte ich eine Menge schockierter und enttäuschter Leser, weil plötzlich nach vor sich hin plätschernder Politik und Intriegenschmiederei, Städte geplünderten und Menschen verbrannt werden.
Ich frag mich gerade warum hier immer wieder die Epik in meiner Geschichte gesehen wird. Also ja, es ist ein Roman, aber kein klassischer Heldenepos. Theodor ist eher ein Antiheld, mit vielen Schwächen und Unsicherheiten, der sogar Gesetze bricht und hin und her gerissen ist zwischen dem was er für Richtig / Notwendig hält und die Gesellschaft / Gesetze von ihm verlangen. Der ganze Roman ist eigentliche ein Zwitterwesen aus Dystopie, Horror und Highfantasy und es gibt keinen wirklich "guten" Charakter, was vor allem daran liegt, dass die Welt moralisch ziemlich verfallen ist.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Lapidar
 Exposéadler Exposéadler

Alter: 61
Beiträge: 2699
Wohnort: in der Diaspora
|
  05.01.2016 10:08 05.01.2016 10:08
von Lapidar
|
 |
|
Epik deswegen, weil diese ausschweifende Beschreibung von Rittern, Reiten und Schlachten mich inhaltlich und teilweise auch schreibtechnisch an folgende Texte erinnern:
Roland Lied (die Schlachtenszene am Schluss wo alle sterben)
Siegfried (ein bisschen, wo Kriemhild ihre Rache nimmt)
Schlachtenszenen aus Herr der Ringe (da darfst dir aussuchen, gibts viele  ) )
Ritterfilme (die moderneren hab ich nicht so angeguckt aber) da werden die Kopfab und Blutspritz Bilder auch schön ausgewalzt.
Wenn deine Aussage stimmt, dass nachher mehrere Hundert Seiten kein Tropfen Blut mehr fließt und dass du da ne Art Antiheld hast, dann fängt dein Buch aber falsch an, denn ich als Leser, wenn ich so auf diese Schlachtenszenen stehen würde und du mich angeködert hättest mit so viel "Blood, sweat and tears" dann wäre ich sehr sehr enttäuscht und wohl auch sauer und würde meinen Morgenstern rauskramen, um dem Autor meine persönliche Meinung zu demonstrieren.
Ich weiß langweilig und Standard - für den Schreiber - , aber warum nicht einfach im langweiligen anfangen und dannn vllt durch Gespräche und so langsam an diese Schlachtenszene heranführen, bzw. Stückchenweise rauslassen?
Da fällt mir dieser Behüter ein aus dem Rad der Zeit, der eigentlich König wäre, wenn sein Königreich nicht schon vor seiner Geburt gefallen wäre. Das wird glaub erst im dritten Band oder so klarer. Und das Buch kommt zwar auch mit einigem an Schlachten aus aber niedriger dosiert.

_________________
"Dem Bruder des Schwagers seine Schwester und von der der Onkel dessen Nichte Bogenschützin Lapidar" Kiara
If you can't say something nice... don't say anything at all. Anonym. |
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  11.01.2016 21:10 11.01.2016 21:10
von Leveret Pale
|
 |
|
Danke für all eure Rückmeldung! Ich habe fleißig weitergearbeitet und den Text nochmal etwas poliert und sogar noch einen Prolog hinzugefügt.
Also das mit den "die nächsten paar hundert Seiten" kein Tropfen Blut stimmt so nicht. Es sind ca. 150 Seiten bis zum nächsten Massaker / Schlacht und bis dahin gibt es "nur" einen Faustkampf und einen Gefängnisausbruch, neben den Intrigen spinnen und der Politik.
PROLOG
Der König aller Könige durchschritt die verwaisten Hallen seines Palastes. Keine Diener, keine Statuen begegneten ihn auf seinen ewigen Wanderungen.
Durch die Risse, Brüche und Fenster in den düsteren Gemäuern und Böden fiel von allen Seiten das tote Licht der schwarzen Sterne und der sterbenden Sonnen ein. Die Schritte des Königs verursachten kein Geräusch in der kosmischen Leere des Palastes, kein Wind zerrte an den zerfetzten Lumpen unter denen er seinen amorphen Körper verbarg. Er glitt über den glattpolierten, bröckelnden Gagat in einen hohen Saal, an dessen Ende auf einem Podest ein Becken stand, neben dem sich in Regalen aus schwarzen Gestein abertausende Glasfläschchen sammelten. In den Gläsern schwappten, brodelten und schwebten Flüssigkeiten in allerhand tristen und düsteren Farben. Über dem Becken hing ein angelaufener Spiegel und der König sah in sein eigenes entstelltes Antlitz, welches er sogar vor sich selbst unter einer Kapuze verbarg. Sein Blick fiel auf die glänzenden Tränen, die schwer an einem geschmiedeten Ring um seinen Hals hingen.
Sechs waren es.
Sechs Tränen, die die erste Schöpfung vergossen hatte.
Sechs Tränen mit denen der König die erste Schöpfung vernichtet hatte.
Sechs Tränen mit denen er die neue Schöpfung erschaffen hatte.
Ein gurgelnder Laut, der ein melancholischer Seufzer sein sollte, drang aus der mollusken Kehle.
Der König streckte seine zitternde, amorphe Hand nach einem der Gläser aus und zog es zu sich. Andächtig, beinahe ehrfürchtig, schraubte er langsam den Deckel auf. Myriaden an gemischten Düften schlugen ihm entgegen, die Gerüche einer toten, verwesenden Welt und doch schnüffelte er begierig an ihren Leichendüften, die von anderen Zeiten erzählten, von der ersten Menschheit und den letzten Helden. Es waren die liquiden Erinnerungen an die erste Schöpfung, jenem Universum, welches den König hervorgebracht hatte und das der König vernichtete, als er das Neue gebar. Dreizehnmilliarden Achthundertneunzehnmillionen Dreihundertsiebenundvierzigtausend und Vierhundertzweiunddreißig Jahre waren seit damals vergangen und noch immer triefte die Wunde, die dieser Verlust in den König gerissen hatte, und erfüllte ihn mit düsterster Trauer.
Vorsichtig goss er die Erinnerungen in das Becken vor ihm, drauf achtend, dass kein einziger Tropfen verloren ging. Das Becken füllte sich bis zum Rand mit der dunklen Flüssigkeit, die Mal in Karminrot mal in Gold zu schillern schien. Die Hand des Königs glitt über der ebenen Oberfläche der Flüssigkeit, die darauf in Aufruhr geriet, zu brodeln begann und Bilder hervorbrachte, die aufstiegen und den König zurück in die erste Schöpfung versetzten. Der König sah Helden kämpfen und sterben, Reiche sich erheben und fallen, Männer nach Mächten lechzen, die ihre Fähigkeiten bei weitem überstiegen. Er hört das Lied der Hyaden, das Rauschen des Eliriumstroms, aus Myriaden Kehlen die letzten Gebete der ersten, gescheiterten Menschheit, das Brechen von Stein, das Tröpfeln von Regen und dann das Klackern von Hufen.
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der Hauptstadt Hoorn am Horizont zu donnerten. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand über die sechshundert Fuß hohen Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
An der Spitze von über acht Dutzend Reitern galoppierte auf einem weißen Hengst der Prinz in prunkvoll verzierter Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seinem, für die Schönheit berühmten, Gesicht.
An seiner Seite ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbons beigefarben und mit einem schwarzen Bunyip versehen war.
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns über ihren rasselnden Kettenhemden..
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich die Straße schlängelte. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann wäre der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte wegen der Gefahr darauf bestanden.
Resigniert stieß Theodor einem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier bäumte sich auf vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder gar in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend bei den Gedanken daran durchfuhr Theodor ein eiskaltes Kribbeln. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus zu beobachten.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten, allesamt gestanden Soldaten.
Theodor zwang jedoch seinen Blick genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren die untoten Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was genau und wie, und vor allem so schnell. Theodor schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge, im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Theodors feuchte Hände klebten an der Innenseite seiner Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft, dabei war der Prinz gerademal zwei Mondtänze älter als Theodor.
Das Meer verschluckte den Letzen Lichtstrahl der Sonne. Zwischen den Wolkenfetzen am Nachthimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Bald würden sie ihren dreißigtägigen Tanz fortsetzen.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war die Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter.
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu erkennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut. Aber es war auch nicht mehr als verschwommen Schemen.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Halten, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagierte zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit der Gestalt auf dem Weg zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken und sein Herz macht einen Sprung.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl, als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und stieß dessen Körper mit der Klinge zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu irgendwelchen Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben.
Theodor sah aus den Augenwinkel, wie Sir Bylbon versuchte sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und der gurgelnde Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Dunkles Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat um sich, zertrampelte mehren Untoten ihre Schädel. Verzweifelt versuchte Theodor Absborgen sich an seinem wilden Pferd festzuklammern, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Sein Pferd scherte aus. Mit einem hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenem. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie mehrere Ghule über sein Pferd herfielen. Theodors Schädel dröhnte. Sein Schwert! Wo verdammt war sein Schwert? Er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss Theodor seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Fäden aus schwarzen Schleim und Blut spritzten über die Rüstung. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte wütend und fuhr mit den Krallen über sein Brustharnisch, biss mit seinen verbliebenen Zähnen auf den Panzer des Armes rum, der vor schwarzen Körpersäften glänzte. Theodor warf das Ungeheuer von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, während sein Herz marschierte und seine Verdauungstrakte rebellierten.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der Schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn erneut Ghule an.
Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Stoff, als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich in dem Gewand und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er erledigte einen nach dem anderen, während er sich eine Schneise durch das Schlachtfeld schlug.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach. Woher kamen sie? Theodors Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Eingeweiden und der Gestank des Moores umhüllten ihn, benebelte seinen Verstand, genauso wie die Schreie der sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Formation noch dem Ansturm standhielt. Sie konnten nur noch hoffen Ehrenvoll ihre Haut möglichst teuer zu verkaufen.
Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim quoll aus seinem Rachen und bespritzte Theodors Rüstung. Krallen schabten über Stahl. Theodor trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in die Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. So zog Theodor seine blutigen Bahnen, dem Sensenmann gleich, durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder und Theodor verlangsamt sich auf den Takt der Realität. Der anormale Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste mehrere Dutzend der Untoten erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand mehr, der noch zu einem Atemzug in der Lag war. Ghule stürmten in einiger Entfernung vorbei zur Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte.
Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße versammelt zu ihrem letzten Gefecht. Sie kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Theodor machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer, die Arme viel schwer, der Blick verschwommen und pulsierend vom Schweiß und Erschöpfung. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich endgültig verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Kälte, die ihn durchfuhr als hätte ihn jemand mit Eiszapfen gespickt.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen standzuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte.
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als er sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigten Köpfen, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in den Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen seineTodesschreie abrupt ab, als hätte die weiße Wand sie verschluckt. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren außer Theodor übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an einem seiner Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt.
Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schultern und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig.
Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte, wie das Klopfen eines lebendig Vergrabenen in dessen Sarg, in seinen Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige schwere Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob sich etwas Mächtiges und absolut Tödliches ihnen nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren und sie ersticken zu wollen. Theodor verstärkte den Griff um sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Sir Theodor Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Unbekannten richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass gräulich. Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren.
Am meisten verstörten Theodor die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte wie Nägel, die man ihm in den Schädel hämmerte. Er spürte, wie sich eine Gänsehaut sich seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz mit ihr eiskalten Hand und drohte es in ihren Klauen zu zerquetschen, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchstens in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt zu sein, im Gegenteil, er schien die Waffe zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich Euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?«
Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Klinge. Dampf zischte unter den knochigen Finger hervor, an denen, anstelle von Fingernägeln, schwarze Klauen waren. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm und nicht mehrfach gefalteter, fendorranischer Stahl. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbelnd durch den Nebel davon.
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem Ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück, bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte der Fremde ihn am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzten Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor. Während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch los wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten schlagartig und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten sie.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor Einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihm, wie zwei Fohlen hinter ihrer Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer wahnsinniger Mut im Angesicht des Todes, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diese klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig oder töricht, aber unter allen Umständen ein Narr. Für eure Unhöflichkeit müsste ich Euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch Häuten und Pfählen bevorzugen würde. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald«
Den Namen kannte Theodor und er ließ ihn schaudern, wie wahrscheinlich jeden im südlichen Königreich. Er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghulepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahren auslöschte, entsandte ihn der König dorthin, um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn, besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und zu verbrennen und gleichzeitig zu lachen.
Er kehrte niemals zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. All diese Gedanken schossen durch Theodors Kopf, doch aus seiner Kehle kam nur ein undeutlicher, röchelnder Laut, der bei Ignacio höhnisches Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe, hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie die entsprechende Huldigung.«
Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade als Vaenyr bezeichnet? Als einen der ausgestorbenen Totengötter? Doch der Mann ging gar nicht weiter darauf ein, sondern setzte unbekümmert fort »Nun wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, denn mein König duldet keine Überlebenden, auch wenn Ihr sehr unterhaltsam seid«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Finsternis von einem König gesprochen? Hoorn war seit jeher neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Theodors Herz schien für einen Moment auszusetzen und bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an du Scheusal«
Die beiden Männer hinter ihm stürmten zum Angriff hervor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrte, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte: »Für Hoorn, du Bestie.«
Die Hand des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss. Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung durchtrennte sie den Schaft der Axt, sodass das Blatt wirbelnd an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte er das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte.
Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit dem Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte Theodor und eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Immer wieder schlug er auf dem Boden auf, wie ein flacher Stein, der über einen See springt, und die Explosion schleuderte Theodor immer weiter, bis er gegen irgendetwas Festes prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass Theodor dachte, er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerungen wieder zusammensetzten und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesogen im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine Birke gelehnt. Sein ganzer Körper schmerzte und war mit einer Kruste aus verbranntem und geronnenem Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeult und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte. Aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge floss Blut über sein Gesicht. Theodor hatte einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgereiz ankämpfte.
Es war still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die Blätter der Birken und dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing in der Luft und er glaubte von abertausenden, schwarzen Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang Theodor sich dazu aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und der Stahl knarrte. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er alleine nicht rankam.
Jedes Geräusch, welches er verursachte, erschien ihm unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte.
Doch es geschah nichts und so fasste er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung, in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung und er wagte es nicht seinen Blick nach links oder nach rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs. Bei diesen Gedanken allein bekam er bereits feuchte Hände.
Während er den Weg starr fixierte, kam ihm irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er entsetzt, was es war.
Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jegliche Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und Theodor bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war, noch als Untoter wiederauferstehen konnte.
Sogar einen Krater, den die Explosion, die ihn weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen, konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten.
Seine Gedanken schweiften hin und her, während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Aber solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben.
Anderseits, Vaenyr und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyr, die nekromantischen Menschengötter, waren wie die meisten anderen Götter in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Theodors Gedanken kreisten wild und irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte, wahr sein konnte oder ob er dem Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch eine dunkle, gepflasterte Straße zur Festung Hoorn, die über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die zyklopische Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab, wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihm griffen und er erwachte aus seinem tranceartigen Zustand.
Den Rest des Weges rannte er vor Angst um sein Leben. Alles schien nach ihn zu greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie und seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Mooren, über die Große Brücke, die über den Vyl führte, dem großen Fluss der die Stadt nicht nur mit Wasser versorgte sondern sich auf vor ihr gabelte und so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser bildete.
Als er das große Stadttor erreichte, hämmerte er wild dagegen. Das Tor war riesig, ein ganzer Belagerungsturm hätte hineingepasst und es war halb so dick, wie ein Mann hoch und ließ sich nur mittels komplizierter Flaschenzugmechanismen innerhalb der über zweihundert Schritt hohen Mauer durch mehrere Ochsen öffnen und schließen. Die ganze Festung Hoorn war die größte der bekannten Welt und noch nie wurde sie eingenommen.
Aus den Schießscharten über ihm riefen Soldaten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Theodor schrie bis seine Lungen fast versagten, dass er ein hoher Ritter sei, der Sohn des Grafen von Absborgen, und er würde wichtige Kunde für den König bringen. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Dahinter erwartete ihn ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet. Nur durch viele vage Erklärungen und dem Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust, konnte er die Männer letztendlich davon überzeugen ihn nicht ins Verlies zu werfen.
Ein Mann, der über und über mit geronnem Blut überzogen war und der wirr und zitternd redete, war schwer zu vertrauen, wie er sich selbst eingestehen musste.
Theodor verlangte, dass man ihm sofort zum König brachte, wenn er auch nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstvorschriften der Mauer vorsahen.
Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern, wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die, selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten, Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zum Schöpfer, welcher die Welt erschaffen hatte, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen.
Hoorn war das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber keine Augen. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er dem König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihm Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen und man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Das hielt Theodor nicht davon ab weiterzugrübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um ihn zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, der die ganze Zeit lächelte, wusch Theodors Verletzung am Kopf aus und nähte sie mit einer heißen Nadel zu, doch Theodor war sogar zu erschöpft, um vor Schmerzen zu schreien und ließ alles über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihm noch einen Aufguss aus beruhigenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und während die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen eine Zeit lang einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken, um die quälenden Erinnerungen im Rausch zu vergessen war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte.
Angewidert schüttete er den Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er, wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Doch fand Theodor kaum Schlaf. Wann immer er die Augen schloss, sah er wieder die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer. Sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen. Er erinnerte sich an den rätselhaften Blutrausch der ihn gepackt hatte, aber so musste es sich wohl anfühlen, wenn man in einem Kampf versank. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulicher als alles, was er zuvor erlebt hatte.
Wie viele Untote hatte er erschlagen? Er wusste es nicht, aber dabei waren sie alle einst Menschen gewesen. Das Gesicht des Jungen, in dem sein Schwert stecken geblieben war, erschien ihm vor seinen inneren Augen. Theodor fühlte sich dreckig.
All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch mit dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyr und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen aber auch ein schwermütiger Seufzer drang. Zu seiner Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets geschimpft hatte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihm in die Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Dienern Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen, um seine Familie zu warnen. Er brach nach wenigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwachte schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwachen kam niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Theodors ganzer Körper verkrampfte sich und er rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung ihn übermannte und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
EDIT: Irgendwie hat es die ganzen Bindestriche, wenn Wörter getrennt wurden, mitkopiert. Entschuldigung dafür. Ich editiere die mal schnell weg, oder versuche es zumindest...
EDIT 2 : Geschaft. Hab einfach die Silbentrennung in Word deaktiviert und nochmach rüperkopiert.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Drakenheim
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 44
Beiträge: 389
NaNoWriMo: 50166
Wohnort: Burg Drakenheim Gelehrtenturm
|
  12.01.2016 12:25 12.01.2016 12:25
von Drakenheim
|
 |
|
| Leveret Pale (Verfasst am: 11/01/2016 20:10) hat Folgendes geschrieben: |
PROLOG
Der König aller Könige durchschritt die verwaisten Hallen seines Palastes. Keine Diener, keine Statuen begegneten ihn ihm auf seinen ewigen Wanderungen. (Statuen begegnen mir auch nie. Ich kann sie seen, wenn sie am Rand oder im Weg stehen, aber sie begegnen mir nie.)
Durch die Risse, Brüche und Fenster in den düsteren Gemäuern und Böden Mauern/Wänden/Decken fiel von allen Seiten das tote Licht der schwarzen Sterne und der sterbenden Sonnen ein. (Von den roten Wörtern würde ich eines oder zwei streichen. Und lLicht dringt selten durch Büöden, es sei denn der Prota versteckt sich auf dem Dachboden) Die Schritte des Königs verursachten kein Geräusch in der kosmischen Leere des Palastes, kein Wind zerrte an den zerfetzten Lumpen unter denen er seinen amorphen Körper verbarg. (Mein Bild im Kopf zu amorphen Körpern: Amöben unterm Mikroskop) Er glitt über den glattpolierten, bröckelnden Gagat in einen hohen Saal, an dessen Ende auf einem Podest ein Becken stand, neben dem sich in Regalen aus schwarzen Gestein abertausende Glasfläschchen sammelten. In den Gläsern schwappten, brodelten und schwebten düstere/dunkle/finstere Flüssigkeiten in allerhand tristen und düsteren Farben. Über dem Becken hing ein angelaufener Spiegel und der König sah in sein eigenes entstelltes Antlitz, welches er sogar vor sich selbst unter einer Kapuze verbarg. Sein Blick fiel auf die glänzenden Tränen, die schwer an einem geschmiedeten Ring um seinen Hals hingen.
Sechs waren es.
Sechs Tränen, die die erste Schöpfung vergossen hatte.
Sechs Tränen mit denen der König die erste Schöpfung vernichtet hatte.
Sechs Tränen mit denen er die neue Schöpfung erschaffen hatte.
Ein gurgelnder Laut, der ein melancholischer Seufzer sein sollte, drang aus der mollusken Kehle. (Mollusken sind für mich Tintenfische, Schnecken und Muscheln. Gibt es dieses Wort wirklich als Adjektiv?)
Der König streckte seine zitternde, amorphe Hand nach einem der Gläser aus und zog es zu sich. Andächtig, beinahe ehrfürchtig, schraubte er langsam den Deckel auf. (Hier würde ich kräftig kürzen und das Tempo steigern. Die Gerüche selbst können gern wieder langsam ausgearbeitet werden) Myriaden an gemischten Düften schlugen ihm entgegen, die Gerüche einer toten, verwesenden Welt und doch schnüffelte er begierig an ihren Leichendüften, die von anderen Zeiten erzählten, von der ersten Menschheit und den letzten Helden. Es waren die liquiden Erinnerungen an die erste Schöpfung, jenem Universum, welches den König hervorgebracht hatte und das der König vernichtete, als er das Neue gebar. (Igitt, ein gebärendes Männchen. *nase-rümpf*) Dreizehnmilliarden Achthundertneunzehnmillionen Dreihundertsiebenundvierzigtausend und Vierhundertzweiunddreißig Jahre waren seit damals vergangen und noch immer triefte die Wunde, die dieser Verlust in den König gerissen hatte, und erfüllte ihn mit düsterster Trauer. (Rot: Das Wort passt nicht in diesen Zusammenhang. Aber es ist besser als da üblicher "schmerzte die Wunde". Orange: Würde ich am liebsten streichen, aber dann könnte der Leser glauben, dass die "Geburt" eine Wunde gerissen hat, nicht der Verlust. Ich komme auf die Schnelle auf keine elegantere Formulierung.)
Vorsichtig goss er die Erinnerungen in das Becken vor ihm, drauf achtend, dass kein einziger Tropfen verloren ging. Das Becken füllte sich bis zum Rand mit der dunklen Flüssigkeit, die Mal mal in Karminrot karminrot. mal in Gold zu schillern schien. Die Hand des Königs Seine Hand glitt über der ebenen Oberfläche der die ebene Flüssigkeit, die darauf in Aufruhr geriet, zu brodeln begann und Bilder hervorbrachte, versetzte sie in Aufruhr und brachte Bilder hervor, die aufstiegen und den König zurück in die erste Schöpfung versetzten. Der König sah Helden kämpfen und sterben, Reiche sich erheben und fallen, Männer nach Mächten lechzen, die ihre Fähigkeiten bei weitem überstiegen. Er hört das Lied der Hyaden, das Rauschen des Eliriumstroms, aus Myriaden Kehlen die letzten Gebete der ersten, gescheiterten Menschheit, das Brechen von Stein, das Tröpfeln von Regen und dann das Klackern von Hufen.
Es ist nicht verkehrt, ausschweifend zu schreiben, aber achte auf gute Dosierung, sonst wirkt dein Text schnell langatmig statt stimmungsvoll. Es gibt immer Stellen an denen gilt: Weniger ist mehr.
Was mir auffällt: Du wechselst öfters das Subjekt mitten im Satz, was zu stärker verschachtelten Sätzen als sonst führt. Manche Handlungen kannst du aber vom ersten Subjektausführen lassen (Bsp oben: Hand gleitet über Flüssigkeit -> Flüssigkeit gerät in Aufruhr und macht Bilder. Ich habe daraus gemacht: Hand gleitet über Flüssigkeit, versetzt sie in Aufruhr und macht damit Bilder.)
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der Hauptstadt Hoorn am Horizont zu donnerten. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand über die sechshundert Fuß hohen Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
An der Spitze von über acht Dutzend Reitern galoppierte auf einem weißen Hengst der Prinz in prunkvoll verzierter Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seinem, für die Schönheit berühmten, Gesicht. Gesicht, das selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, die weiche Schönheit zeigte, die bei den Damen am Hof so beliebt war.
(Sorry, aber wenn du nur sagst, dass sein Gesicht schön sein soll, nehme ich dir das nicht ab. Dann kasst du den Teil streichen. Aber als Frau reagiere ich futterneidisch, wenn ein Mann von anderen Frauen als schön empfunden wird, deswegen habe ich eben eine halbe Ewigkeit gescrollt, um diesen Halbsatz wieder zu finden. Btw: )Bei wilder, haselnussbrauner Mähne muss ich an diverse "Erotik"-Geschichten denken. *kicher*
An seiner Seite ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors dunkelblauer Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbons beigefarben und mit einem schwarzen Bunyip versehen war. (Dunkelblaue Goldfäden?
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns über ihren rasselnden Kettenhemden.. (Punkt weg)
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. (Aaaw, wie poetisch. Aber wieso ist denn plötzlich Abend? In meinem Kopf ist noch Mittag, ich habe noch keine Abenddämmerung gesehen!) Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich die Straße schlängelte. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
(An dieser Stelle wechselst du plötzlich von der Totalen zu Theodors Innenleben. Was hältst du davon, seine Empfindungen schon vorher anklingen zu lassen, z.B. wenn er die Mauern am Horizont erblickt (Erleichterung? Gereiztheit?) oder beim Anblick der altbekannten Wappen und Mantelfarben?)
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann wäre der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte wegen der Gefahr darauf bestanden.
Resigniert stieß Theodor einem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier bäumte sich auf vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht(Komma) bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder gar in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend(Punkt) bei den Bei dem Gedanken daran durchfuhr Theodor ein eiskaltes Kribbeln. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus zu beobachten.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie Gestandene Soldaten blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten, allesamt gestanden Soldaten.
Theodor zwang jedoch seinen Blick genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren die untoten Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was genau und wie, und vor allem so schnell. Theodor schüttelte den Kopf.
Lange Lang war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge, im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander einander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. (Komisches Bild. Als ob Gräber im Normalfall warme Kuschelgruben sein sollen.) Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Theodors feuchte Hände klebten an der Innenseite seiner Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft, dabei war der Prinz gerademal zwei Mondtänze älter als Theodor.
Das Meer verschluckte den Letzen letzten Lichtstrahl der Sonne. Zwischen den Wolkenfetzen am Nachthimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Bald würden sie ihren dreißigtägigen Tanz fortsetzen.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war die Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter. (Ein erfahrener Kommandant müsste doch wissen, wann ein Befehl sinnvoll ist, und wann nicht. Also: Wann er brüllen kann, und wann er besse seine Kehle schont.)
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung Wegbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu erkennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut. Aber es war auch nicht mehr als verschwommen Schemen.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Halten, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagierte zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit der Gestalt auf dem Weg zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze platzte auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken und sein Herz macht machte einen Sprung.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl, als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam zusprang, und stieß dessen Körper mit der Klinge zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu irgendwelchen Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben.
Theodor sah aus den Augenwinkel, wie Sir Bylbon versuchte(Komma) sein vor Angst wahnsinniges,(kein Komma) Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und der gurgelnde Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt. (Orange: Langatmiges Blabla. Solche Details würde ich nur beschreiben, wenn der Gegner langsam auf en Helden zuschlurft, und er selber Zeit zum gucken hat. Hat der Held keine Zeit, sieht er nur graue Schemen/Gestalten oder eben Ghule, und mehr braucht der Leser auch nicht zu wissen. Fett: Wiehernde Pferde sind i. A. lebendig, das ist doppelt gemoppelte Effekthascherei.))
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. (Der Satz iliest sich verdreht. Vielleicht: "WEitere Ghule sprangen auf Theodors Pferd, krallten sich fest und schnappten nach dem Ritter" ?) Dunkles Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat um sich, zertrampelte mehren mehreren Untoten ihre Schädel. Verzweifelt versuchte klammerte sich Theodor Absborgen sich an seinem wilden Pferd festzuklammern, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach, doch vergeblich. Sein Pferd scherte keilte aus. Mit einem Im hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenem. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie mehrere Ghule über sein Pferd herfielen. Theodors Schädel dröhnte. Sein Schwert! Wo verdammt war sein Schwert? Er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln es finden konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss Theodor seinen Arm hoch. Die Zähne (Welche Zähne?) Der Ghul biss zu und seine Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Fäden aus schwarzen Schwarzer Schleim und Blut spritzten über die Rüstung. (Fäden spritzen nicht.) Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, (Langatmig, bremst das Erzähltempo...) heulte wütend auf und fuhr mit den Krallen über sein Brustharnisch, biss mit seinen verbliebenen Zähnen Zahnstummeln auf den Panzer des Armes rum, der vor schwarzen Körpersäften glänzte. Theodor warf das Ungeheuer von sich zu Boden, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. (Ich hab den Ghul mal zu Boden geschmissen, damit der Kopf auch unten ist.) Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, während sein Herz marschierte und seine Verdauungstrakte rebellierten. (Diese Bilder wirken unbeholfen.)
|
OK, bis hierhin erst mal. Ich hoffe, ich komme später zu mehr.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Drakenheim
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 44
Beiträge: 389
NaNoWriMo: 50166
Wohnort: Burg Drakenheim Gelehrtenturm
|
  12.01.2016 14:40 12.01.2016 14:40
von Drakenheim
|
 |
|
| Leveret Pale (Verfasst am: 11/01/2016 20:10) hat Folgendes geschrieben: |
[...] während sein Herz marschierte und seine Verdauungstrakte rebellierten. (Da wären wir wieder. Marschieren klingt nach Disziplin und Entschlossenheit, das passt nicht in diese Situation. Verdauungstrakte hat der Mensch üblicherweise nur einen, nicht mehrere.)
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der Schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. (Beim Schnellen Lesen habe ich das Bild, dass er hinter den Ghulen her ist, weil "jemandem auf den Fersen sein" ein aktive Handlung ist. Aus der Sicht des Verfolgten hat der die Verfolger meistens "an den Hacken" kleben.) Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. (wohl eher kurz im Getümmel aufblitzen? Funkeln passt eher zu Gegenständen, die in Ruhe auf dem Boden rumliegen.)Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn erneut Ghule an. (Der Satz ist eine korrekte Beschreibung, aber langweilig.)
Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Stoff, als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich in dem Gewand und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren weiterer Ghulen. Er erledigte einen nach dem anderen, während er sich eine Schneise durch das Schlachtfeld schlug. (Liest sich wie "Er erschlug drei Ghule. Dann erschlug er viele weitere Ghule." Was hat es mit den ersten drei jetzt besonderes auf sich gehabt, dass sie extra erwähnt werden?)
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach. Woher kamen sie? Theodors Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Eingeweiden und der Gestank des Moores umhüllten ihn, benebelte seinen Verstand, genauso wie die Schreie der sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Formation noch dem Ansturm standhielt. Sie konnten nur noch hoffen(Komma) Ehrenvoll ihre Haut möglichst teuer zu verkaufen.
Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim quoll aus seinem Rachen und bespritzte Theodors Rüstung. Krallen schabten über Stahl. Theodor trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. (Das Bild mit dem Tanz nehme ich für überlegene Kämpfer auch gerne, aber hier kommt es etwas abrupt.) Als würde ihn ein sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in die Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. (Relativsätze bremsen so stark ab. Ich bezweifle auch, dass es die Klinge ist, die herumwirbelt. Entweder, Theodor wirbelt selber herum, oder er wirbelt die Klinge herum.) So zog Theodor seine blutigen Bahnen, dem Sensenmann gleich, durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder und Theodor verlangsamt sich auf den Takt der Realität. Der anormale Schlachtrausch klang ab. (Insgesamt vier Umschreibungen für ein und denselben Sachverhalt.) Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste mehrere Dutzend der Untoten erschlagen haben. (Hier steht gleich zweimal, dass er viele Feinde getötet hat) Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand mehr, der noch zu einem Atemzug in der Lag Lage war. (Unangemessen umständliche Formulierung, finde ich jedenfalls.) Ghule stürmten in einiger Entfernung vorbei zur Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. (Beginnst du den Satz mit den Ghulen, gibst du ihnen eine Wichtigkeit, als ständen sie direkt vor ihm und sprängen gleich in sein Gesicht. Da sie in einiger Entfernung agieren und ihn nicht beachten, würde ich den Satz mit der Entfernung beginnen: "In einiger Entfernung stürmten Ghule zur Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte.")
Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße dort versammelt zu ihrem letzten Gefecht. Sie kämpfte kämpften (sicherheitshalber das Wort Gruppe aus dem vorherigen Satz entfernen?) ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Theodor machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer, die Arme viel schwer, der Blick verschwommen und pulsierend vom Schweiß und Erschöpfung. (Pulsierender Schweiß... BILDER! BILDER in meinem Kopf! ARRGH!  )) Mach ruhig langsamer an dieser Stelle. Lass ihn erst mal auf die Gruppe zu gehen und die Ghule erreichen, bevor er sie erschlägt. Damit kannst du schon zeigen, dass er langsamer geworden ist. ) Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich endgültig verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Kälte, die ihn durchfuhr als hätte ihn jemand mit Eiszapfen gespickt. )) Mach ruhig langsamer an dieser Stelle. Lass ihn erst mal auf die Gruppe zu gehen und die Ghule erreichen, bevor er sie erschlägt. Damit kannst du schon zeigen, dass er langsamer geworden ist. ) Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich endgültig verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Kälte, die ihn durchfuhr als hätte ihn jemand mit Eiszapfen gespickt.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. (Boah. So leicht ist noch niemand durch eine Belagerung gedrungen.  ) Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen standzuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten (surrten oder sirrten? Aber zurren tut man Schnüre!) durch die Luft und schlugen,(kein Komma) die nach ihnen greifenden,(kein Komma) Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. (Entweder "schwarz" oder "untot", aber beides auf einmal ist mir zu viel.) ) Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen standzuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten (surrten oder sirrten? Aber zurren tut man Schnüre!) durch die Luft und schlugen,(kein Komma) die nach ihnen greifenden,(kein Komma) Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. (Entweder "schwarz" oder "untot", aber beides auf einmal ist mir zu viel.)
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als er sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigten Köpfen, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in den Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen seine Todesschreie abrupt ab, als hätte die weiße Wand sie verschluckt. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg. (keiner drängt ihnen nach? Keiner versucht, den schreienden Typen zu retten?)
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren außer Theodor übrig geblieben. (Wenn du in Theodors Sicht bleiben willst, lass ihn sich umblicken und durchzählen. Warum sollte der Erzähler ihm diese Arbeit abnehmen?) Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an einem seiner Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt.
Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schultern und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. (Ähm... ich blinzle auch gerade ungläubig. Das Schienbein... meinst du wirklich den langen Röhrenknochen da vorne unter dem Knie? Einen ganzen Knochen rausgerissen? So, aus den Gelenken raus, und der hält sich noch und schwingt seine Axt, statt sich wie irre brüllend auf dem Boden zu wälzen und sich zu wünschen, dass er tot ist?)
Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft. (Zweimal "sie" so dicht hintereinander... Effekthascherei... gefühlsarm, aber nicht nüchtern... Der orangefarbene Satz gefällt mir einfach nicht.)
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. (so schnell von schweratmend auf stockenden Atem?) Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte in seinen Ohren, wie das Klopfen eines lebendig Vergrabenen in dessen Sarg, in seinen Ohren. ( )) ) )) )
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft (jetzt hecheln sie wieder!) und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. (Du lässt sie wirklich ihre Schwerter umarmen?) Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige schwere Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob sich etwas Mächtiges und absolut Tödliches ihnen nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren und sie ersticken zu wollen. Theodor verstärkte den Griff um sein Schwert. ("meint, zu erkenne", "schien zu vibrieren": Das sind schwache Formulierungen, die dem Absatz seine Wirkung rauben. Der nächste Satz leidet unter Adjektivitis (merkwürdig, schwer, anders, mächtig, absolut tödlich). Das zerfranst deine Aussage, statt sie zu unterstützen.)
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Sir Theodor Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Unbekannten richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass gräulich. (blass oder gräulich, oder von blassem Grau) Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren.
Am meisten verstörten Theodor die Augen. Glühende Kohle Kohlen, deren Blick Blicke ihn durchbohrte durchbohrten wie Nägel, die man ihm in den Schädel hämmerte. Er spürte, wie sich eine Gänsehaut sich seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz mit ihr ihrer eiskalten Hand und drohte es in ihren Klauen zu zerquetschen, doch (er?) blieb standhaft. (Finde ich überfrachtet mit Bildern) Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchstens in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte. (Hier reitest du ein wenig auf dem Geglühe herum. Und wenn er sich an die Ammenmärchen kaum mehr erinnert, sind sie dann erwähnenswert?)
|
Ok. Mutter möchte wieder an ihren eigenen Computer. Ich muss wohl die lahme Gästekiste hochfahren.
Ich hoffe, es ist bei aller Spitzfindigkeit etwas nützliches für dich dabei.
Und falls jemand meint, Rechtschreibfehler entdeckt zu haben, dann warte er bitte die nächste Rechtschreibreform ab.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  12.01.2016 17:34 12.01.2016 17:34
von Leveret Pale
|
 |
|
@Drakenheim Tausend Danke für deine extrem Ausführlichen Anmerkungen und Kommentare. Sehr vieles davon war extrem nützlich und hilft mir weiter, aber zum Prolog möchte ich ein paar Worte verlieren, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ihn nicht verstanden hast oder, dass er nicht ganz so funktioniert, wie ich es will.
Erstmal zum Ort: Dass Licht aus dem Boden kommt ist schon richtig, denn, wenn man genau liest ( oder ich besser beschreiben würde), dann sollte ersichtlich sein, dass der Palast sich nicht auf der Erde befindet sondern im Weltraum inmitten von Schwarzen Löchern schwebt ( im Text mit der alten Bezeichnung "schwarze Sterne" beschrieben, weil Löcher mMn viel zu plump klingt). Des Weiteren gibt es das Wort mollusken eigentlich als Adjektiv nicht, aber ich verwende diesen Neologismus hier, mangels besserer Alternativen. Spätestens hier oder an der Stelle, wo sich raus stellt, dass der König aller König vierzehnmilliarden Jahre alt ist, sollte klar sein, dass wir hier mit etwas schon lange nicht mehr menschlichen zu tun haben. Dass du bei amorph an Amöben denkst, ist nicht verkehrt, aber zeigt glaub ich, dass du nicht zu der Zielgruppe meines Romans gehörst, den ich in erster Linie als Horrorroman ( insbesondere in der Tradition des kosmischen Horrors von Chambers und Lovecraft ohne aber deren Universen zu verwenden ) sehe in einem Highfantasysetting, aber nicht als klassischen Fantasyroman. Ich schreibe zwar eigentlich ausschließlich für mich selbest, aber auch für Leute, die zufällig den gleichen Geschmack haben, also Genreveteranen des Horrors. Diese assoziieren das Wort amorph wohl eher mit dem Bild eines Shoggothen oder Azathoths und Hasturs.
Aber vielleicht mache ich auch etwas falsch.
Auf jeden Fall tausend Dank für die Anmerkungen und Korrekturen.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Drakenheim
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 44
Beiträge: 389
NaNoWriMo: 50166
Wohnort: Burg Drakenheim Gelehrtenturm
|
  12.01.2016 23:38 12.01.2016 23:38
von Drakenheim
|
 |
|
Oha, ja, das Bild im Prolog ging tatsächlich an mir vorbei. Ich bin eindeutig mehr Biologin als Leserin des kosmischen Horrors.
Dann machen Tentakel als erste Assoziation bei "mollusk" mehr Sinn als ich dachte. *kopf-kratz*
Eigentlich wollte ich grad weiter machen, aber mir fehlt die Konzentration. Ich lese mal einfach weiter, ohne Kommentieren, ich will wissen, wie es weiter geht.
| Leveret Pale (Verfasst am: 11/01/2016 20:10) hat Folgendes geschrieben: |
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien war dieser keines Wegs beeindruckt zu sein, im Gegenteil, er schien die Waffe zu belächeln.
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror gefrieren ließ und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?«
Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Klinge. Dampf zischte unter den knochigen Finger hervor, an denen, anstelle von Fingernägeln, schwarze Klauen waren. (oder waren die Fingernägel zu schwarzen Klauen geformt?) Die Klinge begann zu glühen glühte und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm und nicht mehrfach gefalteter, fendorranischer Stahl. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbelnd durch den Nebel davon. (Von was kommt die Wirbelbewegung? Er lässt es los, er wirft es nicht.)
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem Ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück, bis auf einen, der und ein Solddat stellt sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er (wer? Theo oder der andere?) reagieren konnte(Komma) packte der Fremde ihn am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, (Du magst Nüsse, oder? Haselnussbraune Haare, Nussknackerklänge bei Knochenbruch...) spritzten Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten züngelten aus dem Stupf Stumpf hervor. Während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch los wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten schlagartig und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten sie.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor(Punkt) Einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihm, wie zwei Fohlen hinter ihrer Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer wahnsinniger Mut im Angesicht des Todes, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. (Huh? Achja, da begann ja vor ein paar Absätzen ein Dialog.) Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diese klammerte er sich nun verzweifelt fest.
So, jetzt aber echt nur lesen!
|
Wo du kürzen kannst:
- Anzahl Adjektive halbieren
- Redundanzen aussieben (leblose Leiche, "dachte, er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte" etc.
- Lange Sätze entschachteln (Relativsätze umarbeiten, beim Subjekt bleiben, keine unterbrechenden, den Leser irritierenden, da es plötzlich um etwas anderes geht als eben noch, Formulierungen...)
- Relativierungen aufheben("schien zu glühen" -> "es glühte"; "glaubte, zu spüren" -> "er spürte")
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  09.02.2016 14:06 09.02.2016 14:06
von Leveret Pale
|
 |
|
Tausend Dank Drakenheim für deine äußerst hilfreichen Verbesserungsvorschläge. Ich bin gerade im vierten, und damit wahrscheinlich finalen, Verbesserungsdurchgang, nachdem ich zweieinhalb Wochen Pause gemacht habe. Die Testleser konnte in der Zeit fleissig Fehler und Lücken suchen und ich Distanz zum Text gewinnen.
Hier mal der aktuelle Stand des ersten Kapitels.
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der Hauptstadt Hoorn am Horizont zu donnerten, wo der Abend dämmerte. Die unzähligen Türme und Festungsanlagen der größten Stadt der Menschheit zeigten, wie die erstarrten Finger einer toten Hand über die sechshundert Fuß hohe Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. Der Anblick erweckte sowohl Hoffnung, die Stadt rechtzeitig zu erreichen, als auch Furcht vor der Nacht in Theodors Brust.
An der Spitze der acht Dutzend Reiter galoppierten drei Ritter auf weißen Hengsten, Sir Theodor, Sir Bylbon und Prinz Levi.
Der Prinz trug eine prunkvoll verzierte Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seinem, für die Schönheit berühmten, Gesicht.
Zu seinen Flanken ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors dunkelblauer Umhang war mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbons beigefarben und mit einem schwarzen Bunyip versehen war.
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns über ihren rasselnden Kettenhemden.
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die düsteren Sumpfwälder, durch die sich die Straße schlängelte. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann wäre der Zorn des Königs über die Verspätung ihr geringstes Problem, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Fersen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte wegen der Gefahr darauf bestanden.
Resigniert stieß Theodor seinem Pferd abermals die Fersen in die Seiten. Das arme Tier bäumte sich auf vor Schmerz und Erschöpfung.
Die Aussicht, bei Nacht durch die toten Wälder und Sümpfe zu reiten, oder gar in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Bei dem Gedanken daran durchfuhr Theodor ein eiskaltes Kribbeln. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken und schienen die Wege von dort aus zu beobachten.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten, allesamt gestandene Soldaten.
Theodor zwang seinen Blick genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor über zwei Mondtänzen abreisten, waren die untoten Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was genau und wie, und vor allem so schnell. Theodor schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge, im Norden, wo Eisbären und Mammuts einander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab brachte. Ein kalter Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Theodors feuchte Hände klebten an der Innenseite seiner gepanzerten Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft, dabei war der Prinz gerademal vier Mondtänze älter als Theodor. Beide waren erst neunzehn.
Das Meer verschluckte den Letzten Lichtstrahl der Sonne. Zwischen den Wolkenfetzen am Nachthimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Bald würden sie ihren dreißigtägigen Tanz fortsetzen.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden, die von den Sümpfen auf die Straße krochen. Bald war die Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter.
Sie donnerten so schnell um eine Wegbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu erkennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut. Aber es war auch nicht mehr als verschwommen Schemen.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, doch der Prinz vor ihm reagierte zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß mit der Gestalt auf dem Weg zusammen. Entsetzt sah Theodor wie die Gestalt auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken und sein Herz machte einen Sprung.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl, als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Sumpf auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und stieß dessen Körper mit der Klinge zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen lautstark zum Schöpfer oder zu irgendwelchen Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Blut ergoss sich wie Regen auf die Straße.
Theodor sah aus den Augenwinkel Sir Bylbon, der versuchte, sein vor Angst wahnsinniges Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und der gurgelnde Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Dunkles Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat um sich, zertrampelte mehrere Untote oder trat nach ihren Schädel. Verzweifelt klammerte sich Theodor Absborgen an seinem wild gewordenem Pferd fest, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach, doch vergeblich. Sein Pferd keilte aus. Mit einem hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränktem Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenem. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie mehrere Ghule über sein Pferd herfielen. Theodors Schädel dröhnte. Wo verdammt war sein Schwert? Er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss Theodor seinen Arm hoch. Der Ghul biss zu. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Fäden aus schwarzen Schleim und Blut spritzten über die Rüstung. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte wütend und fuhr mit den Krallen über seinen Brustharnisch, biss mit den verbliebenen Zähnen auf den Panzer des Armes rum, der vor Körpersäften schwarz glänzte. Theodor warf das Ungeheuer von sich und zu Boden, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, während sein Herz marschierte und sein Verdauungstrakt rebellierte.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen. Der Schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Getümmel auf dem Boden aufblitzen. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn erneut Ghule an.
Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit der Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Stoff, als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich in dem Gewand. Mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Theodor wirbelte herum und hackte auf die anstürmenden Untoten ein.Er erledigte einen nach dem anderen, während er sich eine Schneise durch das Schlachtfeld schlug.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach. Woher kamen sie? Theodors Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Eingeweiden und der Gestank des verfaulenden Sumpfwassers umhüllten ihn, benebelte seinen Verstand, genauso wie die Schreie der sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte. Sie konnten nur noch hoffen, ihre Haut möglichst teuer zu verkaufen.
Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte. Das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim quoll aus seinem Rachen und bespritzte Theodors Rüstung. Krallen schabten über Stahl. Theodor trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Widerlich.
Mehrere Ghule stürmten auf Theodor zu, während der Schwerverwundete sich am Boden wälzte.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft Theodors Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er zugleich blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in die Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die langsamen Attacken des Dritten und durchtrennte die Kehle des Vierten. So zog Theodor seine blutigen Bahnen durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder und Theodor verlangsamt sich auf den Takt der Realität. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste mehrere Dutzend der Untoten erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand mehr, der noch zu einem Atemzug in der Lage war. In einiger Entfernung stürmten vereinzelte Ghule vorbei zur Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte.
Eine Gruppe Überlebender hatte sich dort zu ihrem letzten Gefecht versammelt. Sie kämpften ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Theodor hieb nach einem Ghul, der sich zu ihm umdrehte. Theodors Arme waren nun viel langsamer, die Sicht verschwommen und pulsierend von Schweiß und Erschöpfung. Er brauchte mehrere unbeholfene Hiebe, bis die Kreatur zu Boden ging. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich endgültig verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Kälte, die ihn durchfuhr als hätte ihn jemand mit Eiszapfen gespickt. Er taumelte weiter, wahllos nach Ghulen stechend und mit seinen gepanzerten Handschuhen zur Seite schubsend. Als die Soldaten drei weitere Ghule erschlugen, tat sich eine Lücke in den Angreifern auf.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen standzuhalten, der an Heftigkeit zunahm. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte.
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als er sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigten Köpfen, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in den Nebel. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen seine Todesschreie abrupt ab, als hätte die weiße Wand sie verschluckt. Für einen Augenblick zuckte es in Theodor seinem Kameraden nachzulaufen, aber er hielt sich zurück. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Theodors Kopfhaut zog sich zusammen und ein Kribbeln fuhr durch seinen Körper, als würde sein Fleisch unter der Haut kriechen. Vorsichtig warf er einen Blick über seine Schulter. Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren außer ihm übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten und eingedellten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul den halben Unterschenkel herausgerissen hatte. Mit zusammengepressten Lippen, hielt er sich mit einer Hand an einem seiner Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt.
Die Angst lag wie eine schwere Kette auf Theodors Schultern und drückte ihn hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig.
Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen. Die Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte, wie das Klopfen eines lebendig Vergrabenen in dessen Sarg, in Theodors Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft. Ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige schwere Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob eine unsichtbare Präsenz durch seinen Körper schneiden würde. Die Luft vibrierte vor Anspannung und schien die Männer ersticken zu wollen. Theodor verstärkte den Griff um sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Sir Theodor Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Unbekannten richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass gräulich. Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er kaum älter als Theodor.
Am meisten verstörten Theodor die Augen. Glühende Kohlen, deren Blicke ihn durchbohrten wie Nägel. Er spürte, wie sich eine Gänsehaut über seinen Körper spannte, erstickende Angst ergriff sein Herz mit ihrer eiskalten Hand und drohte es in ihren Klauen zu zerquetschen, doch er blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchstens in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch wirkte dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien die Waffe zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:
»Im Namen der Majestät König Cornlius Hoorn verhafte ich Euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann wird man Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch«, die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war ein Stich ins Herz »Glaubt Ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?«
Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Klinge. Dampf zischte unter den knochigen Finger hervor, die in schwarzen Klauen endeten. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm und nicht mehrfach gefalteter, fendorranischer Stahl. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Der Fremde warf es davon.
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem Ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück, bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor Theodor reagieren konnte, packte der Fremde den Soldaten am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzten Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen züngelten aus dem Stupf hervor. Während der leblose Körper zu ging zerfiel er zu Asche, noch eh er ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel auf. Die Schreie verstummten schlagartig, gieriges Schmatzen und ein verstörendes Fauchen ersetzten sie.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor. Einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihm, wie zwei Fohlen hinter ihrer Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer wahnsinniger, leichtsinniger Mut im Angesicht des Todes, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann, der dem Sir vor dem Namen würdig war, und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diese klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig oder einfach nur töricht, aber unter allen Umständen ein Narr. Für eure Unhöflichkeit müsste ich Euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch das Pfählen bevorzuge. Ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald«
Den Namen ließ Theodor schaudern, wie wahrscheinlich jeden Menschen im südlichen Königreich. General Fronwald? Der aus den Legenden, der seit einem Jahrhundert tot sein müsste?
Myriaden an entsetzen Gedanken schossen durch Theodors Kopf, doch aus seiner Kehle kam nur ein undeutlicher, röchelnder Laut, der bei Ignacio höhnisches Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe, hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie die entsprechende Huldigung.«
Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade auch noch als Vaenyr, als ein Gott bezeichnet? Nein, dass konnte nicht wahr sein.
»Nun«, fuhr der Fremde fort »wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, denn mein König duldet keine Überlebenden, auch wenn Ihr sehr unterhaltsam seid«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Finsternis von einem König gesprochen? Hoorn war seit jeher neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Theodors Herz schien für einen Moment auszusetzen. Bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an, du Scheusal«, brüllte einer der Männer hinter Theodor.
Die beiden Männer stürmten zum Angriff vor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrte, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte: »Für Hoorn, du Bestie.«
Die Hand des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss. Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung durchtrennte er damit den Schaft der Axt, sodass das Blatt wirbelnd an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte Ignacio das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte.
Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit dem Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte Theodor, die Scherben der Welt durchbohrten ihn, eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Immer wieder schlug er auf dem Boden auf, wie ein flacher Stein, der über einen See springt, und die Explosion schleuderte Theodor immer weiter, bis er gegen irgendetwas Festes prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass Theodor dachte, er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerungen wieder zusammensetzten und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesogen im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine knorrige Esche gelehnt. Seine schwarzen Haare klebten vor Schweiz getränkt an seiner Stirn. Schmerz fraß sich durch seinen ganzen Körper. Theodor war mit einer Kruste aus verbranntem und geronnenem Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeult und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte. Aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge floss Blut über sein Gesicht. Theodor hatte einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgereiz ankämpfte.
Es war beinahe still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die welken Blätter der Birken raschelten. Dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing schwer in der Luft und er glaubte von abertausenden, schwarzen Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang Theodor sich dazu aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und der Stahl knarrte laut. Mitten in der Bewegung erstarrte er und hielt den Atem an. Das Karren schien so laut, dass er dachte es würde alle Untoten im Umkreis einer Meile anziehen. Nervös ließ er seinen Blick über die Finsternis zwischen den Bäumen schweifen. Schweiß perlte an seinem Gesicht hinab. Im Schatten der Bäume glaubte er untote Gestalten zu erkennen, aber als er sich zwang nochmal hinzusehen, erkannte er im aschfahlen Mondlicht die Schemen von Büschen. Theodor atmete tief ein und zwang sich aufzustehen, wobei er bei dem lauten Ächzen des Stahls die Zähne zusammenbiss. Nichts geschah. Ohne Pferd würde zu Fuß nie noch Hoorn gelangen. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er alleine nicht rankam. Um ihn herum lagen die nun nutzlosen Teile verbeulten Metalls. Ober- und Unterschenkelröhren, Kniekacheln, Kragen, Armgeschübe, Ellenbogenkacheln, Panzerhandschuhe. Der Wert eines großen Bauernhofs. Theodor trug nur noch Strumpfhosen, Rock, Schuhe und seinen Rüstwams unter dem verbeulten Brustpanzer, auf dem ein Einhorn unter einer Schicht aus Blut hervorlinste.
Jedes Geräusch, welches er verursachte, erschien ihm unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte.
Doch es geschah nichts und so fasste er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung, in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung. Er wagte es nicht seinen Blick nach links oder rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs. Bei diesen Gedanken allein bekam er bereits feuchte Hände. Das Geräusch seiner Schritte schien in seinem Ohren ohrenbetäubend, zerrte an seinen überspannten Nerven und trieb ihn an den Rand zum Wahnsinn.
Während er den Weg starr fixierte, kam ihm irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er entsetzt, was es war.
Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jegliche Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und Theodor bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war, noch als Untoter wiederauferstehen konnte.
Sogar einen Krater, den die Explosion, die Theodor weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen, konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten.
Seine Gedanken schweiften hin und her, während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Aber solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben.
Anderseits, Vaenyr und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyr, die nekromantischen Menschengötter, waren wie die meisten anderen Götter in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Und dann, zu allem Überfluss hatte sich dieser Gott der Finsternis als Ignacio Fronwald bezeichnet.
Theodor konnte sich noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen General Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen ließ und auch vor Frauen und Kindern nicht Halt machte. Als eine Ghulepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahren auslöschte, entsandte ihn der König dorthin, um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn, besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und zu verbrennen und gleichzeitig zu lachen.
Er kehrte niemals zurück. Die ganze Armee verschwand spurlos, lediglich die verkohlten Ruinen Rosenthals blieben zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. Er war ein Gott geworden, aber wie?
Theodors Gedanken kreisten wild und irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte, wahr sein konnte oder ob er dem Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch eine dunkle, gepflasterte Straße nach Hoorn, welches über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die zyklopische Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab, wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihm griffen und er erwachte aus seinem tranceartigen Zustand. Sein Herz schlug wie ein Schmiedehammer.
Den Rest des Weges rannte er. Alles schien nach ihm zu greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie. Seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Sumpfwald, über die Große Brücke, die über den Vyl führte. Der Vyl war der größte Fluss Hoorns, der sich durch das ganze Königreich zog und es in die matschige Sumpflandschaft verwandelte. Vor der Stadt gabelte sich der Fluss und bildete so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser.
Als Theodor das große Stadttor erreichte, hämmerte er wild dagegen. Das Tor war riesig und halb so dick, wie ein Mann hoch. Die ganze Stadt Hoorn war die größte Festung der bekannten Welt.
Aus den Schießscharten über ihm riefen Soldaten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Theodor schrie bis seine Lungen fast versagten, dass er ein hoher Ritter sei, der Sohn des Grafen von Absborgen, und er würde wichtige Kunde für den König bringen. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Er torkelte erleichtert aus den Schrecken der Nacht in das helle Licht der Kerzen und Fackeln im Inneren der Mauer. Ihn erwarteten ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten im Schlepptau, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet, dennoch musste Theodor grinsen. Menschen, lebende Menschen. Er hatte es geschafft. Die Männer um ihn herum warfen Theodor misstrauische Blicke zu und das Grinsen auf seinem Gesicht verstand. Er sah an sich hinab. Getrocknetes Blut rieselte von seiner Kleidung und floss über sein Gesicht hinab zum Hals, wo sich der Rand des Wamses vollsog. Darüber war das zerbeulte und blutbefleckte Brustharnisch auf dem vage ein schwarzes Einhorn zu erkennen war.
»Wer seid Ihr und was wollt Ihr zu dieser späten Stunde? Was ist mit Euch passiert?«, fragte der Kommandant.Nur durch viele vage Erklärungen und dem Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust, konnte Theodor die Männer letztendlich von seiner Identität überzeugen. Er zitterte und wich den Fragen über die Ursachen seines Zustands aus. Er bat darum, dass man ihn sofort zum König brachte, wenn er auch nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstvorschriften der Mauer vorsahen.
Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern, wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die, selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten, Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zum Schöpfer, welcher die Welt erschaffen hatte, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen.
Hoorn war das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelsbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber keine Augen. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er dem König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihm Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen. Man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Es beruhigte Theodor nicht sofort zum König zu müssen und diese Pflicht etwas hinauszuzögern, aber es hielt ihn nicht davon ab weiter zu grübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um Theodor zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum. Seine Eingeweide waren kalt und verknotet, bei der kleinsten hektischen Bewegung um ihn herum zuckte er zusammen.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, namens Gaius Camo, der die ganze Zeit lächelte, wusch Theodors Verletzung am Kopf aus und nähte sie mit einer heißen Nadel zu. Theodor war zu erschöpft, um vor Schmerzen zu schreien und ließ alles über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihm noch einen Aufguss aus beruhigenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und während die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen eine Zeit lang einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken, um die quälenden Erinnerungen im Rausch zu vergessen, war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte.
Angewidert schüttete er den Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er, wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Theodor fand keinen Schlaf. Wann immer er seine Augen schloss, sah er die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer; sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen. Er erinnerte sich an den rätselhaften Blutrausch, der ihn gepackt hatte, aber so musste es sich wohl anfühlen, wenn man in einem Kampf versank. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulicher als alles, was er zuvor erlebt hatte. Jahrelanges Training, Turniere, Duelle und Buhurte mit stumpfen Schwertern hatten ihn für den Kampf ausgebildet, aber nicht dafür vorbereitet. Er hatte überlebt, aber zu welchem Preis?
Wie viele Untote hatte er erschlagen? Er wusste es nicht, aber dabei waren sie alle einst Menschen gewesen. Das Gesicht des Jungen, in dem sein Schwert stecken geblieben war, erschien ihm vor seinen inneren Augen. Theodor fühlte sich dreckig.
All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch mit dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyr und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen, aber auch ein schwermütiger Seufzer drang. Er dachte an seine Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets geschimpft hatte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihm in die Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Dienern Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen, um seine Familie zu warnen. Er brach nach wenigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwachte schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwachen kam niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Theodors ganzer Körper verkrampfte sich und er rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung gewann und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  13.02.2016 19:18 13.02.2016 19:18
von Leveret Pale
|
 |
|
Prolog
Der König aller Könige durchschritt die verwaisten Hallen seines Palastes. Keine Diener, keine Statuen begegneten ihm auf seinen ewigen Wanderungen.
Durch die Risse, Brüche und Fenster in den düs-teren Gemäuern und Böden fiel von allen Seiten das tote Licht der schwarzen Sterne und der sterbenden Sonnen ein. Die Schritte des Königs verursachten kein Geräusch in der kosmischen Leere, kein Wind zerrte an den zerfetzten Lumpen unter denen er sei-nen amorphen Körper verbarg. Er glitt über den glatt-polierten, bröckelnden Boden aus schwarzen Gagat in einen hohen Saal, an dessen Ende auf einem Podest ein Becken stand, neben dem sich in Regalen aus schwarzen Gerippe abertausende Glasfläschchen sammelten. In den Gläsern schwappten, brodelten und schwebten Flüssigkeiten in allerhand tristen und düsteren Farben. Über dem Becken hing ein angelau-fener Spiegel. Der König sah in sein eigenes entstelltes Antlitz, welches er sogar vor sich selbst unter einer Kapuze verbarg. Sein Blick fiel auf die glänzenden Tränen, die schwer an einem geschmiedeten, ge-knickten Ring um seinen Hals hingen.
Es waren sechs.
Sechs Tränen, die die erste Schöpfung vergossen hat-te.
Sechs Tränen, die den König aller Könige gekrönt hatten. Sechs Tränen, mit denen der König die erste Schöpfung vernichtet hatte.
Sechs Tränen, mit denen er die neue Schöpfung er-schaffen hatte.
Ein gurgelnder Laut, der ein melancholischer
Seufzer sein sollte, drang aus der mollusken Kehle.
Der König streckte seine zitternde Hand nach einem der Gläser aus und zog es zu sich. Andächtig, beinahe ehrfürchtig, schraubte er den Deckel auf. Myriaden an gemischten Düften schlugen ihm entge-gen, die Gerüche einer toten, verwesenden Welt. Be-gierig schnüffelte er an ihren Leichendüften, die von anderen Zeiten erzählten, von anderen Welten, von der ersten Menschheit und den letzten Helden. Es waren die liquiden Erinnerungen an die erste Schöp-fung, jenem Universum, welches den König hervor-gebracht hatte und das der König vernichtete, als er das Neue gebar. Dreizehnmilliarden Achthundert-neunzehnmillionen Dreihundertsiebenundvierzigtau-send und Vierhundertzweiunddreißig Jahre waren seit damals vergangen und noch immer triefte die Wunde, die dieser Verlust in den König gerissen hat-te, und erfüllte ihn mit düsterster Trauer. Aber was war schon Zeit, wenn nicht mehr als eine Richtung, in der sich der König beliebig bewegen konnte, nur nicht zurück, zu dem was vor ihr, vor der Geburt der zweiten Schöpfung, war?
Vorsichtig goss er die Erinnerungen in das Becken vor ihm, darauf achtend, dass kein einziger Tropfen
verloren ging.
Das Becken füllte sich bis zum Rand mit der dunk-len Flüssigkeit, die mal in Karminrot mal in Gold zu schillern schien. Die Hand des Königs aller Könige glitt über der ebenen Oberfläche der Flüssigkeit, die darauf in Aufruhr geriet, zu brodeln begann und Bil-der hervorbrachte, die aufstiegen und den König zu-rück in die erste Schöpfung versetzten.
Der König aller Könige sah Helden kämpfen und sterben, Reiche sich erheben und fallen, Männer nach Mächten lechzen, die ihre Fähigkeiten bei wei-tem überstiegen.
Er hört das Lied der Hyaden, das Rauschen des
Eliriumstroms, aus Myriaden Kehlen die letzten Ge-bete der ersten, gescheiterten Menschheit, das Bers-ten von Stein, das Tröpfeln von Regen und dann das Klackern von Hufen.
Theodor
Die Hufe der Pferde rissen den matschigen Un-tergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden unter ihnen bebte, während sie auf die Stadtmauer der Hauptstadt Hoorn am Horizont zu donnerten, wo der Abend dämmerte.
Die unzähligen Türme und Festungsanlagen der größten Stadt der Menschheit zeigten, wie die erstarr-ten Finger einer toten Hand, über die sechshundert Fuß hohe Stadtmauer zum Himmel. Dahinter funkel-te ein dünner, dunkelblauer Streifen des
dynerischen Meeres. Der Anblick erweckte sowohl Hoffnung, die Stadt rechtzeitig zu erreichen, als auch Furcht vor der Nacht in Sir Theodors Brust.
Theodor galoppierte zusammen mit Prinz Levi und Sir Bylbon an der Spitze von acht dutzend Reitern. Der Prinz trug eine prunkvoll verzierte Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathan-wappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräu-selte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seinem, für die Schönheit berühmten Gesicht.
Zu seinen Flanken ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs. Im Gegensatz zum Prin-zen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors dunkelblauer Umhang war mit dem goldenen Einhorn bestickt - das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbons beigefar-ben und mit einem schwarzen Bunyip versehen war.
Die Männer hinter ihnen trugen das dunkelgrün der Armee Hoorns über ihren rasselnden Kettenhemden.
Die Sonne küsste die Oberfläche des Meeres. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die düsteren Sumpfwälder, durch die sich die Straße schlängelte. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen.
Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen und das nur wegen diesen verdammten Feiern, die
Theodor gründlich satt hatte. Bei jeder noch so klei-nen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherren auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den an-deren Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann wäre der Zorn des Königs über die Verspätung ihr geringstes Prob-lem, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch au-ßerhalb der Stadt aufhielten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Fersen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte wegen der Gefahr darauf be-standen.
Resigniert stieß Theodor seinem Pferd abermals die Fersen in die Seiten. Das arme Tier bäumte sich auf vor Schmerz und Erschöpfung.
Die Aussicht, bei Nacht durch die toten Wälder und Sümpfe zu reiten, oder gar in ihnen zu nächti-gen, war alles andere als verlockend. Bei dem Gedan-ken daran durchfuhr Theodor ein eiskaltes Kribbeln. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren ver-lassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen geronnenen Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umste-henden Birken und schienen die Wege von dort aus zu beobachten.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf ka-men, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blick-ten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten.
Theodor zwang seinen Blick genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Ver-schlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn keiner von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte. Vielleicht waren die schweren Rüs-tungen unter diesen Umständen sogar vernünftig.
Als sie vor zwei Mondtänzen abgereist waren, waren die untoten Ghule außerhalb ihrer Grüfte kei-ne Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste was genau und wie, und vor allem so schnell. Theodor schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlo-bung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasteron, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbro-cken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge, im Norden, wo Eisbären und Mammuts einander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab brachte. Ein kalter Ort, der kalt-herzige Menschen heranzog.
Theodors feuchte Hände klebten an der Innenseite seiner gepanzerten Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Ga-lopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft, dabei war der Prinz gerademal vier Mondtänze älter als Theo-dor. Beide waren erst neunzehn.
Das Meer verschluckte den Letzten Lichtstrahl der Sonne. Zwischen den Wolkenfetzen am Nacht-himmel erschienen die beiden Monde Fratos und So-ra. Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein beiges Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Bald würden sie ihren dreißigtägigen Tanz fortsetzen.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu di-cken Nebelschwaden, die von den Sümpfen auf die Straße krochen. Bald war die Sicht auf wenige Schrit-te beschränkt. Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufe unter.
Sie donnerten so schnell um eine Wegbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er im Mondlicht sche-menhaft einen Mann in schwarzer Kleidung zu er-kennen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und Augen brennend wie Glut. Aber es war auch nicht mehr als verschwom-men Schemen.
Instinktiv riss Theodor die Zügel seines Pferdes zu-rück. Es kam gerade noch so zum Stehen, doch der Prinz vor ihm reagierte zu langsam. Sein Pferd strau-chelte und stieß mit der Gestalt auf dem Weg zu-sammen. Entsetzt sah Theodor wie die Gestalt auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine über-reife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken und sein Herz machte einen Sprung. Ein lautes mark-erschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl und Schwertern, die aus ihren Scheiden geris-sen wurden. Alles zog sich in Theodor zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Ghule lösten sich aus dem Ne-bel und stürmten kreischend vom Sumpf auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohle-schwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach den ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und stieß dessen Kör-per mit der Klinge zurück in den Dreck der Straße.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen lautstark zum Schöpfer oder zu irgendwelchen Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über sie hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die ver-suchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Blut ergoss sich wie Regen auf die Straße.
Theodor sah aus den Augenwinkel Sir Bylbon, der versuchte, sein vor Angst wahnsinniges Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und der gurgelnde Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weite-re Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und ris-sen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Dunkles Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wie-hernd durch und trat um sich, zertrampelte mehrere Untote und trat nach ihren Schädel. Verzweifelt klammerte sich Theodor Absborgen an seinem wild gewordenem Pferd fest doch vergeblich. Sein Pferd keilte aus. Mit einem hohen Bogen flog Theodor über den Kopf des Pferdes hinweg. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränktem Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trocke-nem. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie mehrere Ghule über sein Pferd herfielen. Theodors Schädel dröhnte. Wo verdammt war sein Schwert? Er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss Theodor seinen Arm hoch. Der Ghul biss zu. Die verfaulten Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Fäden aus schwarzen Schleim und Blut spritzten über die Rüstung. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte wütend und fuhr mit den Krallen über seinen Brustharnisch, biss mit den verbliebenen Zähnen auf den Panzer des Ar-mes rum, der vor Körpersäften schwarz glänzte. The-odor warf das Ungeheuer von sich und zu Boden, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm nieder-sausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen The-odor, während sein Herz marschierte und sein Ver-dauungstrakt rebellierte.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen. Der Schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zer-sprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Getümmel aufblit-zen. Gerade als er das Heft mit seiner Hand um-schloss, griffen ihn erneut Ghule an. Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit der Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Stoff, als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich in dem Gewand. Mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darun-ter. Theodor wirbelte herum und hackte auf die an-stürmenden Untoten ein. Er erledigte einen nach dem anderen, während er sich eine Schneise durch das Schlachtfeld schlug.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend neuer Untote nach.
Woher kamen sie? Theodors Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Eingeweiden und der Gestank des verfaulenden Sumpfwassers umhüllten ihn, benebelte seinen Ver-stand, genauso wie die Schreie der sterbenden Män-nern und Untoten, die zu einer Sinfonie der Agonien verschmolzen. Diesen Kampf konnten sie nicht ge-winnen, stellte Theodor verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte. Sie konnten nur noch hoffen, ihre Haut möglichst teuer zu verkaufen.
Ein Ghul sprang auf Theodor. Er hatte das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes. Theodor riss das Schwert hoch. Die Klinge blieb im Hals des Untoten stecken. Der Untote kreischte, schwarzer Schleim quoll aus seinem Rachen und bespritzte Theodors Rüstung. Krallen schabten über Stahl. Theodor trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Widerlich. Mehrere Ghule stürmten auf Theodor zu, während der Schwerverwundete sich am Boden wälzte. Sie kamen aus allen Richtungen.
Theodors Kehle schnürte sich zu, er fühlte sich als würde er an Angst ersticken, als er spürte wie sich langsam in seinem Körper etwas ausbreitete, energe-tisch durch seine Adern kroch.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft Theodors Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Theodor explodierte vor Energie und stürmte mit einem Kampfschrei auf die Untoten. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er zugleich blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wech-seln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in die Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die langsamen Attacken des Dritten und durchtrennte die Kehle des Vierten. So zog Theodor seine blutigen Bahnen durch die un-toten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder und Theodor verlangsamt sich auf den Takt der Realität, sanft er-wachte er aus seinem Kampfrausch bis er zitternd und keuchend in einem Haufen toten Fleisches stand.
Er musste mehrere Dutzend der Untoten erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe nie-mand mehr, der noch zu einem Atemzug in der Lage war. In einiger Entfernung stürmten vereinzelte Ghu-le vorbei zur Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte.
Eine Gruppe Überlebender hatte sich dort zu ih-rem letzten Gefecht versammelt. Sie kämpften ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Theodor hieb nach einem Ghul, der sich zu ihm umdrehte. Theo-dors Arme waren nun viel langsamer, die Sicht ver-schwommen und pulsierend von Schweiß und Er-schöpfung. Er brauchte mehrere unbeholfene Hiebe, bis die Kreatur zu Boden ging. Der sonderbare Rausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich end-gültig verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut ein-gefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Kälte, die ihn durchfuhr als hätte ihn jemand mit Eiszapfen gespickt. Er taumelte weiter, wahllos nach Ghulen stechend und mit seinen gepanzerten Handschuhen zur Seite schubsend. Als die Soldaten drei weitere Ghule erschlugen, tat sich eine Lücke in den Angrei-fern auf.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen standzuhalten, der an Heftigkeit zunahm. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen die nach ihnen greifenden Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüs-tungen bespritzte.
Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwe-rer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als Theodors Verstand den Tod akzeptiert hatte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigten Köpfen, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in den Nebel. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwun-den, brachen seine Todesschreie abrupt ab, als hätte die weiße Wand sie verschluckt. Für einen Augenblick zuckte es in Theodor seinem Kameraden nachzulau-fen, aber er unterdrückte es. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Theodors Kopfhaut zog sich zusammen und ein Kribbeln fuhr durch seinen Körper, als würde sein Fleisch unter der Haut kriechen. Vorsichtig warf er einen Blick über seine Schulter. Nur noch vier Män-ner, von beinahe hundert, waren außer ihm übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten und eingedellten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Ei-ner von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul den halben Unterschenkel herausgeris-sen hatte. Mit zusammengepressten Lippen, hielt er sich mit einer Hand an einem seiner Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt.
Die Angst lag wie eine schwere Kette auf Theo-dors Schultern und drückte ihn hinab in den Boden.
Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen. Die An-greifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte, wie das Klopfen ei-nes lebendig Vergrabenen in dessen Sarg, in Theodors Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ih-ren Mündern in die kalte Nachtluft. Ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel näherte. Eine merk-würdige schwere Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche Frieren, als ob eine unsichtbare Präsenz durch seinen Körper schneiden würde. Die Luft vi-brierte vor Anspannung und schien die Männer ersti-cken zu wollen. Theodor verstärkte den Griff um sein Schwert. Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel.
Es war der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Sir Theodor Absborgen, der die Spitze seines Schwer-tes auf die Kehle des Unbekannten richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass gräulich. Trotz seiner kurzen, schneeweißen Haare wirkte er kaum älter als Theo-dor.
Am meisten verstörten Theodor die Augen, glühende Kohlen, deren Blicke ihn durchbohrten wie Nägel. Er spürte, wie sich eine Gänsehaut über seinen Körper spannte. Erstickende Angst ergriff sein Herz mit ihrer eiskalten Hand und drohte es in ihren Klauen zu zer-quetschen, doch er blieb standhaft. Ängste waren da-zu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchstens in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch wirkte dieser keineswegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien die Waffe zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:
»Im Namen der Majestät König Cornelius Hoorn ver-hafte ich Euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann wird man Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie schmutzige Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und beweg-te sich keine Fingerbreite.
»Mensch«, die Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war ein Stich ins Herz »Glaubt Ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?«
Die Hand des Fremden schnellte nach oben und packte die Klinge. Dampf zischte unter den knochi-gen Finger hervor, die in schwarzen Klauen endeten. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spit-ze, als wäre das Schwert ein Grashalm und nicht mehrfach gefalteter, fendorranischer Stahl. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Der Fremde warf es davon.
»Ihr wisst doch nicht mal, mit wem Ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück, bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor Theodor reagieren konnte, packte der Fremde den Soldaten am Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritz-ten Knochensplitter, Hirn und Blut zwischen den untoten Finger hindurch. Es zischte laut und schwar-ze Flammen züngelten aus dem Stupf hervor. Wäh-rend der leblose Körper zu ging zerfiel er zu Asche, noch eh er ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte wie ein kleines Mäd-chen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel auf. Die Schreie verstummten schlagartig, gie-riges Schmatzen und ein verstörendes Fauchen er-setzten sie.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor. Einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte Theodor seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihm, wie zwei Fohlen hinter ihrer Mutter, drängten. Theodor würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrüh-rerisch den Kopf. Neuer wahnsinniger, leichtsinniger Mut im Angesicht des Todes, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein auf-rechter Mann, der dem Sir vor dem Namen würdig war, und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diese klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig oder einfach nur töricht, aber unter allen Umständen ein Narr. Für eure Un-höflichkeit müsste ich Euch eigentlich den Kopf ab-reißen, wenn ich auch das Pfählen bevorzuge. Ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald«
Der Namen ließ Theodor erschaudern, wie wahr-scheinlich jeden Menschen im südlichen Königreich. General Fronwald? Der aus den Legenden, der seit einem Jahrhundert tot war? Myriaden an entsetzen Gedanken schossen durch Theodors Kopf, doch aus seiner Kehle kam nur ein undeutlicher, röchelnder Laut, der bei Ignacio höhnisches Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe, hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so un-recht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der ange-brachtere wäre, genauso wie die entsprechende Hul-digung.«
Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade auch noch als Vaenyr, als ein Gott bezeichnet? Nein, das konnte nicht wahr sein.
»Nun«, fuhr der Fremde fort »wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, denn mein König duldet keine Überlebenden, auch wenn Ihr sehr unterhaltsam seid«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Finster-nis von einem König gesprochen? Hoorn war seit je-her neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über To-te, Götter und Ghule? Theodors Herz schien für ei-nen Moment auszusetzen. Bevor er seine Überlegun-gen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an, du Scheu-sal«, brüllte einer der Männer hinter Theodor.
Die beiden Männer stürmten zum Angriff vor, wäh-rend Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrte, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte: »Für Hoorn, du Bestie.«
Die Hand des Vaenyr zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian her-ausschoss. Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung durchtrennte er damit den Schaft der Axt, sodass das Blatt wirbelnd an Igna-cio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindig-keit, parierte Ignacio das Schwert des anderen Solda-ten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte.
Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit dem Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte Theodor, die Scherben der Welt durchbohrten ihn, eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Immer wieder schlug er auf dem Boden auf, wie ein flacher Stein, der über einen See springt, und die Explosion schleuderte Theodor immer weiter, bis er gegen irgendetwas Fes-tes prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass Theodor dachte, er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerungen wieder zu-sammensetzten und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesogen im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine knorrige Esche gelehnt. Seine schwar-zen Haare klebten vor Schweiz getränkt an seiner Stirn. Schmerz fraß sich durch seinen ganzen Körper. Theodor war mit einer Kruste aus verbranntem und geronnenem Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeult und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte. Aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge floss Blut über sein Ge-sicht. Theodor hatte einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zu-gleich gegen einen Würgereiz ankämpfte.
Es war beinahe still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die welken Blätter der Birken raschelten. Dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing schwer in der Luft und er glaubte von abertau-senden, schwarzen Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang Theodor sich dazu aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und der Stahl knarrte laut. Mitten in der Bewegung erstarrte er und hielt den Atem an. Das Karren schien so laut, dass er dachte es würde alle Untoten im Umkreis ei-ner Meile anziehen. Nervös ließ er seinen Blick über die Finsternis zwischen den Bäumen schweifen. Schweiß perlte an seinem Gesicht hinab. Im Schatten der Bäume glaubte er untote Gestalten zu erkennen, aber als er sich zwang nochmal hinzusehen, erkannte er im aschfahlen Mondlicht die Schemen von Bü-schen. Theodor atmete tief ein und zwang sich aufzu-stehen, wobei er bei dem lauten Ächzen des Stahls die Zähne zusammenbiss. Nichts geschah. Ohne Pferd würde zu Fuß nie noch Hoorn gelangen. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er alleine nicht rankam. Um ihn herum lagen die nun nutzlosen Teile ver-beulten Metalls. Ober- und Unterschenkelröhren, Kniekacheln, Kragen, Armgeschübe, Ellenbogenka-cheln, Panzerhandschuhe. Der Wert eines großen Bauernhofs. Theodor trug nur noch Strumpfhosen, Rock, Stiefel und seinen Rüstwams unter dem ver-beulten Brustpanzer, auf dem ein Einhorn unter einer Schicht aus Blut hervorlinste.
Jedes Geräusch, welches er verursachte, er-schien ihm unglaublich laut und nach jedem versuch-te er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von ir-gendetwas auf ihn gezogen hatte.
Doch es geschah nichts und so fasste er seinen ge-samten Mut zusammen und ging in die Richtung, in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwin-dung. Er wagte es nicht seinen Blick nach links oder rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwar-ze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs. Bei diesen Gedanken allein bekam er bereits feuchte Hände. Das Geräusch seiner Schritte schien in sei-nem Ohren ohrenbetäubend, zerrte an seinen über-spannten Nerven und trieb ihn an den Rand zum Wahnsinn.
Während er den Weg starr fixierte, kam ihm ir-gendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er entsetzt, was es war. Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jegliche Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wie-derzuerwachen, doch dies kam selten vor und Theo-dor bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war, noch als Untoter wiederauferstehen konnte.
Sogar einen Krater, den die Explosion, die Theodor weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen, konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genag-ter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten. Seine Gedanken schweiften hin und her, während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letz-ten Mondtänzen war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Mondtänze einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Aber solche Ghulepidemien hatte es in der Ge-schichte immer wieder gegeben.
Anderseits, Vaenyr und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyr, die nekromantischen Menschengötter, wa-ren, wie die meisten anderen Götter, in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der al-ten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.… Und dann, zu allem Überfluss hatte sich dieser Gott der Finsternis als Ignacio Fronwald bezeichnet.
Theodor konnte sich noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grau-samen und jungen General Fronwald, der seine Fein-de bei lebendigen Leib pfählen ließ und auch vor Frauen und Kindern nicht Halt machte. Als eine Ghulepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahren auslöschte, entsandte ihn der König dorthin, um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn, besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen nieder-zumetzeln und zu verbrennen und gleichzeitig zu lachen. Er kehrte niemals zurück. Die ganze Armee verschwand spurlos, lediglich die verkohlten Ruinen Rosenthals blieben zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vo-rausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offen-kundig nicht war. Er war ein Gott geworden, aber wie? Theodors Gedanken kreisten wild und irgend-wann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte, wahr sein konnte oder ob er dem Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch eine dunkle, gepflasterte Straße nach Hoorn, welches über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die zyk-lopische Mauer, und tausende Schießscharten blick-ten auf ihn hinab, wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihm griffen und er erwachte aus seinem tranceartigen Zustand. Sein Herz schlug wie ein Schmiedehammer.
Den Rest des Weges rannte er. Alles schien nach ihm zu greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schwe-ren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie. Seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Sumpfwald, über die Große Brücke, die über den Vyl führte. Der Vyl war der größte Fluss Hoorns, der sich durch das ganze Königreich zog und es in die matschige Sumpflandschaft verwandelte. Vor der Stadt gabelte sich der Fluss und bildete so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser.
Als Theodor das große Stadttor erreichte, häm-merte er wild dagegen. Das Tor war riesig und halb so dick, wie ein Mann hoch. Die ganze Stadt Hoorn war die größte Festung der bekannten Welt.
Aus den Schießscharten über ihm riefen Soldaten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Theodor schrie bis seine Lungen fast versagten, dass er ein hoher Ritter sei, der Sohn des Grafen von Abs-borgen, und er würde wichtige Kunde für den König bringen. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen. Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Er torkelte erleichtert aus den Schrecken der Nacht in das helle Licht der Kerzen und Fackeln im Inneren der Mauer. Ihn erwartete ein grimmiger Komman-dant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten im Schlepptau, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn ge-richtet, dennoch musste Theodor grinsen. Menschen, lebende Menschen. Er hatte es geschafft. Die Männer um ihn herum warfen Theodor misstrauische Blicke zu und das Grinsen auf seinem Gesicht verstand. Er sah an sich hinab. Getrocknetes Blut rieselte von sei-ner Kleidung und floss über sein Gesicht hinab zum Hals, wo sich der Rand des Wamses vollsog. Darüber war der zerbeulte und blutbefleckte Brustharnisch auf dem vage ein schwarzes Einhorn zu erkennen war. »Wer seid Ihr und was wollt Ihr zu dieser späten Stunde? Was ist mit Euch passiert?«, fragte der Kom-mandant.
Nur durch viele vage Erklärungen und dem Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust, konnte Theo-dor die Männer letztendlich von seiner Identität über-zeugen. Er zitterte und wich den Fragen über die Ur-sachen seines Zustands aus. Er bat darum, dass man ihn sofort zum König brachte, wenn er auch nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstvorschriften der Mauer vorsahen.
Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern, wie er in das Gästezimmer in der Riesenfes-te, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, ge-kommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die, selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten, Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zum Schöpfer, welcher die Welt erschaffen hatte, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen be-leuchtet und schön anzusehen.
Hoorn war das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelsbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber keine Augen. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er dem König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihm Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Mor-gen näher als dem Abend war, nicht mehr zu spre-chen. Man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Es beruhigte Theodor nicht sofort zum König zu müssen und diese Pflicht etwas hinauszuzögern, aber es hielt ihn nicht davon ab weiter zu grübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zu-rück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blut-vergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um Theodor zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum. Seine Eingeweide waren kalt und verknotet. Bei der kleinsten hektischen Bewe-gung um ihn herum zuckte er zusammen.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, namens Gaius Camo, der die ganze Zeit lächelte, wusch Theodors Verletzung am Kopf aus und nähte sie mit einer heißen Nadel zu. Theodor war zu erschöpft, um vor Schmerzen zu schreien und ließ alles über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihm noch einen Aufguss aus beru-higenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu le-gen und die Wunde nicht zu berühren, dann verab-schiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und wäh-rend die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersal-ben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen eine Zeit lang einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein brin-gen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu erträn-ken, um die quälenden Erinnerungen im Rausch zu vergessen, war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starr-te, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hat-te.
Angewidert schüttete er den Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher be-schloss er, wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vor-hänge in sein Zimmer.
Theodor fand keinen Schlaf. Wann immer er sei-ne Augen schloss, sah er die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todes-schreie der Männer; sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervor-quoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen. Er erinnerte sich an den rätselhaften Blut-rausch, der ihn gepackt hatte, aber so musste es sich wohl anfühlen, wenn man in einem Kampf versank. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben ge-schlagen hatte und gräulicher als alles, was er zuvor erlebt hatte. Jahrelanges Training, Turniere, Duelle und Buhurte mit stumpfen Schwertern hatten ihn für den Kampf ausgebildet, aber nicht dafür vorbereitet. Er hatte überlebt, aber zu welchem Preis?
Wie viele Untote hatte er erschlagen? Er wuss-te es nicht, aber dabei waren sie alle einst Menschen gewesen. Das Gesicht des Jungen, in dem sein Schwert stecken geblieben war, erschien ihm vor sei-nen inneren Augen. Theodor fühlte sich dreckig.
All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch mit dem jugendli-chen Übermut, der einen glauben lässt man wäre un-besiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Sol-daten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyr und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit sei-nem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen, aber auch ein schwer-mütiger Seufzer drang. Er dachte an seine Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets geschimpft hatte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ih-ren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinne-rungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stie-gen ihm in die Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel be-schützen, wenn nicht mal hundert der besten Solda-ten der Armee es schafften. Wie konnte er sie be-schützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Dienern Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen, um seine Familie zu warnen. Er brach nach wenigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Alb-traum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träu-men schreien und erwachte schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwachen kam niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Theodors ganzer Körper ver-krampfte sich und er rollte sich auf dem Bett zusam-men wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung gewann und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 2 von 2 |
Gehe zu Seite 1, 2 |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
| Empfehlung | Empfehlung | Buch | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Buch |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






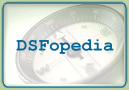





 Login
Login







