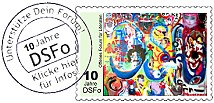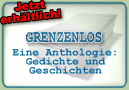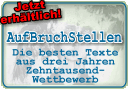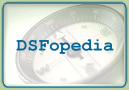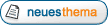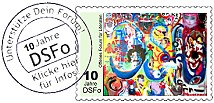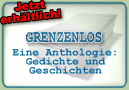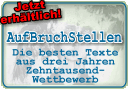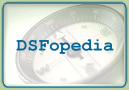Willi Wamser
Gänsefüßchen

Beiträge: 47
|
  04.01.2019 14:08 04.01.2019 14:08
Dem Himmel so nah: Spirituelles im Leistungskurs Deutsch
von Willi Wamser
|
   |
|
Gott und der Teufel schauten wieder einmal auf die Erde,
als Gott den Teufel plötzlich anstieß und, auf einen jungen Mann deutend, sagte:
„Jetzt schau dir mal diese Ratte da an!“
Robert Gernhardt: Das Buch Ewald.
Dem Himmel so nah: Spirituelles im Leistungskurs Deutsch

Gott und Teufel sowie der schwäbische Dichter Friedrich Schiller hatten wieder einmal mehrere Flaschen roten und weißen Weines getrunken und starrten auf die Erde, als Gott den Teufel anstieß und – auf einen Mann namens W. deutend – sagte: „Jetzt schau dir mal diesen Dödel mit seinem weiß lackierten Türblatt auf den zwei Trägerböcken an!“
„Dödel? Nu na na ...“, antwortete der Teufel leise korrigierend. Leise, da er des Herren Zorn nicht durch direkten Widerspruch entfachen wollte. Korrigierend, da er den älteren Mann da unten kannte, einen Pädagogen, der sich selbst als begnadet ansah und es wohl auch war, ihn für geistig einigermaßen beweglich, wenn auch für etwas verschroben hielt.
Und das alles nicht zu Unrecht, da sich W. mit anspruchsvoller, leicht verstiegen wirkender Lektüre abgab, die man Schülern kaum zumuten, aber doch mit Geist und einigem Einsatz von Energie zu vermitteln vermochte. Und immer wieder befasste sich dieser W. auch mit Entlegenem. So auch jetzt gerade: Das Alte Testament, das Buch der Weisheit, war aufgeschlagen. Und W. sann über die Stelle 2,1ff nach: „... gewesen. Der Atem in unserer Nase ist Rauch, und das Denken ist ein Funke, der vom Schlag des Herzens entfacht wird; verlöscht er, dann zerfällt der Leib zu Asche, und der Geist verweht wie dünne Luft. ... Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es uns zusteht. Erlesener Wein und Salböl sollen uns reichlich fließen, keine Blume des Frühlings darf uns entgehen. Bekränzen wir uns mit Rosen, ehe sie verwelken; keine Wiese bleibe unberührt von unseren ausgelassenen Spielen. Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen; das ist unser Anteil, das fällt uns zu ...“
„Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen; das ist unser Anteil, das fällt uns zu ...“, murmelte W. und fand dann in seinem Bewusstsein gewisse Erinnerungsspuren und Vernetzungen. Bert Brechts „Hauspostille“, speziell das „Lied vom Rauch“, es bezog sich doch auf diese Stelle des Alten Testamentes? Und hatte Schiller, dessen Maria Stuart und dessen ästhetisch-poetologische Theorie im LK zu behandeln war, nicht eine interessante Spieltheorie aufgestellt? W. entnahm seinem Karteikasten eine Karte zu Schillers Schrift „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ und prüfte deren Inhalt:
Von 1793 bis 1795 schrieb Friedrich Schiller seine Briefe "Über die ästhetische Erziehung des Menschen“. Kunst ist die Ausformung des Spieltriebs, ein probierendes Handeln, das zu voller Humanität führt: „.... um es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt ...“
Schiller sah das mit einem gewissen Entzücken und begann zu schwäbeln: „Ganz gwiess isch des koi Dödel neta“, verstummte dann aber, da nun alles danach aussah, als ob sich hier gleich jemand daran machen würde, seine – Schillers – Spieltheorie, planvoll in die Praxis umzusetzen, in die Schulpraxis jedenfalls. Es wurde interessant. Man würde, man musste diese sich anbahnende Entwicklung beobachten, unbedingt. Und Gott der Herr schmunzelte, denn ihm machte es Spaß zu spielen und er wollte seinen Knecht W. in diesem Sinne inspirieren. Und hatte er nicht auch Schillern seinerzeit die Spieltheorie eingegeben?
Und so kam es, dass der Lehrer, der gerade über den Lexemen „Spiele“, „erlesener Wein“ und „Salböl“ brütete, zuerst von ferne, dann aus unmittelbarer Nähe die Stimme des Herrn vernahm, im Stil und Rhythmus der Sprüche der Weisheit, vorerst noch leise. Versonnen strich sich der Pädagoge über seinen schütteren Schädel, setzte sich in seinem riesigen Arbeitszimmer an den dritten seiner drei Schreibtische – ein weiß lackiertes Türblatt, auf zwei Böcke gelegt – das war ihm Weltbühne und Einfallspforte für Inspiration; – und der Herr redete da zu ihm.
Andächtig und freudig zugleich begann unser Pädagoge schwungvoll des Herren Worte – gedankliche Blitze, Gesetze, Regeln – schriftlich zu fixieren. Wie leicht glitt da die inspirierte Feder übers Blatt! Und siehe – zweiundzwanzig Sprüche der Weisheit lagen nach einiger Zeit vor ihm frisch auf dem Tisch.
Oben im Himmel lehnte sich der Herr zufrieden zurück: „Na, der Text steht. Jawoll. Ist ein guter Text mit zweiundzwanzig Regeln. Da steckt viel drin, Friedrich! Du auch ein bisschen, mit deiner großen Spieltheorie, guck mal, sogar dein Hinweis auf mich in deinem „Kabale und Liebe“, ich sei der „Vater der Liebenden“, findet sich in der Regel 17. Wirst es sehen, das grätscht rein in den Schultrott. Wirst es sehen, Mittwoch 2. und 3. Stunde, Leistungskurs Deutsch, Zimmer 120, erster Beleg, wie das wirkt.“ “Ich weiss net“, meinte Mephisto vorsichtig, „ob des wirklich reingrätscht.“
*
Am Mittwoch um 8.45 begann im LK Deutsch traditionsgemäß die Doppelstunde. Gott, Mephisto und Schiller saßen beisammen und freuten sich des Anblicks da unten: Heute gab es neun – Daniel fehlte nämlich –proppere, wissensdurstige Kollegiaten zu sehen, zu hören war die Kaffeemaschine, sie schnurrte und gluckste behaglich, in Gang gesetzt von Martina und Andrea. Andrea wusste noch nicht recht, was sie studieren wollte. Und Martina dachte mit einem gewissen Grauen an die zwei Wochen, welche W. dem Motiv des Chinesen in Fontanes Roman „Effi Briest“ gewidmet hatte, bis man sich endlich vor drei Tagen an den Durchzieher „Lyrik und Literaturgeschichte“ machte, zwar ein recht trockenes Feld, aber eben immer noch besser als diese chinesenhaltige Wüste in Kessin. Doch jetzt war Kaffeepause, anheimelnd und vertraut das alles. Der Overheadprojektor, er bekam seine Folie, wurde angeschaltet, das entsprechende Blatt ausgeteilt, alles noch geläufige Routine. Die Kollegiaten setzten die Tassen ab, hielten ihre spitzen Bleistifte für die Textarbeit bereit und Regina trieb in ihrem japanisch-deutschen rot-schwarzen Druckbleistift, der ihr über das Abitur hinaus gute Dienste leisten sollte, die Mine um einen Millimeter nach vorne ....
Aber im hellen Licht des Projektors sah man nicht wie noch am Dienstag den gewohnten lyrischen Text mit Zeilenzählung im Fünfer-Intervall, sondern zweiundzwanzig durchnummerierte optisch-graphische Sinnabschnitte, und in die Stille hinein bat Herr W. die Kollegiatin Martina, den Text vorzulesen. Folgendes war nun zu hören, das wir nur in Ausschnitten wiedergeben wollen, um den geneigten Leser nicht zu ermüden und geneigt zu halten.
Zweiundzwanzig Regeln für ein glückliches Leben in der Schulfamilie
1. Tja, ich bin, der ich bin, dein HErr. Du aber höre, denn du bist mein Knecht.….
7. Signalisiere, dass eine Konversation ausgeklungen ist, indem du die Hände über die Ohren legst und die Augen schließest.……
17. Du sollst die Mitkollegiaten und die Lehrer fragen, welchen Geschlechtes sie seien und sie zur Liebe ermahnen. Denn ist nicht Gott der Vater der Liebenden? So sagt Luise Millerin im ersten Akt von Schillers „Kabale und Liebe“. ....
22. Kopiere diese Regeln im ersten Stock des Paul Klee Gymnasiums für deine Mitkollegiaten und die Schüler der Oberstufe, lege sie in den entsprechenden Klassenzimmern aus.
*
Der Lehrer atmete tief aus – desgleichen tat auch Gott im Himmel – und blickte freudig in die Runde, auf erste positive Rückmeldungen wartend. „Tja“, sagte Martina, „scho luschtig! Und die zwei Großbuchstaben beim Lexem ´HErr´ in Regel 1, die sind wohl Absicht, drücken vermutlich aus, dass hier eine Autorität spricht.“ Gott im Himmel nickte wohlgefällig.
„Gott im Himmel! Zehn Zentimeter und ein neues Blatt mit den 22 Regeln dazu“, seufzte Andrea und blickte auf das Papier vor sich, im Geiste den Stapel selbstgefertigter (vom Lehrer selbst gefertigter) und gelochter früherer Arbeitsblätter vermessend. Diese wiesen zwar inhaltlich eine gewisse Systematik auf, doch war diese nicht imstande, das Gesetz des Zufalls zu brechen, von dem sich etwa die Kollegiatin Elisabeth leiten ließ, soweit sie die Kopien in ihrer Klemm-Mappe zu verwahren suchte. Eine Quelle des Frustes für unseren Pädagogen, deren Sprudeln er seit einiger Zeit erfolgreich zu überhören wusste. Gott harrte weiterer Wortmeldungen oder stiller Gedanken.
“Warum des jetzt noch kopieren?“, sagte Anita, wobei sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die Regel 22 zeigte und mit dem Handballen der linken gespreizten Hand zweimal auf das vor ihr liegende Blatt klopfte. „Außerdem geht der Kopierer im ersten Stock net. Der Stefan hat ihn ruiniert mit seinen Liedtexten für die Mulis.“ Des Pädagogen Mundwinkel zuckten, doch hielt er sich zurück, Gott ebenfalls.
Stefan wandte das Gesicht von der Sprecherin ab, er suchte instinktiv Blickkontakt zu Daniel, weil der sich immer wieder über die Weiber in diesem Kurs echauffierte und sich darin mit Stefan traf, aber Daniel fehlte, wie schon erwähnt, heute gänzlich. Er saß, wie Gott mit einem schnellen Blick sah, über seiner kreativ orientierten Facharbeit, einer Kriminalstückparodie, und musterte mit Inspektor Murphy und seinem Assistent Greenear Die Leiche im Dom. Später wollte er seine Rolle im Schulmusical als Seymour im „Kleinen Horrorladen“ memorieren. Kurzum: Es fehlte für Stefan der geeignete Gesprächspartner und Blickewerfer stillen Einvernehmens und so sagte er gar nichts.
Barbara schwieg ebenfalls, hielt aber ausdrucksvoll den klugen Kopf um 15 Grad geneigt wie ein edler Sittich. Regina sagte nichts und malte mit ihrem spitzen, rot-schwarzen Druckbleistift japanisch-deutscher Herkunft aenigmatische Zeichen auf ihr Papier. Sie überdachte wohl die Absurdität von Ionescos Unterrichtsfarce in Frau H.s (Französisch, Deutsch) Inszenierung, wo Regina in der Schülerin-Rolle die blonden Zöpfe einer Perücke schüttelte. Auch ringelte sie ein Agens-Sem-haltiges Lexem in Regel 1 ein. Eher beiläufig. Das da vor ihr, das war nix.
Die vor Regina sitzende Elisabeth sagte auch nichts, immerhin aber spitzte sie die Lippen und blies auf ihr Handgelenk. Dann gähnte sie, wobei sie die Hand mit leichter Verzögerung vor den Mund hielt. Sie hatte ein seltsames Thema gewählt für ihre Facharbeit: „Stilkritik im Zeitalter des Internets“. Einen wortgewaltigen Schreiber und seine Kommentare hatte ihr W. nahegelegt zu lesen und zu analysieren: …. das Collagieren von Sinneseindrücken Dritter, das Nachsummen längst Vergess'nens und das Hervorkramen von Schnipseln bibliophiler Vergangenheiten, das dröge Bröseln altbackener Mümmelprosa sind nur sehr schwer mit dem Personal Standing eines Autors so in Einklang zu bringen, dass ein Publikum in Ekstase fällt, zu tanzen beginnt und Reiskörner durch den Saal wirft...
Stumm saß Bettina da und sann über zwei Bekanntschaftsanzeigen nach, die in ihrer Facharbeit „Kontaktsuche im Zeitalter der Medien“ keinen Platz gefunden hatten. Sehr poetisch die erste Annonce: mirabellen konserviert im glas, jedoch / noch eigens mit dem stein versehen, von dem / die zunge zögerlich den dünnen fetzen // fruchtfleisch löstSehr viel aggressiver in Sprache und härter in der Fügung die zweite Annonce:O Liebe! Tritt mir doch die Türe ein, /schlag zu und lass den Himmel rein. Beide Liebesrufe hatten schon ganz schön Drive. Ganz anders als diese spillerigen zweiundzwanzig Regeln.
In der ersten Reihe saß Sabine und sagte nichts, denn es galt einem Gähnreiz Genüge zu tun, den Elisabeths Gähnen ausgelöst hatte. Dann wurde Sabine zusätzlich von einem Keckerreiz gepackt, als sie ihr entspannter Gaumen unwillkürlich daran erinnerte, wie sie im Kurse auf Zuruf dreimal Verse laut zu lesen versuchte, aber bei Jambus, Trochäus und spondeusnahen Passagen (Hebungsprall) dermaßen stolperte – Dumpa Dumpa Dump Dump – , dass die Mitkollegiaten fast von den Stühlen kippten und winselnd auf dem Boden keuchten (Konjunktiv II); – „Ach du große Schei ...“ hatte sie damals fazitartig gerufen. Jetzt aber wollte keine rechte Stimmung aufkommen , Indifferenz – es war nicht zu leugnen – hatte sich ausgebreitet im Raume 120 und war selbst im Himmel zu bemerken.
*
Auch Gott spürte die flaue Stimmung und wollte schon laut werden: Keine Vibrationen bei diesen räudigen Rezipienten, so dachte er. Bodenschwere Hohlköppe, die nicht huppen wollten oder konnten oder beides. Irgendwie ohne Pepp, so gar nicht nach seinem Bilde. Ließen seinen Text einfach abtroppen. Man sollte ihnen die Schuhe aufblasen, anpicksen und sie dann zur Hölle schicken. Aber bevor er laut werden konnte, nahm der Teufel geschmeidig-flapsig das Wort, weil er so den Unmut seines Gegenübers zu dämpfen können glaubte „Na, Cheffe, so schlimm ist es nicht. Oder? Was sollten sie denn schon anderes sagen oder machen, die acht Damen und der junge, knorrig-grätige Mann mit den Rasta-Locken? Sie sind es gewöhnt zu analysieren. Und Botschaften gleich umzusetzen, das geht nicht bei Heranwachsenden. Und auch deine Propheten waren nicht von Anfang an begeistert, wenn sie deine Aufträge vernahmen. Denk nur an Jonas, der in Ninive predigen sollte.“ Da Gott nur unwillig brummte und „Rasta-Locken“ zu „Dread-Locks“ korrigierte, sagte Mephisto nichts mehr weiter, sondern schaute auf Schillern, dessen Urteil und diplomatische Art er zu schätzen gelernt hatte. Auch Gott lauschte, was Schiller sagen würde, was man allerdings nur bei sehr genauem Hinsehen merkte, da er uninteressiert tat und seine Fingernägel betrachtete. Genauer und ohne Umschweife gesagt: | |