  |
|
| Autor |
Nachricht |
Rosenmond
 Schneckenpost Schneckenpost

Alter: 39
Beiträge: 12
|
  10.01.2015 20:33 10.01.2015 20:33
Maikäfer
von Rosenmond
|
   |
|
|
Neue Version »
Hallo zusammen,
ich hätte gern eure Meinung zu einer Herzensangelegenheit gehört:
Vor knapp 5 Jahren haben mein Mann und ich adoptiert. Unser Weg war nicht nur abenteuerlich, sondern auch ungewöhnlich in vielerlei Hinsicht. Wir waren beispielsweise beide Studenten (25 und 27) und weit davon entfernt, finanziell abgesichert zu sein.
Unsere Geschichte möchte ich gern aufschreiben und sobald ich das Geld für den Druck zusammen habe, den Jugendämtern für ihre Adoptionsbewerber kostenlos zur Verfügung stellen.
Es soll kein Ratgeber werden, sondern eher eine biografische Geschichte, die (idealerweise) Spaß beim Lesen und Mut macht.
Der Anfang ist geschrieben und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen.
Kapitel 1
"Jetzt fahr doch mal wie ein normaler Mensch", blaffte mich Jan vom Beifahrersitz aus an und hielt sich demonstrativ am Griff über der Autotür fest.
"Was denn?", fauchte ich genervt zurück.
"Nele, wenn du blinkst, musst du auch irgendwann rüberfahren."
"Das weiß ich. Aber wenn von hinten was kommt, kann ich schlecht die Spur wechseln."
"Meine Fresse, die Lücke ist mindestens einen Kilometer lang. Fahr doch einfach."
Es reichte. Das Maß war voll. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich überlegte kurz, einfach anzuhalten und auszusteigen. Allerdings war die Realisierung dieses Gedankens, mitten auf der Autobahn bei 130 km/h, keine echte Option. Meinen Beifahrer bei voller Fahrt aus meinem kleinen, schwarzen Twingo zu schupsen, war auch keine Alternative. Hauptsächlich weil es zu viel Kraft und mehr als zwei Hände erforderte, ihn abzuschnallen, die Beifahrertür zu öffnen und ihm einen Tritt zu verpassen. Also entschied ich mich für eine verbalen Ausfallschritt: "Ich hasse dich. Kannst du nicht ein einziges Mal die Klappe halten, wenn ich fahre? Du wolltest dich doch nicht ans Steuer setzen, weil du zu aufgeregt bist. Aber schön, dass du in jeder Lebenslange genug Gründe findest, mich vollzumotzen. Verdammt, du bist so ein Arschloch und ich weiß echt nicht, wieso ich dich geheiratet habe." Zugegeben, ich war noch nie der Wesens-Typ "zartes Gänseblümchen", eher eine diplomatische Kreuzung aus Vergissmeinnicht und Kaktus. Doch erst seit ich mit Jan zusammen war, kannte ich den Aggro-Stech-Modus. Dieser ließ mich nun in Kombination mit einem Tränenschleier vor den Augen halb erblinden, was mich jedoch nicht daran hinderte, von der mittleren auf die linke Spur zu ziehen. Für Schulterblick, Kontrolle im Rückspiegel oder andere Unfallpräventionen war im besagten Wut-Modus kein Platz. Dass der nachfolgende Verkehr so dicht wie der boreale Nadelwald war, entzog sich meiner Wahrnehmung ebenfalls.
Erst als der Passatfahrer hinter mir die Lichthupe zum Glühen brachte und mir Jan ein "Pass auf!" ins Ohr brüllte, realisierte ich, dass sich Ehestreit und Autobahnfahrten nicht wirklich gut taten. Mit dieser Erkenntnis steuerte ich den nächsten Parkplatz an.
Ohne weitere Zwischenfälle brachte ich den Twingo zum Stehen, stieg kommentarlos aus, schmiss die Autotür hinter mir zu und suchte mit dem Rücken an selbiger Halt. Ich vergrub das Gesicht in meinen Händen und schluchzte leise vor mich hin.
Jan hatte das Auto inzwischen ebenfalls verlassen. Er stand jetzt vor mir und nahm mich ungefragt in den Arm. "Ach, komm her Püppi", flüsterte er versöhnlich.
"Warum bist du denn so ein blöder Arsch?", fragte ich dumpf gegen seine Brust und unterstrich meine Aussage mit einem Seufzer.
"Weil ich nun mal nicht jeden Tag 500 Kilometer fahre, um meinen eventuellen zukünftigen Sohn zu besuchen."
Ja, da hatte er Recht. Wir waren auf dem Weg zu unserem eventuell zukünftigen Kind - ein knapp zwei Monate alter Junge namens Jonathan.
Erst vier Wochen war es her, dass wir unseren "Hallo wir sind Nele und Jan und möchten gern Adoptiveltern werden"-Termin beim Jugendamt hatten.
Es kam mir vor, als hätte ich erst gestern beim Betreten des Jungendamtes zu Jan gesagt: "Scheiße, ich habe keine blickdichten Strumpfhosen angezogen. Jetzt sieht die, dass ich tätowiert bin und dann bin ich gleich unten durch."
"Wenn man hier auf Basis von Klischees entscheidet, haben wir sowieso keine Chance", lachte Jan und krempelte gleichzeitig seine Hemdärmel nach oben, wobei sein tätowierter Unterarm zum Vorschein kam.
Dieser Mann brachte es regelmäßig fertig, meinen inneren Hulk zu wecken, aber wenn es darauf ankam, schaffte er es immer, mich zu erden.
Für das erste Adoptionsgespräch beim Jugendamt hatten wir, bis auf die Terminvereinbarung, keine Vorbereitungen getroffen. Was hätte das auch gebracht? Wir wussten, warum wir adoptieren wollten und stellten uns auf drei bis fünf Jahre Wartezeit ein.
Hätten wir uns bereits im Vorfeld umfassend über das bevorstehende Gespräch und den anschließend Prozess informiert, wären wir an diesem Tag vielleicht nicht wir gewesen: Ich hätte penibel auf die blickdichten Strumpfhosen geachtet, hätte jede Antwort sorgfältig abgewogen und Jan bei jeder zu ehrlichen Aussage unter dem Tisch ein blaues Schienbein verpasst. Wir hätten womöglich nicht offenherzig gesagt, dass wir einem Kind kein Leben in Wohlstand und finanziellen Reichtum bieten können, dass wir als Paar manchmal schwer zu ertragen sind und dass wir unser Leben als Einzelpersonen nicht komplett aufgeben wollen. Frau Wiegandt, die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes (Sozialarbeiterin?), hätte dann wahrscheinlich auch den wunderbaren kleinen Jungen nicht erwähnt, für den sie noch kein Zuhause gefunden hatte und der uns nur 27 Tage später auf den Autobahnparkplatz führte.
"Komm, ich fahre die letzten 150 Kilometer nach Mannheim. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an die Gurgel springen wenigstens ein bisschen", sagte Jan lächelnd, während er mich noch immer im Arm hielt.
Ich nickte und löste endlich meine Stirn von seiner Brust. Mit dem Handrücken wischte ich mir die letzten Tränen aus dem Gesicht, lief einmal ums Auto und nahm mit einem Seufzer auf dem Beifahrersitz Platz. Jan stieg ebenfalls ins Auto und wir setzen unsere außergewöhnliche Reise fort.
Kurz nach 13.00 Uhr erreichten wir das Universitätsklinikum Mannheim. Zu diesem Zeitpunkt lag mein Ruhepuls gefühlt bei 120. Gut organisiert, wie wir ausnahmsweise waren, hatten wir Wechselklamotten dabei. Die Sommerhitze, eine 5-Stunden-Autofahrt und die innere Ruhe eines brodelnden Vulkans hatten uns nicht mehr so ganz taufrisch aussehen lassen. Da wir jedoch nicht den Eindruck erwecken wollten, als seien wir zu unserem Termin gejoggt, schlüpften wir also noch im Parkhaus in unsere Vorzeigeoutfits.
Wenige Minuten später standen wir nicht nur im Eingangsbereich der Klinik, sondern am Beginn des größten Abenteuers unseres Lebens.
Das Krankenhaus in Mannheim kam mir riesig vor. Erst 30 Minuten und drei Orientierungsgespräche mit dem Klinikpersonal später erreichten wir die Station 28-4, die Neonatologie. Hier wird das Leben noch während seiner ersten Züge auf eine harte Probe gestellt. Gegen alle Widrigkeiten retten die Ärzte und Schwestern an diesem Ort nicht einfach nur Leben, sie schenken das erste Lächeln, die erste Liebe und all die wunderbaren Dinge, die die Welt für jeden bereit hält.
Um den kleinen Patienten und ihren Angehörigen zu etwas Ruhe und dem Gefühl von Geborgenheit zu verhelfen, war die Station natürlich nicht für jeden zugänglich. Wir standen also vor verschlossenen Türen und mussten uns über eine Gegensprechanlage anmelden. Frau Wiegandt hatte unseren Besuch bereits beim Team der Neonatologie angekündigt und man bat uns, im Elternzimmer zu warten. Auf ungefähr acht Quadratmetern fanden eine kleine Sitzecke mit Tisch sowie eine Stuhlreihe Platz. Dazwischen wies ein Fenster dem Sonnenlicht seinen Weg in den Raum, der seine Besucher mit unendlichem Glück empfing. Es strahlte von den Wänden, an denen dutzende Familienfotos ehemaliger, kleiner Patienten hingen. Auf jedem einzelnen Bild war Dankbarkeit für das Wunder zu erkennen, dass die Mitarbeiter der Station vollbracht hatten. Zu etlichen Fotos gab es auch Briefe, von denen ich mir einige durchlas. Manche Eltern schickten lediglich Grüße, andere berichteten, wie ihr kleines Wunder in den vergangenen Jahren gewachsen war und wieder andere erzählten wie das Schicksal sie in die Neonatologie nach Mannheim brachte, wo ihnen die Ärzte und Schwestern Hoffnung und Kraft gaben - etwas, wofür sie ewig dankbar sein werden.
Mit jedem Wort, das ich las wurde der Kloß in meinem Hals größer. Wie schafften es all diese Familien nur, das beste aus ihrer Situation zu machen? Woher nahmen Sie die Energie dafür?
Angesichts dieser bewegenden Geschichten kam mir das, was vor uns lag so unfassbar groß und schrecklich beängstigend vor.
Meine Augen wanderten weiter von einem Foto zum nächsten während ich auf einem Stuhl Platz nahm. Auf dem Tisch vor mir standen Gläser und Wasserflaschen. Geistesabwesend und immer noch die Bilder im Blick goss ich mir einen Schluck Wasser ein. Was tat ich hier eigentlich? War ich denn überhaupt mit 25 Jahren schon erwachsen genug dafür? Was wenn ich mich nicht in den kleinen Jonathan verlieben oder wenn er kein Band zu mir knüpfen würde? Wenn ich einfach meinen Mama-Modus nicht aktivieren kann? Wenn er nie wieder richtig gesund wird und ich damit nicht umgehen kann? Oder schlichtweg alles total schief geht?
Ich hatte also eine leichte Panikattacke, in der ich mir wünschte irgendeine dieser albernen aber beruhigenden Atemtechniken zu beherrschen.
Jan war mir leider auch keine große Hilfe, weil es ihm ähnlich ging. Er stand abwechselnd auf, drehte eine Runde in dem Raum, murmelte etwas von "Mir ist so schlecht." und setzte sich anschließend auf einen anderen Stuhl, um eine Minute später erneut aufzustehen. Er erinnerte mich irgendwie an Dumbo, kurz vor seinem ersten Flug. Ich konnte seinen inneren Kampf förmlich hören:
"Ich schaffe das. Oh Gott, nein, ich kann nicht. Aber ich werde es hinbekommen. Verdammt, das funktioniert doch nie. Nein, ich tue es einfach."
Wären meine Gedanken und Emotionen nicht im Schleudergang unterwegs, hätte ich herzlich über den Anblick von Jan gelacht. Stattdessen ging ich zu ihm, nahm seine Hand und sagte mit aller Überzeugungskraft, die ich in diesem Moment zusammenkratzen konnte:
"Wir werden das schon schaffen."
Er antwortete mit einem Lächeln.
Es war inzwischen etwa eine halbe Stunde vergangen als eine junge, hübsche Ärztin das Zimmer betrat.
"Herr und Frau Winter?", fragte sie freundlich.
Wir nickten gleichzeitig.
"Schön. Wir freuen uns alle sehr über Ihren Besuch. Kommen Sie mit. Ich stelle Ihnen Jonathan, den kleinen Sonnenschein der Station, mal vor", fuhr sie fort und forderte uns mit einer Handbewegung auf, ihr zu folgen. Obwohl ich das Gefühl hatte, mein gesamter Körper würde ausschließlich aus Wackelpudding bestehen, setzte ich einen Fuß vor den anderen. Mit der Anmut eines Nussknackers versuchte ich möglichst gelassen zu wirken und meine Unsicherheit wegzulächeln. Vermutlich hatte ich dabei nur geringen bis gar keinen Erfolg.
Und dann standen wir plötzlich in der Tür, nur wenige Schritte von Jonathans Bett entfernt. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich die Türschwelle des Raumes überschritt.
"Bitte waschen und desinfizieren Sie sich die Hände", bat uns die Ärztin und wies auf das Waschbecken, gleich neben der Tür. Jan war schon damit fertig, bevor sie die Aufforderung beendet hatte. Als gelernter Kinderkrankenpfleger musste ihn keiner auf den richtigen Umgang mit kleinen Patienten hinweisen. Ich war hingegen schon bei dieser Sache überfordert, was Jan nicht entging: "Nicht nur die Hände waschen. Auch den ganzen Unterarm. Dann abtrocken und mit dem Ellenbogen kannst du anschließend den Desinfektions-Spender bedienen."
Dankbar befolgte ich seine Anweisungen, war aber nicht ansatzweise in der Lage auch nur ein Wort zu sagen. Als ich fertig war, drehte ich mich um und ging zu Jonathan. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich weder die freundliche, helle Atmosphäre des großes Zimmers war, noch die drei anderen Bettchen und schon gar nicht die vielen gespannten Augenpaare der anwesenden Krankenschwestern.
Jonathans kleiner Körper war umgeben von orangenen Gitterstäben. Er lag auf einem blauen, mit Elefanten gemusterten Bettlaken. Am Kopfende bündelten sich neben zwei Kuscheltieren große und kleine Schläuchen zu einem wirren Knäuel. Es half ihm beim Atmen und versorgte ihn mit Nahrung sowie Medikamenten. Monitore und jede Menge Gerätschaften standen um ihn herum, als würden sie über seinen Schlaf wachen.
All das registrierte ich bei unserer ersten Begegnung ebenfalls nur ganz beiläufig, denn mein ganzes Universum drehte sich in diesem Moment nur um Jonathan. Langsam schob ich meine Hand durch die Gitterstäbe und legte sie auf seinen Arm. Er fühlte sich unglaublich zart und weich an. Für den Bruchteil einer Sekunde flammte unbändiges Mitleid in mir auf und noch im selben Atemzug ärgerte ich mich über dieses Gefühl, denn so wollte ich ihm nicht gegenübertreten.
Ich versuchte mich zu sammeln und schaute das kleine Bündel vor mir ganz genau an. An den Füßchen war ein Sensor befestigt und in der Leiste hatte man einen Zugang gelegt. Durch sein linkes Nasenloch führte eine Magensonde, deren Schlauch mit einem großen Herzchen-Pflaster auf seiner Wange festgeklebt war. Ein anderer Schlauch in seinem rechten Nasenloch ermöglichte ihm das Atmen. Abgesehen vom medizinischen Kabelsalat, sah Jonathan eigentlich gar nicht krank aus. Er hatte diesen typischen gesunden Babyspeck, der bei Babys sowie Kleinkindern vor allem fremde Senioren anlockte, um in eben diesen voller Begeisterung zu kneifen und zu knuffen.
Während ich ihn mir so ansah, überlegte ich, was ich über ihn wusste. Frau Wiegandt hatte uns zwar bereits eine kurze Zusammenfassung zukommen lassen, deren medizinisches Fachchinesisch mir Jan auch übersetzte, aber jetzt, an diesem orangefarbenen Bettchen, hatte ich einfach alles vergessen. Das Einzige, an das ich mich in diesem Moment erinnern konnte, war sein Geburtstag: der 1. Mai 2010. Ohne weiter darüber nachzudenken, fand ich seit dem Betreten des Krankenzimmers endlich meine Sprache wieder.
"Hallo kleiner Maikäfer", begrüßte ich Jonathan leise.
Er reagierte darauf, indem er seine Augen öffnete und auf diese Weise mehr sagte, als es mit Worten je möglich gewesen wäre. Sein Blick verriet mir, wie viel Kraft ihn der Überlebenskampf gekostet hatte und gleichzeitig konnte ich einen so starken Willen sehen.
Jonathan hatte um sein Leben gekämpft, ohne zu wissen, was auf ihn wartete. Ohne zu wissen, dass jemand auf ihn wartete. Und ohne das Gefühl, gewollt zu sein.
Ich löste meine Augen von ihm und schaute Jan an. Er lächelte und damit war klar: Dieser hübsche, kleine Junge war unser Licht. Und er brachte nicht nur uns selbst zum Leuchten, sondern nahm uns noch in dieser Sekunde den unausgesprochene Schwur ab, für immer seine Beschützer zu sein.
Erst einige Jahre später realisierte ich die Bedeutung dieses Augenblicks. Hätte mein Herz damals sprechen können und nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde festgehangen, hätte ich Jonathan gesagt, dass ich auf ihn gewartet habe. Dass ich ihn für den Rest meines Lebens lieben werde und ihm beweisen werde, dass es sich gelohnt hat, um dieses Leben zu kämpfen. Selbst wenn die Sterne vom Himmel fallen, der Regenbogen seine Farben verliert und der Rhythmus der Zeit verstummt.
Kapitel 2
Außerhalb meines Gedanken-Karussells schienen lediglich ein paar Minuten vergangen zu sein. Die Ärztin, lächelte mich an und fragte mit erwartungsvollem Blick: "Wollen Sie ihn mal halten?"
Da ich ganz offensichtlich mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck reagierte, fügte sie schnell hinzu: "Machen Sie sich keine Sorgen, das Kabelgewirr sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Außerdem lasse ich Sie nicht alleine."
"Los, trau dich", stimmte Jan ihr lachend zu. Er wirkte auf mich unglaublich gelöst und glücklich. In dem Moment, als er Jonathan zum ersten Mal sah, war er mit Leib und Seele Papa geworden.
"Okay", murmelt ich, ging zu dem Stuhl, der zwischen Jonathans Bettchen und dem Fenster stand und setzte mich.
"Machen Sie es sich ganz bequem" wurde ich aufgefordert.
"Wollen Sie einen Hocker haben, damit Sie die Füße hoch legen können?"
"Nein Danke, das geht schon", antwortete ich und hatte nur ein gefühltes Augenzwinkern später Jonathan im Arm. Er fühlte sich warm, weich und irgendwie kuschelig an. Dass er aus dem Bett geholt und mir auf den Arm gelegt wurde, interessierte ihn herzlich wenig. Völlig unbeeindruckt schlummerte er weiter.
"Momentan ist er noch sehr schläfrig. Die Medikamente zur Sedierung sind noch nicht vollständig abgesetzt", sagte die Ärztin und erklärte in einem sanften Tonfall weiter: "Als Jonathan hier ankam, war sein Zustand sehr kritisch. Seine Lunge war durch eine Mekoniumaspiration schwer geschädigt worden. Herz und Gehirn fingen an, davon in Mitleidenschaft gerissen zu werden, sodass wir ihn an die ECMO anschließen musste - eine Herz-Lungen-Maschine, bei der das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff versorgt wird."
Dank Jans Arbeit als Medzin-Deutsch-Übersetzer wusste ich bereits, dass bei einer Mekoniumaspiration vor oder unter der Geburt der Darminhalt des Neugeborenen in seine Lunge gerät.
"Wie geht es ihm denn jetzt", fragte Jan.
Die Ärztin sah nach der Uhr über der Tür. "Dr. Bähr und Professor Schlegel werden in etwa zwei Stunden aus einer OP kommen und mit Ihnen sprechen. Sie werden Ihnen alles genau erklären und Ihre Fragen beantworten. Bis dahin können Sie und Jonathan sich noch etwas beschnuppern."
"In Ordnung. Dürfen wir ein paar Fotos machen?"
"Aber natürlich."
Und keine zwei Sekunden später sprang Jan mit seiner Kamera um Jonathan und mich herum, als hätte ich das Kind von Lady Gaga und Dieter Bohlen auf dem Arm. Auf den dabei entstanden Fotos strahle ich heller als tausend Diamanten. Abwechselnd lächelte ich die Ärztin, die Krankenschwestern, Jonathan und Jan an. Wie eine Art Blaulicht, nur mit Lächeln statt blau - quasi ein unübersehbares Lächellicht.
Zwischendurch unterhielten wir uns auch. Der Inhalt dieser Gespräche ist jedoch lediglich als "Blabla" in meinem Kopf abgespeichert. Es waren einfach so viele Eindrücken, die die Speicherkapazität meines Gehirn offensichtlich überforderten.
Als mir der Arm einschlief, weil ich mich nicht traute, mich auch nur einen Millimeter zu bewegen, sagte ich zu Jan: "Jetzt bist du dran."
Behutsam nahm mir die Ärztin, die nicht von unserer Seite wich Jonathan aus dem Arm, damit ich den Platz für Jan räumen konnte. Er ließ ihn sich geben und es bestand nicht der Hauch eines Zweifels: Diese beiden Menschen waren füreinander geschaffen. Vielleicht lag es daran, dass Jan selbst adoptiert wurde. Noch Jahre später sah ich die ganz besondere Verbindung der beiden, die über eine Papa-Kind-Liebe weit hinaus ging und die sich mit Worten nicht beschreiben ließ.
Bei diesem Anblick musste sogar die Ärztin lächeln. "Es sieht so aus, als hätten Sie sich gesucht und gefunden." Sie schwieg einen Moment und schien zu überlegen, ob Sie ihre Gedanke aussprechen oder für sich behalten sollte, entschied sich dann aber für ersteres: "Es wäre unglaublich schön, wenn Jonathan ein Zuhause bei Ihnen finden würde. Die ganze Station hat ihn so lieb gewonnen, aber letzten Endes braucht der kleine Kämpfer Eltern, die ihm das Gefühl geben, gewollt und willkommen zu sein."
Während sie das sagte, glitzerten ihre Augen verräterisch und ich war unheimlich gerührt, zu sehen, dass Jonathan schon jetzt Herzen im Sturm erobern konnte und dass man hier so viel Anteilnahme an seiner Geschichte zeigte.
Inzwischen war Jonathan aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und beäugte Jan ein wenig skeptisch.
"Hallo kleiner Mann", begrüßte er ihn liebevoll.
Jonathan reagierte weiterhin mit stiller Skepsis. Und dann passierte es: Er ließ uns am lautesten Power-Pups aller Zeiten teilhaben.
"Das ist mein Sohn", lachte Jan und jeder, der den vorangegangen Mini-Knall gehört hatte (also alle 300.000 Einwohner von Mannheim), mit ihm.
Nach etwa einer halben Stunde des ersten Kennenlernes war es Zeit für Jonathans Zwischenmahlzeit-Snack, den er über eine Magensonde erhielt. Zuvor legt ihn die Ärztin wieder in sein oranges Gitterstäbe-Bettchen.
"Wollen wir uns auch kurz etwas zu essen holen?", fragte mich Jan.
"Ja, wenn das okay ist?", antwortete ich mit gleichzeitig fragendem Blick zur Ärztin, die sofort reagierte: "Selbstverständlich. Ich muss auch noch nach unseren anderen Patienten sehen. Aber ich versuche anschließend wieder herzukommen. Falls ich es nicht schaffe, sehen wir uns ja sicher morgen."
Ich sah Jan ratsuchend an. "Ähm, nein. Leider nicht. Wir müssen heute wieder nach Hause und haben einen weiten Weg."
"Oh, das ist schade", sagte die Ärztin sichtlich enttäuscht.
"Aber wir könnten am Freitag wiederkommen und bis Sonntag bleiben", warf Jan schnell ein und ich bestätigte den Vorschlag mit heftigem Nicken.
"Wenn Sie das einrichten könnten, wäre das wirklich super. Lassen Sie sich von den Schwestern die Adresse vom Elternhaus geben, wo Sie übernachten können."
"Machen wir", versprach ich und drehte mich zu Jonathan, um mich zu verabschieden: "Bis später kleiner Maikäfer."
Ganz vorsichtig streichelte ich ihm über sein Köpfchen und Jan, der auf der anderen Seite des Bettchens stand, hob Jonathans Arm leicht an, um mit seiner großen gegen seine kleine Faust zu stupsen.
Wir verließen die Station 28-4 und das Gebäude. Die schwüle Sommerhitze verpasste uns einen heftigen Schlag, denn die Neonatologie war angenehm klimatisiert.
Abrupt blieb Jan stehen.
"Was?", fragte ich.
Er sah mich ernst und intensiv an. "Und?"
"Und was?", fragte ich. Dieses Mal etwas eindringlicher.
"Machen wir es? Adoptieren wir Jonathan?"
Ich überlegte kurz und schaute ihm dann in die Augen, während ich wieder begann wie ein Honigkuchenpferd zu strahlen.
"Ehrlich. Ich hab echt Angst. Aber ich hab ja dich. Also ja. Wir machen es."
Jan hätte in diesem Moment ebenfalls locker die Grinsekatze aus Alice im Wunderland in die Tasche stecken können. Er nahm meine Hand und marschierte zielgerichtet der Cafeteria entgegen.
Einige Meter später blieb er wieder wie vom Blitz getroffen stehen.
"Lass uns gleich Frau Wiegandt anrufen."
"Ja, natürlich", stimmte ich - jetzt ebenfalls vom Blitz getroffen - zu.
Während Jan telefonierte, atmete ich tief durch. Mir war durchaus bewusst, was da gerade geschah und trotzdem war ich weit davon entfernt, es zu realisieren.
Rückblickend war ich in diesem Moment bereits eine Mama. Nele - Langzeitstudentin, ehrgeizige Redakteurin, idiotischer Tollpatsch, zickiges Nervenbündel und seit neustem Mama. Bis ich diese neue Rolle als selbstverständlich empfand, musste allerdings noch viel Zeit vergehen.
Weitere Werke von Rosenmond:
|
|
| Nach oben |
|
 |
lilli.vostry
Wortschmiedin

Beiträge: 1219
Wohnort: Dresden
|
  11.01.2015 02:08 11.01.2015 02:08
aw:Maikäfer
von lilli.vostry
|
 |
|
Hallo Rosenmond,
eine wunderbare, ungewöhnliche Geschichte einer Adoption, die von Anfang bis Ende fesselt. (auch wenn im Vorspann schon anklingt, dass es gut ausging... ) Dann auch noch alles andere als ein Vorzeige-Paar, jung und in vielem uneins, aber mit festem Kinderwunsch, macht sicht auf den weiten Weg in eine Klinik, wo sie (auch das noch) sich für ein schwerkrankes Baby entscheiden, künftig seine Eltern und Beschützer zu sein...
Mir gefällt vor allem die Erzählweise: der anfangs rauhe, wenig harmonische Ton des Paars, wohl auch der Aufregung des bevorstehenden Ereignisses geschuldet; all die Fragen, Ängste, Zweifel, Unsicherheiten lösen sich auf beim Betreten der Klinik und als sie ihren "Maikäfer" Jonathan das erste Mal in seinem Bettchen mit den vielen Schläuchen sehen und in den Arm nehmen - so sachlich und zugleich zärtlich nahegehend, witzig und nachdenklich beschrieben, dass man meint unmittelbar dabei zu sein.
Warum sie sich für diesen Weg entschieden, bleibt unklar, man erfährt nur, dass der Mann einst selbst adoptiert wurde und sofort einen Draht zu dem Kleinen hat, während die Frau sich zunächst weniger wohl in ihrer Mama-Rolle zu fühlen scheint...
Sprachlich könnte man einiges sicher noch straffen, überflüssige Erklärungen - wie dass das Gehin nicht alle Eindrücke speichern konnte und manchmal geraten die Zeitformen durcheinander. Es sind auch einige Rechtschreibfehler in der Groß- und Kleinschreibung, fehlende Endungen bei Worten und Kommafehler im Text.
Das lässt sich leicht beheben.
Mich würde interessieren, wie die Geschichte weitergeht, wie das junge Paar in seine Eltern-Rolle gewachsen ist und wie es ihrem Maikäfer heute geht.
Frohe Schreibgrüße,
Lilli
_________________
Wer schreibt, bleibt und lebt intensiver |
|
| Nach oben |
|
 |
Rosenmond
 Schneckenpost Schneckenpost

Alter: 39
Beiträge: 12
|
  11.01.2015 12:09 11.01.2015 12:09
von Rosenmond
|
  |
|
Kapitel 1
"Jetzt fahr doch mal wie ein normaler Mensch", blaffte mich Jan vom Beifahrersitz aus an und hielt sich demonstrativ am Griff über der Autotür fest.
"Was denn?", fauchte ich genervt zurück.
"Nele, wenn du blinkst, musst du auch irgendwann rüberfahren."
"Das weiß ich. Aber wenn von hinten was kommt, kann ich schlecht die Spur wechseln."
"Meine Fresse, die Lücke ist mindestens einen Kilometer lang. Fahr doch einfach."
Es reichte. Das Maß war voll. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich überlegte kurz, einfach anzuhalten und auszusteigen. Allerdings war die Realisierung dieses Gedankens, mitten auf der Autobahn bei 130 km/h, keine echte Option. Meinen Beifahrer bei voller Fahrt aus meinem kleinen, schwarzen Twingo zu schupsen, war auch keine Alternative. Hauptsächlich, weil es zu viel Kraft und mehr als zwei Hände erforderte, ihn abzuschnallen, die Beifahrertür zu öffnen und ihm einen Tritt zu verpassen. Also entschied ich mich für einen verbalen Ausfallschritt: "Ich hasse dich. Kannst du nicht ein einziges Mal die Klappe halten, wenn ich fahre? Du wolltest dich doch nicht ans Steuer setzen, weil du zu aufgeregt bist. Aber schön, dass du in jeder Lebenslage genug Gründe findest, mich vollzumotzen. Verdammt, du bist so ein Arschloch und ich weiß echt nicht, wieso ich dich geheiratet habe." Zugegeben, ich war noch nie der Wesens-Typ "zartes Gänseblümchen", eher eine diplomatische Kreuzung aus Vergissmeinnicht und Kaktus. Doch erst seit ich mit Jan zusammen war, kannte ich den Aggro-Stech-Modus. Dieser und ein Tränenschleier vor den Augen ließen mich nun halb erblinden, was mich jedoch nicht daran hinderte, von der mittleren auf die linke Spur zu ziehen. Für Schulterblick, Kontrolle im Rückspiegel oder andere Unfallpräventionen war im besagten Wut-Modus kein Platz. Dass der nachfolgende Verkehr so dicht wie der boreale Nadelwald war, entzog sich meiner Wahrnehmung ebenfalls.
Erst als der Passatfahrer hinter mir die Lichthupe zum Glühen brachte und mir Jan ein "Pass auf!" ins Ohr brüllte, realisierte ich, dass Ehestreit und Autobahnfahrten keine wirklich gute Kombination waren. Mit dieser Erkenntnis steuerte ich den nächsten Parkplatz an.
Ohne weitere Zwischenfälle brachte ich den Twingo zum Stehen, stieg kommentarlos aus, schmiss die Autotür hinter mir zu und suchte mit dem Rücken an selbiger Halt. Ich vergrub das Gesicht in meinen Händen und schluchzte leise vor mich hin.
Jan hatte das Auto inzwischen ebenfalls verlassen. Er stand jetzt vor mir und nahm mich ungefragt in den Arm. "Ach, komm her Püppi", flüsterte er versöhnlich.
"Warum bist du denn so ein blöder Arsch?", fragte ich dumpf gegen seine Brust und unterstrich meine Aussage mit einem Seufzer.
"Weil ich nun mal nicht jeden Tag 500 Kilometer fahre, um mein eventuell zukünftiges Kind zu besuchen."
Ja, da hatte er Recht. Wir waren auf dem Weg zu unserem eventuell zukünftigen Kind - ein knapp zwei Monate alter Junge namens Jonathan.
Erst vier Wochen war es her, dass wir unseren "Hallo wir sind Nele und Jan und möchten gern Adoptiveltern werden"-Termin beim Jugendamt hatten.
Es kam mir vor, als hätte ich erst gestern beim Betreten des Jungendamtes zu Jan gesagt: "Scheiße, ich habe keine blickdichten Strumpfhosen angezogen. Jetzt sieht die, dass ich tätowiert bin und dann bin ich gleich unten durch."
"Wenn man hier auf Basis von Klischees entscheidet, haben wir sowieso keine Chance", lachte Jan und krempelte gleichzeitig seine Hemdärmel nach oben, wobei sein tätowierter Unterarm zum Vorschein kam.
Dieser Mann brachte es regelmäßig fertig, meinen inneren Hulk zu wecken. Aber wenn es darauf ankam, schaffte er es immer, mich zu erden.
Für das erste Adoptionsgespräch beim Jugendamt hatten wir, bis auf die Terminvereinbarung, keine Vorbereitungen getroffen. Was hätte das auch gebracht? Wir wussten, warum wir adoptieren wollten und stellten uns auf drei bis fünf Jahre Wartezeit ein.
Hätten wir uns bereits im Vorfeld umfassend über das bevorstehende Gespräch und den anschließenden Prozess informiert, wären wir an diesem Tag vielleicht nicht wir gewesen: Ich hätte penibel auf die blickdichten Strumpfhosen geachtet, hätte jede Antwort sorgfältig abgewogen und Jan bei jeder zu ehrlichen Aussage unter dem Tisch ein blaues Schienbein verpasst. Wir hätten womöglich nicht offenherzig gesagt, dass wir einem Kind kein Leben in Wohlstand und finanziellem Reichtum bieten konnten, dass wir als Paar manchmal schwer zu ertragen waren und dass wir unser Leben als Einzelpersonen nicht komplett aufgeben wollten. Frau Wiegandt, die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes, hätte dann wahrscheinlich auch den wunderbaren kleinen Jungen nicht erwähnt, für den sie noch kein Zuhause gefunden hatte und der uns nur 27 Tage später auf den Autobahnparkplatz führte.
"Komm, ich fahre die letzten 150 Kilometer nach Mannheim. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an die Gurgel springen, wenigstens ein bisschen", sagte Jan lächelnd, während er mich noch immer im Arm hielt.
Ich nickte und löste endlich meine Stirn von seiner Brust. Mit dem Handrücken wischte ich mir die letzten Tränen aus dem Gesicht, lief einmal ums Auto und nahm mit einem Seufzer auf dem Beifahrersitz Platz. Jan stieg ebenfalls ins Auto und wir setzten unsere außergewöhnliche Reise fort.
Kurz nach 13.00 Uhr erreichten wir das Universitätsklinikum Mannheim. Zu diesem Zeitpunkt lag mein Ruhepuls gefühlt bei 120. Gut organisiert, wie wir ausnahmsweise waren, hatten wir Wechselklamotten dabei. Die Sommerhitze, eine 5-Stunden-Autofahrt und die innere Ruhe eines brodelnden Vulkans hatten uns nicht mehr so ganz taufrisch aussehen lassen. Da wir jedoch nicht den Eindruck erwecken wollten, als seien wir zu unserem Termin gejoggt, schlüpften wir also noch im Parkhaus in unsere Vorzeigeoutfits.
Wenige Minuten danach standen wir nicht nur im Eingangsbereich der Klinik, sondern am Beginn des größten Abenteuers unseres Lebens.
Das Krankenhaus in Mannheim kam mir riesig vor. Erst 30 Minuten und drei Orientierungsgespräche mit dem Klinikpersonal später erreichten wir die Station 28-4, die Neonatologie. Hier wurde das Leben noch während seiner ersten Züge auf eine harte Probe gestellt. Gegen alle Widrigkeiten retteten die Ärzte und Schwestern an diesem Ort nicht einfach nur Leben, sie schenkten das erste Lächeln, die erste Liebe und all die wunderbaren Dinge, die die Welt für jeden bereit hielt.
Um den kleinen Patienten und ihren Angehörigen zu etwas Ruhe und dem Gefühl von Geborgenheit zu verhelfen, war die Station natürlich nicht für jeden zugänglich. Wir standen also vor verschlossenen Türen und mussten uns über eine Gegensprechanlage anmelden. Frau Wiegandt hatte unseren Besuch bereits beim Team der Neonatologie angekündigt und man bat uns, im Elternzimmer zu warten. Auf ungefähr acht Quadratmetern fanden eine kleine Sitzecke mit Tisch sowie eine Stuhlreihe Platz. Dazwischen wies ein Fenster dem Sonnenlicht seinen Weg in den Raum, der seine Besucher mit unendlichem Glück empfing. Es strahlte von den Wänden, an denen dutzende Familienfotos ehemaliger, kleiner Patienten hingen. Auf jedem einzelnen Bild war Dankbarkeit für das Wunder zu erkennen, dass die Mitarbeiter der Station vollbracht hatten. Zu etlichen Fotos gab es auch Briefe, von denen ich mir einige durchlas. Manche Eltern schickten lediglich Grüße, andere berichteten, wie ihr kleines Wunder in den vergangenen Jahren gewachsen war und wieder andere erzählten wie das Schicksal sie in die Neonatologie nach Mannheim brachte, wo ihnen die Ärzte und Schwestern Hoffnung und Kraft gaben - etwas, wofür sie ewig dankbar sein werden.
Mit jedem Wort, das ich las wurde der Kloß in meinem Hals größer. Wie schafften es all diese Familien nur, das Beste aus ihrer Situation zu machen? Woher nahmen Sie die Energie dafür?
Angesichts dieser bewegenden Geschichten kam mir das, was vor uns lag so unfassbar groß und schrecklich beängstigend vor.
Meine Augen wanderten weiter von einem Foto zum nächsten während ich auf einem Stuhl Platz nahm. Auf dem Tisch vor mir standen Gläser und Wasserflaschen. Geistesabwesend und immer noch die Bilder im Blick goss ich mir einen Schluck Wasser ein. Was tat ich hier eigentlich? War ich denn überhaupt mit 25 Jahren schon erwachsen genug dafür? Was wenn ich mich nicht in den kleinen Jonathan verlieben oder wenn er kein Band zu mir knüpfen würde? Wenn ich einfach meinen Mama-Modus nicht aktivieren kann? Wenn er nie wieder richtig gesund wird und ich damit nicht umgehen kann? Oder schlichtweg alles total schief geht?
Ich hatte also eine leichte Panikattacke, in der ich mir wünschte, irgendeine dieser albernen aber beruhigenden Atemtechniken zu beherrschen.
Jan war mir leider auch keine große Hilfe. Ihm ging es ähnlich. Er stand auf, drehte eine Runde in dem Raum, murmelte etwas von "Mir ist so schlecht." und setzte sich anschließend auf einen anderen Stuhl, um eine Minute später erneut aufzustehen. Er erinnerte mich irgendwie an Dumbo, kurz vor seinem ersten Flug. Ich konnte seinen inneren Kampf förmlich hören:
"Ich schaffe das. Oh Gott, nein, ich kann nicht. Aber ich werde es hinbekommen. Verdammt, das funktioniert doch nie. Nein, ich tue es einfach."
Wären meine Gedanken und Emotionen nicht im Schleudergang unterwegs gewesen, hätte ich herzlich über den Anblick von Jan gelacht. Stattdessen ging ich zu ihm, nahm seine Hand und sagte mit aller Überzeugungskraft, die ich in diesem Moment zusammenkratzen konnte:
"Wir werden das schon schaffen."
Er antwortete mit einem Lächeln.
Es war inzwischen etwa eine halbe Stunde vergangen, als eine junge, hübsche Ärztin das Zimmer betrat.
"Herr und Frau Winter?", fragte sie freundlich.
Wir nickten gleichzeitig.
"Schön. Wir freuen uns alle sehr über Ihren Besuch. Kommen Sie mit. Ich stelle Ihnen Jonathan, den kleinen Sonnenschein der Station, mal vor", fuhr sie fort und forderte uns mit einer Handbewegung auf, ihr zu folgen. Obwohl ich das Gefühl hatte, mein gesamter Körper würde ausschließlich aus Wackelpudding bestehen, setzte ich einen Fuß vor den anderen. Mit der Anmut eines Nussknackers versuchte ich möglichst gelassen zu wirken und meine Unsicherheit wegzulächeln.
Und dann standen wir in der Tür, nur wenige Schritte von Jonathans Bett entfernt. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich die Türschwelle des Raumes überschritt.
"Bitte waschen und desinfizieren Sie sich die Hände", bat uns die Ärztin und wies auf das Waschbecken, gleich neben der Tür. Jan war schon damit fertig, bevor sie die Aufforderung beendet hatte. Als gelernter Kinderkrankenpfleger musste ihn keiner auf den richtigen Umgang mit kleinen Patienten hinweisen. Ich war hingegen schon bei dieser Sache überfordert, was Jan nicht entging: "Nicht nur die Hände waschen. Auch den ganzen Unterarm. Dann abtrocken und mit dem Ellenbogen kannst du anschließend den Desinfektions-Spender bedienen."
Dankbar befolgte ich seine Anweisungen, war aber nicht ansatzweise in der Lage auch nur ein Wort zu sagen. Als ich fertig war, drehte ich mich um und ging zu Jonathan. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich weder die freundliche, helle Atmosphäre des großes Zimmers war, noch die drei anderen Bettchen und schon gar nicht die vielen gespannten Augenpaare der anwesenden Krankenschwestern.
Jonathans kleiner Körper war umgeben von orangefarbenen Gitterstäben. Er lag auf einem blauen, mit Elefanten gemusterten Bettlaken. Am Kopfende bündelten sich neben zwei Kuscheltieren große und kleine Schläuche zu einem wirren Knäuel. Es half ihm beim Atmen und versorgte ihn mit Nahrung sowie Medikamenten. Monitore und jede Menge Gerätschaften standen um ihn herum, als würden sie über seinen Schlaf wachen.
Langsam schob ich meine Hand durch die Gitterstäbe und legte sie auf Jonathans Arm. Er fühlte sich unglaublich zart und weich an. Für den Bruchteil einer Sekunde flammte unbändiges Mitleid in mir auf und noch im selben Atemzug ärgerte ich mich über dieses Gefühl, denn so wollte ich ihm nicht gegenübertreten.
Ich versuchte mich zu sammeln und schaute das kleine Bündel vor mir ganz genau an. An den Füßchen war ein Sensor befestigt und in der Leiste hatte man einen Zugang gelegt. Durch sein linkes Nasenloch führte eine Magensonde, deren Schlauch mit einem großen Herzchen-Pflaster auf seiner Wange festgeklebt war. Ein anderer Schlauch in seinem rechten Nasenloch unterstütze ihn beim Atmen. Abgesehen vom medizinischen Kabelsalat, sah Jonathan eigentlich gar nicht krank aus. Er hatte diesen typischen gesunden Babyspeck, der bei kleinen Kindern vor allem fremde Senioren anlockte, um in eben diesen voller Begeisterung zu kneifen und zu knuffen.
Während ich ihn mir so ansah, überlegte ich, was ich über Jonathan wusste. Frau Wiegandt hatte uns zwar bereits eine kurze Zusammenfassung zukommen lassen, deren medizinisches Fachchinesisch mir Jan auch übersetzt hatte, aber jetzt, an diesem orangefarbenen Bettchen, hatte ich einfach alles vergessen. Das Einzige, an das ich mich in diesem Moment erinnern konnte, war sein Geburtstag: der 1. Mai 2010. Ohne weiter darüber nachzudenken, fand ich seit dem Betreten des Krankenzimmers endlich meine Sprache wieder.
"Hallo kleiner Maikäfer", begrüßte ich Jonathan leise.
Er reagierte darauf, indem er seine Augen öffnete und auf diese Weise mehr sagte, als es mit Worten je möglich gewesen wäre. Sein Blick verriet mir, wie viel Kraft ihn der Überlebenskampf gekostet hatte und gleichzeitig konnte ich einen so starken Willen sehen.
Jonathan hatte um sein Leben gekämpft, ohne zu wissen, was auf ihn wartete. Ohne zu wissen, dass jemand auf ihn wartete. Und ohne das Gefühl, gewollt zu sein.
Ich löste meine Augen von ihm und schaute Jan an. Er lächelte und damit war klar: Dieser hübsche, kleine Junge war unser Licht. Und er brachte nicht nur uns selbst zum Leuchten, sondern nahm uns noch in dieser Sekunde den unausgesprochene Schwur ab, für immer seine Beschützer zu sein.
Erst einige Jahre später begriff ich die Bedeutung dieses Augenblicks. Hätte mein Herz damals sprechen können und nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde festgehangen, hätte ich Jonathan gesagt, dass ich auf ihn gewartet hatte. Dass ich ihn für den Rest meines Lebens lieben und ihm beweisen würde, dass es sich gelohnt hatte, um dieses Leben zu kämpfen. Selbst wenn die Sterne vom Himmel fielen, der Regenbogen seine Farben verlor und der Rhythmus der Zeit verstummte.
Kapitel 2
Außerhalb meines Gedanken-Karussells schienen lediglich ein paar Minuten vergangen zu sein. Die Ärztin, lächelte mich an und fragte mit erwartungsvollem Blick: "Wollen Sie ihn mal halten?"
Da ich ganz offensichtlich mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck reagierte, fügte sie schnell hinzu: "Machen Sie sich keine Sorgen, das Kabelgewirr sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Außerdem lasse ich Sie nicht alleine."
"Los, trau dich", stimmte Jan ihr freudig zu. Er wirkte auf mich unglaublich gelöst und glücklich. In dem Moment, als er Jonathan zum ersten Mal sah, war er mit Leib und Seele Papa geworden.
"Okay", murmelt ich, ging zu dem Stuhl, der zwischen Jonathans Bettchen und dem Fenster stand und setzte mich.
"Machen Sie es sich ganz bequem" wurde ich aufgefordert.
"Wollen Sie einen Hocker haben, damit Sie die Füße hoch legen können?"
"Nein Danke, das geht schon", antwortete ich und hatte nur ein gefühltes Augenzwinkern später Jonathan im Arm. Er fühlte sich warm, weich und irgendwie kuschelig an. Dass er aus dem Bett geholt und mir auf den Arm gelegt wurde, interessierte ihn herzlich wenig. Völlig unbeeindruckt schlummerte er weiter.
"Momentan ist er noch sehr schläfrig. Die Medikamente zur Sedierung sind noch nicht vollständig abgesetzt", sagte die Ärztin und erklärte in einem sanften Tonfall weiter: "Als Jonathan hier ankam, war sein Zustand sehr kritisch. Seine Lunge war durch eine Mekoniumaspiration schwer geschädigt worden. Herz und Gehirn fingen an, davon in Mitleidenschaft gerissen zu werden, sodass wir ihn an die ECMO anschließen mussten - eine Herz-Lungen-Maschine, bei der das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff versorgt wird."
Dank Jans Arbeit als Medizin-Deutsch-Übersetzer wusste ich bereits, dass bei einer Mekoniumaspiration vor oder unter der Geburt der Darminhalt des Neugeborenen in seine Lunge gerät.
"Wie geht es ihm denn jetzt", hakte Jan nach.
Die Ärztin sah auf die Uhr über der Tür. "Dr. Bähr und Professor Schlegel werden in etwa zwei Stunden aus einer OP kommen und mit Ihnen sprechen. Sie werden Ihnen alles genau erklären und Ihre Fragen beantworten. Bis dahin können Sie und Jonathan sich noch etwas beschnuppern."
"In Ordnung. Dürfen wir ein paar Fotos machen?"
"Aber natürlich."
Und keine zwei Sekunden später sprang Jan mit seiner Kamera um Jonathan und mich herum, als hätte ich das Kind von Lady Gaga und Dieter Bohlen auf dem Arm. Trotzdem strahle ich auf den dabei entstanden Fotos heller, als tausend Diamanten. Abwechselnd lächelte ich die Ärztin, die Krankenschwestern, Jonathan und Jan an. Wie eine Art Blaulicht, nur mit Lächeln statt blau - quasi ein unübersehbares Lächellicht.
Zwischendurch unterhielten wir uns auch. Der Inhalt dieser Gespräche ist jedoch lediglich als "Blabla" in meinem Kopf abgespeichert. Es waren einfach so viele Eindrücken.
Als mir der Arm einschlief, weil ich es absolut nicht wagte, mich auch nur einen Millimeter zu bewegen, sagte ich zu Jan: "Jetzt bist du dran."
Behutsam nahm mir die Ärztin, die nicht von unserer Seite wich, Jonathan aus dem Arm, damit ich den Platz für Jan räumen konnte. Er ließ ihn sich geben und es bestand nicht der Hauch eines Zweifels: Diese beiden Menschen waren füreinander geschaffen. Vielleicht lag es daran, dass Jan selbst adoptiert wurde. Noch Jahre später sah ich die ganz besondere Verbindung der beiden, die über eine Papa-Kind-Liebe weit hinaus ging und die sich mit Worten nicht beschreiben ließ.
Bei diesem Anblick musste sogar die Ärztin lächeln. "Es sieht so aus, als hätten Sie sich gesucht und gefunden." Sie schwieg einen Moment und schien zu überlegen, ob Sie ihre Gedanken aussprechen oder für sich behalten sollte, entschied sich dann aber für ersteres: "Es wäre unglaublich schön, wenn Jonathan ein Zuhause bei Ihnen finden würde. Die ganze Station hat ihn so lieb gewonnen, aber letzten Endes braucht der kleine Kämpfer Eltern, die ihm das Gefühl geben, gewollt und willkommen zu sein."
Während sie das sagte, glitzerten ihre Augen verräterisch und ich war unheimlich gerührt, zu sehen, dass Jonathan schon jetzt Herzen im Sturm erobern konnte und dass man hier so viel Anteilnahme an seiner Geschichte zeigte.
Mittlerweile war Jonathan aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und beäugte Jan ein wenig skeptisch.
"Hallo kleiner Mann", begrüßte er ihn liebevoll.
Jonathan reagierte weiterhin mit stiller Skepsis. Und dann passierte es: Er ließ uns am lautesten Power-Pups aller Zeiten teilhaben.
"Das ist mein Sohn", lachte Jan und jeder, der den vorangegangen Mini-Knall gehört hatte (also circa alle 300.000 Einwohner von Mannheim), mit ihm.
Nach etwa einer halben Stunde des ersten Kennenlernens war es Zeit für Jonathans Zwischenmahlzeit-Snack, den er über eine Magensonde erhielt. Zuvor legt ihn die Ärztin wieder in sein orangefarbenes Gitterstäbe-Bettchen.
"Wollen wir uns auch kurz etwas zu essen holen?", fragte mich Jan.
"Ja, wenn das okay ist?", antwortete ich mit gleichzeitig fragendem Blick zur Ärztin, die sofort reagierte: "Selbstverständlich. Ich muss auch noch nach unseren anderen Patienten sehen. Aber ich versuche anschließend wieder herzukommen. Falls ich es nicht schaffe, sehen wir uns ja sicher morgen."
Ich sah Jan ratsuchend an. "Ähm, nein. Leider nicht. Wir müssen heute wieder nach Hause und haben einen weiten Weg."
"Oh, das ist schade", sagte die Ärztin sichtlich enttäuscht.
"Aber wir könnten am Freitag wiederkommen und bis Sonntag bleiben", warf Jan schnell ein und ich bestätigte den Vorschlag mit heftigem Nicken.
"Wenn Sie das einrichten könnten, wäre das wirklich super. Lassen Sie sich von den Schwestern die Adresse vom Elternhaus geben, wo Sie übernachten können."
"Machen wir", versprach ich und drehte mich zu Jonathan, um mich zu verabschieden: "Bis später kleiner Maikäfer."
Ganz vorsichtig streichelte ich ihm über sein Köpfchen und Jan, der auf der anderen Seite des Bettchens stand, hob Jonathans Arm leicht an, um mit seiner großen gegen dessen kleine Faust zu stupsen.
Wir verließen die Station 28-4 und das Gebäude. Die schwüle Sommerhitze verpasste uns einen heftigen Schlag, denn die Neonatologie war angenehm klimatisiert.
Abrupt blieb Jan stehen.
"Was?", fragte ich.
Er sah mich ernst und intensiv an. "Und?"
"Und was?", fragte ich. Dieses Mal etwas eindringlicher.
"Machen wir es? Adoptieren wir Jonathan?"
Ich überlegte kurz und schaute ihm dann in die Augen, während ich wieder begann wie ein Honigkuchenpferd zu strahlen.
"Ehrlich. Ich hab echt Angst. Aber ich hab ja dich. Also ja. Wir machen es."
Jan hätte in diesem Moment ebenfalls locker die Grinsekatze aus Alice im Wunderland in die Tasche stecken können. Er nahm meine Hand und marschierte zielgerichtet der Cafeteria entgegen.
Einige Meter später blieb er wieder wie vom Blitz getroffen stehen.
"Lass uns gleich Frau Wiegandt anrufen."
"Ja, natürlich", stimmte ich - jetzt ebenfalls vom Blitz getroffen - zu.
Während Jan mit der Sozialarbeiterin telefonierte, atmete ich tief durch. Mir war durchaus bewusst, was da gerade geschah und trotzdem war ich weit davon entfernt, es zu realisieren.
Rückblickend war ich in diesem Moment bereits eine Mama. Nele - Langzeitstudentin, ehrgeizige Redakteurin, idiotischer Tollpatsch, zickiges Nervenbündel und seit neustem Mama. Bis ich diese neue Rolle als selbstverständlich empfand, musste allerdings noch viel Zeit vergehen.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Rosenmond
 Schneckenpost Schneckenpost

Alter: 39
Beiträge: 12
|
  11.01.2015 12:16 11.01.2015 12:16
von Rosenmond
|
  |
|
Vielen Dank Lilli für dein Feedback.
Immer diese dummen Rechtschreibfehler 
Ich habe mir versucht, die Zeitformen vorzuknöpfen und muss da mal eine doofe Frage stellen: Bleibt man konsequent im Präteritum, selbst wenn man einen Umstand beschreibt, der jetzt noch immer zutrifft (zum Beispiel, dass die Ärzte noch immer Leben retten und nicht nur damals, bei unserem Besuch)?
LG
|
|
| Nach oben |
|
 |
rieka
 Sucher und Seiteneinsteiger Sucher und Seiteneinsteiger

Beiträge: 816
|
  24.01.2015 14:02 24.01.2015 14:02
von rieka
|
 |
|
Du hast da, finde ich, eine gute Idee. 
Ihr seid beide damals sehr jung gewesen. Es mag viele Gründe geben, sich so früh für eine Adoption zu entscheiden.
Neben einer ideologisch motivierten Entscheidung dazu ist sicher ein Grund, dass ein Mädchen, eine Frau sehr früh erfährt, dass sie selbst kein Kind austragen kann, oder für einen Jungen/Mann, dass früh Zeugungsunfähigkeit feststeht. Für solche Mädchen/Frauen und auch Männer kann deine Geschichte, die sich mit der emotionalen Seite einer Adoption beschäftigt, eine Hilfe sein. Zwar geben Behörden, wenn die Entscheidung gefallen ist, sehr differenzierte Unterstützung und Schulung.
In einer Arztpraxis aber könnte dein Text schon eingreifen, wenn es darum geht, zu verdauen, dass eine Lebensvorstellung zerbrochen ist. Eine Geschichte bietet durch seine Einfühlung immer auch Identifikationshilfen.
Du hast schon eine Kritik bekommen. Du schreibst lebendig und nachvollziehbar. Bei starken Emotionen bzw. bei Aufregung flüchtest du in Sarkasmus. Das ist gut zu verstehen. Ob die Geschichte eindringlicher werden könnte, wenn diese Emotionen/Aufregungen plastischer rüberkommen würden, wage ich nicht zu beurteilen.
Da würde ich wünschen,  dass noch mal kompetentere Kritiker drüber sehen. dass noch mal kompetentere Kritiker drüber sehen.
 Auch ein Grund, den Text noch mal hochzuholen. Auch ein Grund, den Text noch mal hochzuholen.
Einen Fehler habe ich noch gefunden und einige Formulierungen fielen mir auf. Ich bin noch nicht gut in Textkritik. Deshalb lass ich das. Nur die beiden Punkte noch, die mir auf die Schnelle ins Auge gefallen sind.
| Zitat: | Es reichte. Das Maß war voll. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich überlegte kurz, einfach anzuhalten und auszusteigen. Allerdings war die Realisierung dieses Gedankens, mitten auf der Autobahn bei 130 km/h, keine echte Option.
Dieser Satz wirkt auf mich etwas umständlich. Er könnte einfacher genauso wirken: Keine gute Idee bei 130km/h auf der Autobahn.
Meinen Beifahrer bei voller Fahrt aus meinem kleinen, schwarzen Twingo zu schupsen, war auch keine Alternative. |
| Zitat: | | Aber schön, dass du in jeder Lebenslage genug Gründe findest, mich vollzumotzen voll zu motzen. |
|
|
| Nach oben |
|
 |
Rosenmond
 Schneckenpost Schneckenpost

Alter: 39
Beiträge: 12
|
  27.01.2015 16:56 27.01.2015 16:56
von Rosenmond
|
  |
|
Hallo rieka,
vielen Dank für dein Feedback und deine offenen Worte. Mich hat besonders die "Flucht in den Sarkasmus" zum Nachdenken gebracht. Ich finde es total spannend, dass das beim Leser bzw. bei dir so ankommt und hätte gern gewusst, wie das auf dich wirkt. Verringert es die Authentizität? Ist es deplatziert?
Genau dieser Punkt ist ehrlich gesagt echt schwierig für mich, denn obwohl wir sicherlich einen emotionalen Marathon gelaufen sind, möchte ich nicht nur die dramatischen Seiten zeigen. Wenn ich versuche witzig zu sein, dann um die Geschichte etwas zu erden, damit man nicht nur weinen, sondern auch lachen kann. Außerdem empfinde ich viele Situationen rückblickend auch wirklich als witzig. Allerdings wirkt das evtl. total bescheuert, wenn der Humor nicht ankommt.  (Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine). (Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine).
LG
|
|
| Nach oben |
|
 |
rieka
 Sucher und Seiteneinsteiger Sucher und Seiteneinsteiger

Beiträge: 816
|
  27.01.2015 21:24 27.01.2015 21:24
von rieka
|
 |
|
Nein, die Authentizität verringert es nicht und deplatziert ist es auch nicht.
Deine Fragen und deine Begründung haben bei mir zum Überlegen geführt, was mich dazu gebracht hat, den ‚Sarkasmus‘ zu thematisieren.
| Zitat: | Deine Begründung:
dann um die Geschichte etwas zu erden, damit man nicht nur weinen, sondern auch lachen kann. |
Ich glaube, es hat eine Bedeutung, an wen du dich wendest. Bei meinem Begriff ‚Sarkasmus‘ habe ich wohl mehr an nicht betroffene Menschen gedacht und daran, diese die Nöte nachvollziehen zu lassen.
Du wendest dich aber an Betroffene. Da finde ich deinen Ton genau richtig. Denn eine Einfühlung und Übersetzung, wie sich diese Problematik anfühlt, brauchen diese nicht. Betroffene brauchen Handlungswege. Die zeigst du auf und das durch deinen Ton in einer gewissen Leichtigkeit.
LG
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 1 von 1 |
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
|






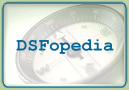





 Login
Login
 dass noch mal kompetentere Kritiker drüber sehen.
dass noch mal kompetentere Kritiker drüber sehen.