  |
|
| Autor |
Nachricht |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  18.08.2014 16:27 18.08.2014 16:27
Zeitenträumer
von Zeitenträumer
|
   |
|
|
Neue Version »
Hallo allerseits,
mein Roman mit dem Arbeitstitel Zeitenträumer spielt in verschiedenen Zeiten, weshalb die Kapitelüberschriften immer aus der Angabe der Zeit bestehen. Dies ist der Anfang des ersten Teils des Prologs im historischen Zeitstrang - nach unserer Zeitrechnung 60 v. Chr, kurz bevor Julius Caesar Gallien eroberte.
Ich bin gespannt auf Eure (schonungslose) Kritik!
Aedrini, 13. Jahr, 25. Zyklus
Die Augen des Gehörnten ruhten auf ihm, unergründlich, ewig. Der Druide betrachtete das steinerne Abbild des Gottes, halb Mensch, halb Hirsch, der mit gekreuzten Beinen dasaß, die Widderkopfschlange um den Hals gelegt.
Dich, Cernunnos, dachte er. Insgeheim fürchten sie Dich am meisten. Sie alle. Er lächelte. Ungezählt und vielgestaltig waren die Unsterblichen, doch keiner, so glaubte er, flößte den Menschen so viel Respekt ein wie der Gott mit dem Hirschgeweih: Cernunnos, der Gehörnte, Herrscher über die Anderen Welten.
Der Druide schloss die Augen. „Ich bin der ewige Strom des Flusses“, murmelte er in einer alten Sprache, die nur wenige verstanden. „Ich bin das Allessehende Auge. Ich bin die Waage der Wahrheit. Ich bin die Kraft der Eiche. Sieh durch meine Augen, o Cernunnos, sprich mit meiner Stimme, urteile durch meinen Geist, strafe, wenn es sein muss, durch meine Hand. Und es wird besser sein und nicht schlechter.“
Wie alle Barden und Druiden kannte er die Verse des Rechts, kannte sie besser als die meisten, doch Recht in dieser Welt war etwas anderes als die Gerechtigkeit des Gehörnten, die ewigen Gesetze des Alls und der Zeit. Jeder würde am Ende seines Lebens durch den Schleier in die Anderen Welten gehen, und dort entschied allein Cernunnos über das Dasein und die Wiederkehr eines jeden. Das ist es, was sie so sehr an Dir fürchten. Die Gerechtigkeit.
Der Druide seufzte. Er hatte die Pflichten, die vor ihm lagen, für einen Moment vergessen können, doch die Schatten verrieten ihm, dass es beinahe Mittag war. Wenn Belenos‘ Auge am höchsten stand, würden sich die Sippen der Haeduer auf dem Neunquell in Bibracte versammeln und von ihm erwarten, dass er Recht sprach – ein Recht, das keinem genug war, hatten doch alle zu wenig. Er kniete vor der Statue nieder, um eine letzte Bitte um Weisheit an den Gehörnten zu richten, der ihn gleichgültig anzusehen schien, als wolle er sagen: Ich sehe, die Menschen leiden, doch was soll ich tun? Sie bestimmen selbst über ihr kleines Leben in dieser Welt. Mich kümmern sie nicht, bis sie wieder durch den Schleier gehen.
Der Druide berührte mit der Linken seinen Torques, den goldenen Ring um seinen Hals, und senkte den Kopf; mit der Rechten formte er eine Schale und führte sie langsam aufwärts, bis das Handgelenk die Stirn berührte: das Zeichen der Weisheit. Dann erhob er sich, strich sein Gewand glatt und verließ das Heiligtum.
Das Gut der Sippe lag kaum eine Stunde zu Pferd von Bibracte entfernt, zwei Dutzend schmucke, mit Lehm verputzte Fachwerkhäuser auf einem flachen Hügel, geschützt durch einen palisadengekrönten Wall und einen Graben und angefüllt mit Vorräten, angesichts derer ihn beinahe ein schlechtes Gewissen plagte. Kinderstimmen drangen an sein Ohr – Dagomaros und die Kleineren vermutlich, die wieder und wieder den Krieg der Haeduer gegen die Sequaner nachspielten, allerdings mit günstigerem Ausgang als in der Wirklichkeit. Wie so oft in diesen Tagen glitten seine Gedanken ab, während er über den Hof schritt, hin zu den Geschehnissen, die alles verändert hatten. Er hatte Villú diese Ereignisse so oft wiederholen lassen, dass sie sich in seinen Erinnerungen in der leisen, ruhigen Stimme seines Schülers manifestierten.
„Vor gut sechzig Wintern, mehr als zwei Zyklen also, hatte der Stamm der Arverner, über den noch ein König herrschte wie in den alten Zeiten, die Vorherrschaft unter den Stämmen Galliens inne“, erzählte der Junge im Geist des Druiden, wobei er sich um den tragenden Tonfall der Barden bemühte. „Bituitos war der Name des Königs, und sein Reichtum kannte keine Grenzen. Als jedoch die Römer im 11. Jahr des 23. Zyklus über die Berge kamen, brach ein neues Zeitalter an. Wir, die Haeduer, schlossen rasch ein Bündnis mit ihnen, und mit unserer Hilfe besiegten die römischen Legionen Bituitos und seine Verbündeten. So wurde das letzte Königreich Galliens zerschlagen und die römische Provinz entstand. Seit dieser Zeit kam unserem Stamm die Vormachtstellung in Gallien zu. Wir kontrollierten den Handel und die Zölle am Fluss Arar, wir verteilten die Güter aus den fernen Ländern unter den Stämmen, und es war gut und nicht schlecht.“ Der Druide schmunzelte liebevoll. Villú würde wohl nie ein großer Redner werden.
„Die Zeit der Helden und die Zeit der Könige waren vergangen, und die edlen Sippen hatten die Herrschaft über die Stämme übernommen, jene, die zuvor die höchste Ehre und den größten Reichtum erlangt hatten; doch das einfache Volk verarmte unter dem Joch der Fürsten, und erste Rufe nach der Rückkehr der Könige wurden laut. Bibracte aber, die Schutzfeste unseres Stammes auf dem Berg Neunquell, wurde zu einem blühenden Handelszentrum. Unsere Korngruben waren gefüllt, niemand opferte den Göttern so reich wie wir und kein Winter konnte unsere Sippen schrecken.
Immer wieder entstand auf diese Weise Streit mit den Sequanern, dem Stamm, dessen Gebiete auf der anderen Seite des Arars liegen und der ebenfalls Anspruch auf die Zölle erhebt. Eine lange Zeit blieben wir siegreich.“
Der Druide hatte das große Wohnhaus erreicht und die Stimme in seinem Geist verstummte für einen Moment. Würde doch die Geschichte an dieser Stelle enden. Doch die Götter hatten es anders gewollt, und so verharrte er für einen Moment vor der Tür, um den Schluss der Erzählung zu hören.
„Währenddessen konnten sich die Arverner nie mit dem Verlust ihres Prinzipats abfinden. Ihr Volk litt Armut, viele der Edlen waren tief in ihrer Ehre verletzt, und schließlich geschah das Unvermeidliche: Ihr gewählter Vergobret mit Namen Celtillus erhob sich erneut zum König, wissend, das dies bei den meisten Stämmen unter der Strafe des Todes steht. Auch Celtillus musste seinen Frevel büßen; sein eigener Bruder Gobannitios richtete ihn vor dem Rat der Sippen hin. Zuvor aber hatte Celtillus sich mit den schneckenfressenden Sequanern verbündet und sie zum Krieg aufgestachelt; gemeinsam mit ihnen wollte er unsere Vorherrschaft in Gallien brechen. Obwohl er nun gefallen war, machten die Sequaner aus der Fährte eine Jagd und ließen die Kriegshörner erklingen. Zunächst konnten unsere Krieger ihre Überfälle abwehren, doch bald zeigte sich, dass die Sequaner gewillt waren, den alten Konflikt mit unserem Stamm endgültig und blutig zu entscheiden. Jenseits des breiten Stroms des Rhenos nämlich, der die Gebiete der Sequaner zum Sonnenaufgang begrenzt, herrschen die wilden suebischen Stämme – Germanen, die keinerlei Sitte und Anstand kennen. Und eben diese Sueben mit ihrem König Ariovist riefen die Schneckenfresser mit Versprechungen von Land und Beute über den Rhenos nach Gallien, um den großen Stamm der Haeduer ins Verderben zu stürzen. Zunächst wichen die feigen Germanen uns aus, versteckten sich in den Wäldern und überfielen uns aus den Schatten, doch immer mehr setzten über den Rhenos, und Ariovist überzog unsere Gebiete mit Krieg, stahl unsere Rinder und verbrannte unsere Felder.“
Vor zwei Jahresläufen war die Lage der Haeduer immer verzweifelter geworden; viele Krieger waren gefallen und es herrschten Hunger und Krankheit unter den Sippen. In jenem Jahr hatte der Druide das Amt des Vergobret innegehabt und war nach Rom gereist, um den Senat um Hilfe zu bitten. Er war Gast des Marcus Tullius Cicero gewesen, eines der edelsten Männer Roms, und überaus ehrenhaft behandelt worden, doch anstelle schlagkräftiger Legionen hatten ihm die Senatoren vage Versprechungen mit in die Heimat gegeben und nichts war geschehen. Nach diesem Misserfolg hatte er das Amt des Vergobret niedergelegt, auf Druck jener Sippen, die seine enge Verbindung zu Rom immer mit Argwohn betrachtet hatten; das Amt war auf seinen Bruder Dumnorix übergegangen, der diesen Argwohn teilte und aufgrund seines Reichtums und seiner Freigebigkeit überaus beliebt im Volk war. Auch er war jedoch machtlos gewesen: Im letztjährigen Mond des Elembiu hatte Ariovist die Haeduer bei Magetobriga vernichtend geschlagen, und spätestens seit dieser Niederlage hatte sich der Geist von Armut und Elend fest unter den Sippen eingenistet und wurde von Tag zu Tag mächtiger.
Weitere Werke von Zeitenträumer:
|
|
| Nach oben |
|
 |
Dorka
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 69
Beiträge: 391
Wohnort: Allertal
|
  18.08.2014 19:08 18.08.2014 19:08
von Dorka
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
Dein Text vermittelt sehr gut die Stimmung der Zeit, in der Deine Geschichte spielt. Einzig das Wort "kontrollieren" ist mir aufgestoßen - vielleicht liegt es aber an mir, dass ich es als modern empfinde. Dein Stil ist gut, die Sprache angemessen.
Die Idee, das Setting über eine vorgestellte Rede im Kopf des Druiden zu vermitteln, ist wirklich gut.
Aber: mir sind das für die ersten Seiten zu viele Namen. Ich bin ganz neu in dieser Welt und weiß noch nicht, was wichtig ist und was nicht. Ich versuche, alle Namen und die Relationen, in denen die Figuren zueinander stehen, zu behalten - erfolglos. Ich fühle mich überfordert durch die Menge an Informationen.
Vielleicht kannst Du den Vortrag-Monolog etwas anders schreiben? Oder ihn später bringen? Lass doch den LeserInnen etwas Zeit, sich mit dem Druiden und seiner Familie, seiner Aufgabe vertraut zu machen. Welcher Führer/König mit wem wann um was gekämpft hat, könntest Du vielleicht etwas später einführen. Wenn ich mir vorstelle, dass Du auch noch in den Zeiten springst und ich dort mit wieder anderen Figuren konfrontiert werde, deren Beziehungen und Funktionen ich behalten muss, wird mir schwindelig.
Gruß
Dorka
|
|
| Nach oben |
|
 |
Mishka
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 56
Beiträge: 54
Wohnort: NÖ
|
  19.08.2014 10:52 19.08.2014 10:52
von Mishka
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
dein Prolog erinnert mich sehr an meinen, den ich in einer ersten Fassung verzapft hatte. Ich glaubte, der Leser bräuchte all diese Informationen, um die spätere Handlung zu verstehen.
Handlung gibt es in deinem Prolog fast keine - der Druide bewegt sich von A nach B und dabei geht ihm eine Menge durch den Kopf. Meiner Meinung nach ist dies zu viel Information auf einmal.
Da ich nicht weiß, wie du den Rest der Geschichte angelegt hast, ist es schwierig, einen konkreten Vorschlag zu machen. Aber überleg mal, ob du die vielen Hintergrundinformationen nicht auch später nach und nach direkt in die Handlung einfließen lassen könntest.
Meinen Prolog habe ich letztendlich ersatzlos gestrichen.
Liebe Grüße,
Mishka
|
|
| Nach oben |
|
 |
Mermaid
 Leseratte Leseratte

Beiträge: 143
|
  19.08.2014 12:50 19.08.2014 12:50
von Mermaid
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
mir gefällt der Erzählstil, getragen, ein wenig märchenhaft. Er passt zu der Zeit.
Allerdings finde ich den Text als „Anfang des ersten Teils des Prologs im historischen Zeitstrang“ zu lang und zu sehr mit Informationen überladen. Nach wenigen Zeilen des Kursivgedruckten weiß ich nicht mehr, wer wer und wann was ist. Angenommen, der kursivgedruckte Rückblick wäre der Prolog – ich würde ihn überlesen und, falls Deine Geschichte so geplant ist, am Anfang zu lesen anfangen, womöglich dort, wo der Druide Zwiesprache mit dem Gehörnten hält und sich dann ohne allzu weitschweifige Gedanken zum Neunquell begibt, um Recht zu sprechen. Da, vor Gericht sozusagen, werden doch sicherlich Fälle entschieden, die aus der verzweifelten Lage der Haeduer resultieren, auf die Du bei der Gelegenheit entsprechend eingehen könntest …?
Eine Zeittafel und ein Personenverzeichnis solltest Du für historisch unbewanderte Leser/innen wie mich auf jeden Fall ins Auge fassen. 
Meergrüße,
Meermaid
|
|
| Nach oben |
|
 |
rieka
 Sucher und Seiteneinsteiger Sucher und Seiteneinsteiger

Beiträge: 816
|
  19.08.2014 13:43 19.08.2014 13:43
von rieka
|
 |
|
Hallo, Zeitenträumer.
Du entführst mich in eine mir fremde Welt.
Das ist spannend und gefällt mir.
Doch bei der Fülle deiner gedrängten Informationen ermüde ich schnell. Ich brauche wohl mehr Bilder, in die ich die Informationen einbauen kann.
In den Kommentaren meiner vorherigen Kritiker habe ich einige Vorschläge gesehen.
Zeittafel und ein Personenverzeichnis kann ich nur unterstützen, da könnte ich die allmähliche Konfusion beim Nachschlagen wieder ordnen.
Vielleicht wäre es auch gut, aus diesem Prolog kleinere übersichtliche Kapitel zu machen.
Aber ich verstehe noch zu wenig von den Techniken des Aufbaus eines Buches und weiß auch nicht, wie du es dir weiter gedacht hast.
Nimm aus meiner Kritik was du brauchen kannst.
rieka
|
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  19.08.2014 14:58 19.08.2014 14:58
von Zeitenträumer
|
  |
|
Hallo zusammen, ein herzliches Dankeschön für Eure Meinungen!
Ok, ok, diese Kritik höre ich natürlich nicht zum ersten Mal  ...un sehe sie auch ein. ...un sehe sie auch ein.
Ich habe vorbildlich die Regeln gelesen und daher nur einen kurzen Teil gepostet - das war vielleicht nicht so klug. 
Daher habe ich jetzt a) den historischen Hintergrund erstmal eingedampft - zum Glück muss ich noch nicht den ganzen Prolog streichen, denn etwas Handlung gibt es schon noch - und b) den gesamten "historischen" Teil gepostet. Ich hoffe das ist nicht zu lang für dieses Forum.
Ach so, und eine Personenliste gibt es, allerdings noch nicht vollständig. Kommt.
Aedrini, 13. Jahr, 25. Zyklus
Die Augen des Gehörnten ruhten auf ihm, unergründlich, ewig. Der Druide betrachtete das steinerne Abbild des Gottes, halb Mensch, halb Hirsch, der mit gekreuzten Beinen dasaß, die Widderkopfschlange um den Hals gelegt.
Dich, Cernunnos, dachte er. Insgeheim fürchten sie Dich am meisten. Sie alle. Er lächelte. Ungezählt und vielgestaltig waren die Unsterblichen, doch keiner, so glaubte er, flößte den Menschen so viel Respekt ein wie der Gott mit dem Hirschgeweih: Cernunnos, der Gehörnte, Herrscher über die Anderen Welten.
Der Druide schloss die Augen. „Ich bin der ewige Strom des Flusses“, murmelte er in einer alten Sprache, die nur wenige verstanden. „Ich bin das Allessehende Auge. Ich bin die Waage der Wahrheit. Ich bin die Kraft der Eiche. Sieh durch meine Augen, o Cernunnos, sprich mit meiner Stimme, urteile durch meinen Geist, strafe, wenn es sein muss, durch meine Hand. Und es wird besser sein und nicht schlechter.“
Wie alle Barden und Druiden kannte er die Verse des Rechts, kannte sie besser als die meisten, doch Recht in dieser Welt war etwas anderes als die Gerechtigkeit des Gehörnten, die ewigen Gesetze des Alls und der Zeit. Jeder würde am Ende seines Lebens durch den Schleier in die Anderen Welten gehen, und dort entschied allein Cernunnos über das Dasein und die Wiederkehr eines jeden. Das ist es, was sie so sehr an Dir fürchten. Die Gerechtigkeit.
Der Druide seufzte. Er hatte die Pflichten, die vor ihm lagen, für einen Moment vergessen können, doch die Schatten verrieten ihm, dass es beinahe Mittag war. Wenn Belenos‘ Auge am höchsten stand, würden sich die Sippen der Haeduer auf dem Neunquell in Bibracte versammeln und von ihm erwarten, dass er Recht sprach – ein Recht, das keinem genug war, hatten doch alle zu wenig. Er kniete vor der Statue nieder, um eine letzte Bitte um Weisheit an den Gehörnten zu richten, der ihn gleichgültig anzusehen schien, als wolle er sagen: Ich sehe, die Menschen leiden, doch was soll ich tun? Sie bestimmen selbst über ihr kleines Leben in dieser Welt. Mich kümmern sie nicht, bis sie wieder durch den Schleier gehen.
Der Druide berührte mit der Linken seinen Torques, den goldenen Ring um seinen Hals, und senkte den Kopf; mit der Rechten formte er eine Schale und führte sie langsam aufwärts, bis das Handgelenk die Stirn berührte: das Zeichen der Weisheit. Dann erhob er sich, strich sein Gewand glatt und verließ das Heiligtum.
Das Gut der Sippe lag kaum eine Stunde zu Pferd von Bibracte entfernt, zwei Dutzend schmucke, mit Lehm verputzte Fachwerkhäuser auf einem flachen Hügel, geschützt durch einen palisadengekrönten Wall und einen Graben und angefüllt mit Vorräten, angesichts derer ihn beinahe ein schlechtes Gewissen plagte. Kinderstimmen drangen an sein Ohr – Dagomaros und die Kleineren vermutlich, die wieder und wieder den Krieg der Haeduer gegen die Sequaner nachspielten, allerdings mit günstigerem Ausgang als in der Wirklichkeit; denn die Sequaner hatten mit Versprechungen den Suebenkönig Ariovist über den Rhenos gerufen, dessen Krieger die Felder der Haeduer verwüsteten und ihre Rinder stahlen. Vor zwei Jahresläufen war die Lage der Haeduer immer verzweifelter geworden; viele Krieger waren gefallen und es herrschten Hunger und Krankheit unter den Sippen. In jenem Jahr hatte der Druide das Amt des Vergobret innegehabt und war nach Rom gereist, um den Senat um Hilfe zu bitten. Er war Gast des Marcus Tullius Cicero gewesen, eines der edelsten Männer Roms, und überaus ehrenhaft behandelt worden, doch anstelle schlagkräftiger Legionen hatten ihm die Senatoren vage Versprechungen mit in die Heimat gegeben und nichts war geschehen. Nach diesem Misserfolg hatte er das Amt des Vergobret niedergelegt, auf Druck jener Sippen, die seine enge Verbindung zu Rom immer mit Argwohn betrachtet hatten; es war auf seinen Bruder Dumnorix übergegangen, der diesen Argwohn teilte und aufgrund seines Reichtums und seiner Freigebigkeit überaus beliebt im Volk war. Auch er war jedoch machtlos gewesen: Im letzten Jahr hatte Ariovist die Haeduer bei Magetobriga vernichtend geschlagen, und spätestens seit dieser Niederlage hatte sich der Geist von Armut und Elend fest unter den Sippen eingenistet und wurde von Tag zu Tag mächtiger.
Es war Dumnorix gelungen, Frieden mit Ariovist und den Sequanern zu schließen – einen Frieden, der die Haeduer teuer zu stehen kam. Die Reichen mussten Geiseln stellen und Tribut entrichten und deshalb noch höhere Abgaben von ihren Gefolgsleuten, Schuldnern und Hörigen fordern, um deren Schutz gewährleisten zu können, jedenfalls behaupteten sie das; denn sie hatten die Kontrolle über den Arar verloren, auf der ihr Wohlstand beruhte. Und keinem schadete dies so sehr wie Dumnorix selbst, hatte er doch einen großen Teil der Arar-Zölle über mehrere Winter hinweg gepachtet.
Entgegen seinem ursprünglichen Vorhaben betrat der Druide das Wohnhaus nicht. Er hatte nach Villús Fortschritten sehen wollen, doch in letzter Zeit war ihm immer häufiger danach, allein zu sein; gerade die Gegenwart Villús, der insgeheim immer sein Lieblingssohn gewesen und nun, wie er es sich erhofft hatte, sein Schüler geworden war, bedrückte ihn auf unerklärliche Art und Weise. Er kehrte dem Eingang den Rücken und ging um das Haus herum zu den Stallungen. Tala, Villús Lieblingspferd, tänzelte nervös und schnaubte, als er näherkam; der Druide tätschelte ihr abwesend die Nüstern und schob sich an ihr vorbei, um Prito zu satteln. Welch seltsame Schwermut mir der heutige Tag gebracht hat, dachte er. Oder ist es nicht vielmehr seltsam, dass ich so selten davon ergriffen werde? Gewiss, er verteilte unter den Gemeinen und Hörigen des Stammes, doch das war nichts im Vergleich zum Leid der Menschen. Dumnorix gab zwar umso mehr, war er doch ungleich reicher, doch der Druide wusste, dass sein Bruder einzig und allein seinen Einfluss zu stärken trachtete und dass seine Gaben die Not in Wahrheit eher mehrten denn minderten. Oft bereute er, Dumnorix den Weg an die Spitze der Macht geebnet zu haben, doch wer konnte den Stamm in diesen Zeiten besser führen als er?
Abermals seufzend schwang er sich auf Pritos Rücken. „Komm, alter Freund“, sagte er und klopfte den Hals des Rappen. „Was immer der Lauf der Zeiten am heutigen Tag bringen mag, wir werden es doch nur erfahren, wenn wir dabei sind.“
Er hing seinen Gedanken nach, und so dauerte es eine Weile, bis er sich der drei Reiter bewusst wurde, die nebeneinander auf dem Weg verharrten als warteten sie auf ihn. Er war ihnen schon recht nahe gekommen, sodass ihm wenig Zeit blieb, sie einzuschätzen, doch es handelte sich offensichtlich um Römer, von kleinerer Statur als die Kelten, kurzhaarig und rasiert und in edle Togen gekleidet. Er kniff die Augen zusammen und erkannte zu seiner Überraschung den Mittleren der drei, einen etwa fünfzig Winter zählenden Mann mit gutmütigem Gesicht und leichtem Bauchansatz: Lucius Valerius Flaccus. Er war der Neffe des einstigen Statthalters der römischen Provinz in Gallien, und Diviciacos hatte ihn einige Male in Narbo getroffen, als er mit den römischen Machthabern verhandelt und Kontakte geknüpft hatte. Die Valerii Flacci waren eine der einflussreichsten römischen Familien in Gallien und Hispania, und auch Lucius hatte verschiedene mächtige Ämter bekleidet. Diviciacos‘ ältester Sohn Vertoris, der in Narbo lebte, um die Kultur und Lebensweise der Römer zu studieren und die Freundschaft zwischen ihnen und den Haeduern zu festigen, hatte ihn als klugen Staatsmann beschrieben, jedoch auch angedeutet, es gebe Gerüchte um eine dunkle Vergangenheit Flaccus‘ in den Ländern des Sonnenaufgangs. Seine Begleiter waren jünger und Diviciacos nicht bekannt; ihm schien, als sei einer der beiden gallischer Herkunft, denn sein Haupt war von dichtem blonden Haar bedeckt, wenn es auch nach römischer Mode frisiert war.
Er brachte Prito zum Stehen und hob die Hand zum Gruß, wie es in Rom Sitte war. Flaccus beugte sich zu dem Blonden hinüber und sagte etwas in römischer Sprache, die Diviciacos trotz seiner langjährigen Erfahrung mit den Italikern nur bruchstückhaft beherrschte. Der junge Mann grüßte zurück; Diviciacos bemerkte, dass er ein überaus energisches Kinn und stechende, blaue Augen hatte.
„Seid gegrüßt, Diviciacos, Sohn des Segomo“, rief er auf gallisch. „Möge die Freundschaft zwischen Rom und den Haeduern so lange andauern wie die Zeit. Ich, Gaius Valerius Trocillus, spreche für Lucius Valerius Flaccus, den Gesandten des römischen Senats. Wir bringen eine wichtige Botschaft für den Stamm der Haeduer.“
Trocillus? Diviciacos suchte in seinem Gedächtnis nach einer Erinnerung, und wie üblich fand er sie. Trocillus, Sohn des Caburus, vom Stamm der Helvier in der römischen Provinz. Gemeinsam mit seinem Vater vertritt er die Helvier im Magistrat. Er senkte den Kopf. „Esos schütze Euch auf Euren Wegen“, sagte er. „Wenn es sich um eine wichtige Nachricht für unseren Stamm handelt, so sollte sie dem Rat der Sippen vorgetragen werden.“
Wieder beugte sich Flaccus zu seinem Übersetzer und redete ruhig auf ihn ein. Diviciacos beobachtete die beiden genau und wurde auf einmal von einer unguten Vorahnung beschlichen; er spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufrichteten.
„Wir werden zum Rat sprechen, o Diviciacos“, sagte Trocillus. „Doch es gibt eine weitere Botschaft, die nur für Eure Ohren bestimmt ist. Daher kamen wir ohne Gefolge, um Euch allein zu sprechen.“
Der Mann hatte eine lauernde Art, die Diviciacos in keiner Weise gefiel. Sein Mund war auf einmal trocken.
„Ich bin auf dem Weg nach Bibracte, um Gericht zu halten“, sagte er. „Ihr müsst verstehen, dass meine Pflichten keinen Aufschub dulden.“
„So haltet Gericht“, erwiderte Trocillus; offenbar vertraute Flaccus seinem Übersetzer und ließ ihm weitgehend freie Hand. „Wir werden auf Euch warten.“
Diviciacos war froh, die Römer zunächst vertröstet zu haben, doch ihm war, als verfolge ihn der berechnende Blick des Römers bis zu den Mauern Bibractes.
Es war kühl und dunkel im Nemeton, dem heiligen Eichenhain auf der Kuppe des Neunquell. Düster blickten die Götter zwischen den knorrigen Bäumen hindurch, als beobachteten sie in stiller Drohung jede kleine Handlung der Druiden am Opferschacht, stets bereit, ihren Zorn über die Sterblichen zu bringen. Jeder unter den Haeduern wusste eine Geschichte über diesen Ort zu erzählen, eine beunruhigender als die andere. Es hieß, es lebten dort keine Vögel und Tiere, lediglich die Hüter des Haines und die heiligen Schlangen in den Blätterkronen würden von den Unsterblichen geduldet. Das Laub der alten Bäume zittere unaufhörlich, sagten andere, auch wenn kein Wind blies, und man könne das Stöhnen der Erde und die Todesschreie der ungezählten Opfer hören, deren Blut sich über die Stämme der Eichen ergossen hatte. Viele schauderte es beim bloßen Gedanken an diesen Ort, an dem ewiger Schatten herrschte, und keiner von ihnen hätte jemals gewagt, ihn zu betreten. Der Druide wusste nicht, wie viel Wahrheit in diesen Legenden lag. Wenn er zwischen den Bäumen wandelte, konnte er die Gegenwart der Götter spüren, doch er empfand sie nicht als bedrohlich – im Gegenteil, der heilige Hain übte stets eine beruhigende, erfrischende Wirkung auf ihn aus. Er warf einen Blick zu den Hütern; jeder der beiden erfahrenen Priester hielt einen Falken auf dem Unterarm und sie warteten geduldig, bis er sein stilles Gebet beendet hatte.
Eine Menschenmenge hatte sich vor dem Hain versammelt, auf dem von hohen Bäumen und einer Palisade gesäumten Platz, wo die Barden und Druiden Recht sprachen und der Rat der Sippen zusammentrat, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Hüter verharrten am Rande des Hains, während der Druide den flachen Felsen erklomm, den die Haeduer den Stein der Worte nannten, da bei Versammlungen die Redner von ihm aus zum Volk sprachen. Er betrachtete die Wartenden; es waren größtenteils ärmere Gemeinfreie, Handwerker und Bauern, die den Schiedsspruch der Weisen suchten, jene, die gerade noch so viel hatten, dass es nicht zum Aufgeben reichte. Ihre Kleider waren einfach, und wenn auch die einen nach gallischem Brauch in Hosen, die anderen nach römischer Mode in Tunika erschienen waren, so glichen sich ihre Gewänder doch auf merkwürdige Art und Weise, denn die Farben der abgewetzten Stoffe waren längst verblichen und verschmolzen zu einer einförmigen Masse. Unruhig, unter gedämpftem Gemurmel, traten sie von einem Fuß auf den anderen und warfen scheue Blicke in seine Richtung. Er spürte eine gleichgültige Hoffnungslosigkeit, die von ihnen ausging, als hätten sie sich bereits mit dem Unvermeidlichen abgefunden und kämpften nur noch aus Gewohnheit weiter. Und dies sind nicht einmal die Ärmsten, kam es ihm in den Sinn. Gegen solches Elend sind selbst die Götter machtlos. Er schlug viermal mit dem Stab auf den Boden, um sich Gehör zu verschaffen.
„Esos schütze euch auf euren Wegen“, rief er laut. „Ihr, die ihr gekommen seid, um Recht zu erfahren, hört dies: Ich, Diviciacos, Sohn des Segomo, Erster Druide der Haeduer, Träger des Eichenstabes und Mitglied des Hohen Rates des Nemeton, kenne die Verse der Gerechtigkeit und die Zeichen des Schicksals. Wer gegen das Gesetz des Stammes verstößt, erzürnt die Götter und soll dafür büßen, auf dass ihr Zorn nicht seine Stammesbrüder treffe.“ Prüfend ließ er seinen Blick über die Menge gleiten; die Menschen sahen mit ernsten Mienen zu ihm auf. „So legt nun die Kränze nieder zu Ehren Esos‘ des Allwissenden, der den Menschen das Wort brachte und der seine Hand über die Sippen der Haeduer hält.“
Viele hatten aus Zweigen geflochtene Kränze mitgebracht, welche sie nun einer nach dem anderen zu Füßen der Hüter ablegten, die ruhig am Rande des Hains warteten. Die beiden Priester packten die Falken mit einer schnellen Bewegung im Nacken; Diviciacos war der Vorgang so vertraut wie sein tägliches Bad in den Quellen, denn er hatte dies viele Male selbst getan: Er sah, wie die Vögel sich hilflos zu wehren versuchten, konnte förmlich spüren, wie ihr Gefieder unter panischen Atemzügen bebte und das kleine Herz wild klopfte. Rasch zogen die Hüter mit der freien Hand goldene, sichelförmige Messer vom Gürtel und ließen die scharfen Klingen über die Kehlen der Falken gleiten, nur so tief, dass das Blut in sanften, gleichmäßigen Schüben herausquoll. Ein Stöhnen ging durch die Menge; viele bewegten die Lippen im Gebet. Die Priester knieten nieder und benetzten achtsam jeden der Kränze mit dem Blut der Falken, während die Geister der Vögel auf ihre Reise durch den Schleier gingen und die Körper in den Händen der Druiden erschlafften.
„Belenos, Allsehender, der du jede Unwahrheit erkennst!“, rief Diviciacos. „Esos, Gütiger, dessen Samen unser Stamm entsprungen ist! Lasst meinen Geist klar sein, auf dass ich Euren Willen zu erkennen und weise zu entscheiden vermag. Ich, Diviciacos, Sohn des Segomo, Sohn des Cerdicis, gelobe bei den Göttern und den Ahnen, jeden zu beurteilen, wie es seinen Taten und seinem Stand gemäß ist.“
Natürlich wusste er bereits, welche Streitfälle zur Sprache kommen würden. Es kostete ihn keine Mühe, sich die Namen aller Beteiligten zu merken; niemals musste er etwas ein zweites Mal hören, um es sich einzuprägen. Er kannte die Namen unzähliger Tiere und Pflanzen ebenso wie die Legenden der Stämme und mancher fernen Völker; er wusste vom Lauf der Gestirne und ihrer Bedeutung für das Schicksal der Menschen; er konnte Krankheiten heilen und Wunden verbinden und dafür sorgen, dass eine Kuh fruchtbar wurde. Vor allem aber waren die unzähligen Verse der Zwölf Mysterien tief in sein Gedächtnis eingebrannt, so tief, dass es keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und seinem eigenen Geist gab.
Er hieß jene vortreten, die etwas vorzubringen hatten. Das Gesetz gebot, dass die Sippe, deren Ehre den höchsten Preis hatte, ihr Anliegen zuerst schildern durfte, ein Brauch, der bereits häufig zu Streit im Vorfeld eines Gerichts geführt hatte, doch in diesem Fall gab es keinen Zweifel. Er betrachtete die, welche sich aus der Menge gelöst hatten und suchte denjenigen, dessen Ehrenpreis weit über dem der anderen lag: Biracos, einen reichen Landbesitzer und Veteran einiger Schlachten, der zur Klientel des Dumnorix zählte. Seine Sippe gehörte zwar nicht zu den edelsten, doch stand ihm immerhin ein Sitz an der Ratstafel zu, und so gebot der Brauch, dass sein Anliegen Vorrang hatte. Wie es sich für einen Mann seines Standes gehörte, war Biracos mit Gefolge und einigen Verwandten erschienen, alle hochgewachsen und blond; er selbst mochte vierzig Winter zählen und stand in lässiger Haltung in ihrer Mitte. Als Anhänger des Dumnorix war er naturgemäß römerfeindlich gesinnt und trug daher nach gallischer Mode eine hellrot karierte Hose, ein ebensolches, ärmelloses Wams und einen gebleichten Schnurrbart; um seinen Hals lag ein schmaler, goldener Torques.
„Biracos, Sohn des Vindios“, rief Diviciacos laut. „Ihr seid gekommen, um die Verse des Rechts zu hören, die doch nichts anderes sind als der Wille der unsterblichen Götter. Wer wird für Euch sprechen?“
Die Mundwinkel des Kriegers kräuselten sich unter dem Schnurrbart leicht nach oben und er deutete eine Verbeugung an. „Eluskú, mein ältester Sohn, der im Gefolge des Eporedorix reitet, o Diviciacos“, verkündete er mit raspelnder Stimme.
Es war offensichtlich, dass der Mann die Ehre seiner Sippe herausstellen wollte, um ein günstigeres Urteil zu erzielen. Eporedorix, der Reiterkönig, war der Anführer der vielköpfigen Reitertruppe, die Dumnorix sich hielt und mit eigenem Gold entlohnte und verpflegte, sodass sie sich ganz dem Kampf hingeben konnte. Er entstammte einer der edelsten Sippen, und es bedeutete eine hohe Ehre, in sein persönliches Gefolge aufgenommen zu werden. Eluskú, Sohn des Biracos, musste ein begnadeter Reiter sein.
Ob Ihr ein ebenso guter Redner seid?, dachte Diviciacos stirnrunzelnd. Er musterte den jungen Mann, der neben seinem Vater stand, die hellblonden Haare mit geflochtenen Zöpfen zusammengebunden, und hatte seine Zweifel. Ich würde bei allen Eichen schwören, dass Ihr noch keine zwanzig Winter gesehen habt.
„So sei es“, sagte er ruhig. „Bringt also Euer Anliegen vor, Eluskú, Sohn des Biracos.“
Der junge Krieger trat vor und warf den Kopf in den Nacken. „Ich bin Eluskú, Sohn des Biracos!“, rief er. „Bei Magetobriga erschlug ich acht Feinde, darunter drei Germanen! Ich reite in der Schar des Eporedorix, und den will ich sehen, der schneller und besser reitet als ich!“ Voller Eifer sah er in die Runde. „Ich spreche vor dem heiligen Hain der Götter für meine Sippe und meinen Vater Biracos, Sohn des Vindios, dem Unrecht geschehen ist. Unrecht durch jenen dort, der sich Licnos nennt!“ Abrupt wandte er sich um und deutete auf einen kleinen, blassen, untersetzten Mann von etwa dreißig Wintern, der nervös seinen Schnurrbart zwirbelte und rasch den Blick senkte, als sich ihm die Augen des Druiden und der versammelten Menge zuwandten.
„Sprecht weiter. Welche Art von Unrecht?“
„Seht ihn Euch an!“, sagte Eluskú abfällig. „Dieser Mann ist Bauer und Hirte. Er besitzt ein wenig Land und einige Schweine und Rinder. Seit vielen Jahren erhält er Schutz von meiner Väter Sippe, ohne den die seine verloren wäre. Mein Vater war sogar so gütig, ihm den besten Bullen aus seiner eigenen Zucht zu leihen, auf dass seine Herde gedeihe.“
Es verlangte Diviciacos danach, den arroganten jungen Krieger zurechtzuweisen, jedoch verbarg er seine Gefühle; es war für ihn nicht mehr als Gewohnheit, sich nichts anmerken zu lassen. „Wie hoch sind die Abgaben, die seine Sippe der Euren für ihren Schutz zahlt?“
„Geradezu frevlerisch gering, o Diviciacos. Jeden Mond zur Rückkehr der Nacht ein Sechst seines Weizens und seiner Milch, und zum Samon, wie es sich gehört, ein Prachtschwein.“
„Ist er Euch etwas schuldig geblieben?“
Eluskú starrte ihn an, als sei er nicht recht bei Trost. „Bei den Neun Quellen, seht ihn Euch an! Er ist fett! Er lässt sich gehen und schmäht auf diese Weise die Götter! Er bringt Schande über die Sippe meiner Väter, und wie sollte er in diesem Zustand anständig arbeiten? Wir verlangen, dass sein Bauchumfang abgemessen wird, und zwar mit mittleren Linsen, so wie es der Ehre unserer Sippe entspricht! Für jede Linse soll er ein Kalb geben, um den Schaden zu ersetzen!“
Das waren die Worte, die zu sagen man ihm eingebläut hat, dachte Diviciacos. Welch törichter Fehler, einen solch einfältigen Jungen zum Sprecher der Sippe zu erklären, nur weil er eine ehrenhafte Stellung einnimmt. Trotz aller Selbstbeherrschung, die er sich in jahrelanger, harter Übung angeeignet hatte, fiel es ihm schwer, ruhig zu bleiben. Zwar gab es im Gesetz des Stammes die Möglichkeit, Fettleibigkeit zu bestrafen, aber dies war nichts anderes als ein dreister Versuch, einen hilflosen Mann zu enteignen und zu versklaven. Licnos, der Bauer, war sicherlich außerstande, eine solche Strafe zu begleichen; er würde Teile seines kärglichen Besitzes verpfänden müssen und bald immer tiefer in der Schuld der reichen Sippe stehen, schließlich weder Abgaben noch Schulden mehr aufbringen können und letzten Endes seinen Torques und damit seine Freiheit verlieren. Diviciacos hatte häufig machtlos zugesehen, wie solcherlei geschah. Er atmete tief durch. Am heutigen Tag würde er die Verse gemäß der Gerechtigkeit des Cernunnos auslegen.
„Ihr seid gut beraten worden, Eluskú, Sohn des Biracos“, sagte er bedächtig. „Nicht viele kennen die Verse des Rechts so genau, dass sie ein solches Vergehen mit einer angemessenen Sühne belegen können.“
Der stämmige Bauer stieß einen spitzen Schrei aus und fiel auf die Knie. „Ich flehe Euch an, o Diviciacos…“
„Schweigt!“, fuhr ihn der Druide an „Es ist nicht gut, zwei Geschichten gleichzeitig zu hören.“ Er sah Eluskú in die Augen; ein Lächeln spielte um den Mund des jungen Kriegers.
„Er hat Euch also Käse, Milch und Schwein geliefert?“, fragte Diviciacos.
„Das wohl“, gab Eluskú zögernd zu. Das Lächeln verschwand.
„Dann nehme ich an, Eure Sippe wurde in ihrer Ehre verletzt, indem man Euch seinetwegen beleidigte und verspottete? Es fiel Euch, seit er so fett ist, immer schwerer, eure Töchter zu verheiraten?“
Der Krieger zuckte kurz und setzte zu einer zornigen Entgegnung an, beherrschte sich jedoch und verschränkte die Arme vor der Brust. „Er stellt durch seine schiere Gestalt eine Beleidigung unserer Ehre dar.“
„Erlaubt mir eine Frage, junger Reiter“, fuhr Diviciacos fort. „Welchen Bauchumfang, glaubt Ihr, sollte ein Mann haben?“
Eluskú legte die Stirn in Falten. „Was? Ich… nun, er sollte ein Ebenbild der Götter sein, denen er entstammt!“, rief er verärgert.
„So wie Ihr?“
„So wie ich oder jeder andere hier!“
Diviciacos nickte. „Dann wird Euch sicherlich klar sein, dass ich nicht seinen gesamten Bauchumfang messen kann, da Ihr ihm schwerlich vorwerfen wollt, überhaupt einen Bauch zu haben, nicht wahr? Entscheidend ist vielmehr der Unterschied zwischen seinem und einem Leib wie… nun ja, dem Euren, Eluskú.“
„Dem meinen?“
„Ihr begreift beinahe so schnell, wie Ihr reitet“, sagte Diviciacos. „Wer könnte besser mit seinem Körper als Bild der Götter dienen als ein Reiter des Eporedorix?“ Er ließ seine Worte ihre Wirkung im Geist des verblüfften Kriegers tun und wandte sich dem Bauern zu, der immer noch auf den Knien lag. „Nun zu Euch – Licnos, Sohn des Vectitos, nicht wahr? Steht auf.“ Der Mann kam unsicher auf die Beine und starrte ihn aus seinem feisten, blassen Gesicht heraus an, die Augen weit geöffnet und die Lippen fest aufeinander gepresst. „Wie kam es, dass Ihr eine solche Leibesfülle annahmt? Warum esst Ihr nicht weniger und übt Euren Körper? Wisst Ihr nicht, dass der Geist leidet, wenn der Leib schwach ist?“
„Ich… weiß es, o Diviciacos“, stammelte der Mann. „Doch die Götter entschieden, mir einen Gaumen zu geben, der Käse liebt, und einen Körper, durch den der Käse gleich zu den Hüften wandert.“
Die Umstehenden kicherten, und auch Diviciacos unterdrückte ein Schmunzeln. Er bemerkte, dass sich Unruhe unter Biracos‘ Gefolge verbreitete; einige murrten leise. Eluskús Gesicht nahm eine leicht rötliche Färbung an. „Was erlaubt sich diese Kreatur?“, rief er laut. „Ist es…“
„Schweigt!“ Diviciacos stieß den Stab auf den Boden, um für Ruhe zu sorgen. „Wie ich schon sagte, es ist nicht gut, zwei Geschichten gleichzeitig zu hören.“ Er wartete einen Moment, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. „Euer Vorschlag, Eluskú, scheint mir jedoch gerecht: Wir messen Licnos‘ Bauch und den Euren, Sohn des Biracos. Den Unterschied werden wir als Maß für die Strafe heranziehen, den Licnos zu leisten hat. Ist eine der Sippen mit diesem Vorgehen nicht zufrieden, steht es ihr frei, den Rat der Sippen anzurufen und ein Urteil des Vergobret zu fordern.“ Die Männer schwiegen und Diviciacos nickte befriedigt. „Entblößt Euch.“
Der junge Krieger zögerte kurz und warf seinem Vater einen schnellen Blick zu. Dann streckte er die Brust heraus und warf den Kopf in den Nacken. Betont lässig winkte er einen Waffenträger heran, der ihm half, den gehärteten Lederpanzer und den Schwertgurt abzunehmen. Er zeigt seinen Körper gern, dachte Diviciacos grimmig. Es schien ihm, als lege Eluskú mit seiner Kleidung auch die Unsicherheit ab, die ihn kurz befallen hatte. Nachdem seine Schultern entblößt waren, zog er mit einer ruckartigen Bewegung die hochgeschnürte Hose auf die Hüften herunter und sah mit hochgerecktem Kinn in die Menge. Diviciacos stellte befriedigt fest, dass er einen beeindruckenden Brustkorb und beachtliche Muskeln hatte. Auch Licnos, der Bauer, hatte sein Wams abgelegt und nestelte an seinem Hosenbund; sein bleicher, aufgequollener Wanst bereitete ihm sichtlich Unbehagen.
Diviciacos wandte sich einem der Hüter zu. „Es soll Eure Aufgabe sein, den Umfang der Leiber dieser beiden zu messen, Alisanos“, sagte er ruhig. „Messt sorgfältig und genau, das Band gerade über dem Nabel.“
Der Angesprochene, ein erfahrener Druide von mehr als vierzig Wintern mit bereits ergrautem Bart, trat zunächst zu dem Hirten und legte dem vor Angst schlotternden Mann ein Lederband um den Wanst. Er machte einen Knoten hinein, um den Umfang zu markieren, und wiederholte die Prozedur bei Eluskú, der mit vor der Brust verschränkten Armen wartete. Diviciacos beobachtete Biracos und seine Sippe genau; erst jetzt schien ihnen aufzugehen, dass der Druide sie getäuscht hatte, denn da Eluskú den dicklichen Hirten beinahe um Haupteslänge überragte und von kräftiger Statur war, lagen die beiden Knoten erstaunlich nah beieinander, als der Hüter das Band in die Höhe hielt. Ein Schrei der Empörung ertönte und auch Eluskú gab einen erstaunten Laut von sich. Die Menge tuschelte gespannt.
Diviciacos stieß den Stab auf den Fels bis die Rufe verstummten. „Bleibt noch, den Abstand zwischen den beiden Knoten zu messen“, fuhr er unbeirrt fort. „Wie Ihr, Eluskú, vorhin selbst sagtet, ist Eurer Sippe weder Schaden entstanden noch wurde Eure Ehre verletzt, wohl aber, darin habt Ihr Recht, das Gesetz des Stammes. Die Verse schreiben für einen solchen Fall vor, die Strafe mit gewöhnlichen Bohnen zu bemessen. Sie soll in kleinem Kupfer beglichen und am Brunnen der Kraniche dem Esos dargebracht werden.“ Er tat weitere vier Schläge mit dem Stab, um sein Urteil zu bekräftigen, und stieg langsam von dem Felsen hinunter. „Alisanos, Ihr werdet den Abstand gewissenhaft abmessen, Bohne für Bohne. Ihr, Licnos, Sohn des Vectitos, nehmt das Lederband mit Euch. Zur Trinoux Samonis werden wir Euch erneut vermessen und sehen, ob sich Eure Statur gebessert hat. Und wagt nicht, die Knoten zu versetzen – ich würde es merken, und wenn nicht ich, so die Unsterblichen.“ Abrupt wandte er sich Biracos zu. Die Kiefer des Züchters mahlten vor Wut und sein Schnurrbart zitterte, doch er wagte nicht, dem Urteil des großen Druiden zu widersprechen. Diviciacos senkte die Stimme, sodass nur die Umstehenden ihn verstehen konnten. „Noch etwas, Biracos“, raunte er. „Wenn Ihr noch einmal mit einer solchen Lächerlichkeit meine Zeit verschwendet, werde ich für jeden Zwölft einer Stunde ein Kalb von Euch fordern.“
Er entschied an diesem Nachmittag noch in vielen weiteren Fällen, und die Sonne stand tief, als die Menge sich zu zerstreuen begann. Erschöpft wandte sich Diviciacos dem Nemeton zu, um den Göttern im kühlen Dunkel des Hains seinen Dank auszusprechen. Er verabschiedete sich von den Hütern und machte sich auf den Heimweg, ritt den Hang des Neunquell hinunter durch die Stadt, vorbei an den von länglichen Mauern eingepferchten Häuschen, in denen die Pferde und Dienerschaft der Edlen untergebracht wurden. Die Arbeit in den Werkstätten der Hammerschmiede, Gießer und Metallarbeiter zu seiner Linken war bereits zum Erliegen gekommen.
Bibracte machte einen friedlichen Eindruck in der abendlichen Sonne, doch Diviciacos fühlte sich, als trage er einen Felsblock von der Größe des Steins der Worte um den Hals und reite gegen einen mächtigen Sturm. Er vermied den Blick auf den vor ihm liegenden steinigen Hügel, den die Haeduer schlicht duron, nannten, Festung, und der auch jetzt noch, beinahe ein Jahr nach Ende des Krieges, mit den Zelten der Flüchtlinge aus den umliegenden Siedlungen und Gehöften übersät war, den kümmerlichen Behausungen jener, deren Atem schon seit vielen Nächten nicht mehr nach Cervisia gerochen hatte. Rasch wusch er Hände und Gesicht an der Quelle der Tränen und lenkte Prito auf direktem Wege zum inneren Tor, doch erst als er auch den äußeren Wall passiert hatte, begann die Anspannung des Gerichts von ihm abzufallen. Er konzentrierte seine Sinne auf die Natur um ihn herum, ließ den Gedanken an all das Elend und die Not der Menschen freien Lauf, bis sie sich langsam zerstreuten, sein Geist sich leerte und mit neuen Bildern, Klängen und Gerüchen füllte, Eindrücken, die nichts bedeuteten, sondern schlicht waren.
Die Römer hatten ihre Pferde festgebunden und warteten an dem kleinen Bach, an dem er sie verlassen hatte. Sie erhoben sich, als er sich näherte, und Trocillus trat ihm entgegen.
„Es ist gut, dass Ihr gekommen seid, o Diviciacos. Die Freundschaft zwischen Rom und den Haeduern ist beiderseits ein hohes Gut, das wir pflegen wollen wie unsere eigenen Kinder, nicht wahr?“
Droht er mir?, fragte sich Diviciacos, oder verspottet er mich nur? Er wollte dieses Gespräch schnell hinter sich bringen. „So sprecht“, sagte er daher ohne jede Höflichkeitsformel. „Welche Kunde sendet der Senat den Haeduern, die zu geheim für die Ohren des Vergobret ist?“ Er wusste, dass er schon mit dieser Frage das Gesetz des Stammes verletzte, doch etwas im Verhalten der drei Gesandten veranlasste ihn, sie anzuhören. Nach kurzem Wortwechsel mit Flaccus ergriff Trocillus erneut das Wort.
„Genau gesagt, stammt unsere Botschaft nicht vom Senat. Sie stammt vom künftigen Statthalter der gallischen Provinzen. Ihr werdet von ihm gehört haben; sein Name ist Gaius Iulius Caesar.“
Sie sprachen eine Weile, und als Diviciacos einige Zeit später seinen Heimweg fortsetzte, war sein Herz von Angst und Hoffnung gleichermaßen erfüllt. Die kommenden Nächte und Winter würden für die Haeduer nicht einfacher werden als die vergangenen, doch vielleicht hatten die Götter sich doch noch nicht gänzlich von ihnen gewandt.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Mishka
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 56
Beiträge: 54
Wohnort: NÖ
|
  19.08.2014 17:04 19.08.2014 17:04
von Mishka
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
obwohl ich eigentlich keine Zeit habe und es relativ viel Text ist, habe ich mich festgelesen und konnte garnicht aufhören. Die zweite Version gefällt mir wesentlich besser. Ich habe auch keine Infos aus dem ersten Teil vermisst.
Dein Schreibstil ist flüssig, sprachlich gelungen und der Geschichte angemessen. Vor allem die Gerichtsszene mit dem dicken Bauern ist sehr lebendig und war amüsant zu lesen.
Du bringst auch die Römer ins Spiel und deutest bevorstehende Schwierigkeiten an. Das macht mich neugierig, wie es nun weitergeht.
Bitte mehr davon! Ich würde auf jeden Fall weiterlesen.
Die eine oder andere Detailanmerkung hätte ich noch, aber dazu werde ich erst morgen kommen.
Liebe Grüße,
Mishka
|
|
| Nach oben |
|
 |
Mermaid
 Leseratte Leseratte

Beiträge: 143
|
  19.08.2014 20:44 19.08.2014 20:44
von Mermaid
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
puh. Ich habe noch nicht alles gelesen - ich muss mich dringend an mein eigenes Manuskript setzen - aber auf den ersten Blick erscheint es mir deutlich besser (weil gestraffter) als die erste Fassung. Sobald ich Zeit habe, werde ich es lesen. Bin gespannt!
Meergrüße,
Mermaid
|
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  29.09.2014 19:18 29.09.2014 19:18
Zeitenträumer / Prolog Gegenwart
von Zeitenträumer
|
  |
|
Hallo zusammen,
wie bereits erwähnt, spielt mein Roman in zwei verschiedenen Zeiten. Dies ist der Prolog des Gegenwartsteils, der im Manuskript direkt auf den antiken Teil folgt.
Bin gespannt auf schonungsloses Feedback!
Heute
Der Beobachter in der letzten Reihe ließ sich tiefer in den Sitz sinken. Auf die anderen Zuhörer mochte er wirken, als interessiere ihn seine Umgebung nicht sonderlich, doch seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. Keiner der Anwesenden würde sich nach dem Vortrag an ihn erinnern können. Es war seine Aufgabe, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und er hatte diese Fähigkeit über lange Jahre perfektioniert.
Hätte er die Frau dort vorne an der Kanzel beschreiben sollen, wäre ihm wohl als erstes das Wort „hutzelig“ in den Sinn gekommen. Sie war, wie er aus seiner Recherche wusste, 76 Jahre alt, hätte jedoch nach ihrem Äußeren noch älter sein können. Natürlich war sie damit weitaus jünger als er selbst, auch wenn er sein genaues Alter nicht kannte; ihm aber sah man seine Jahre nicht an. Er hätte vermutlich die heitere Gelassenheit geschildert, mit der sie die immer noch in den Saal strömenden Menschen betrachtete, und den Schalk, der in ihren Augen blitzte; vielleicht hätte er sogar erwähnt, dass sie ihm überraschend sympathisch war. Überraschend, weil er sich Gefühle für andere Menschen schon vor langer Zeit abgewöhnt hatte. Sympathie spielte für seine Aufgaben keine Rolle, sondern war im Gegenteil hinderlich, und ganz sicher würde er die alte Physikerin niemals jemandem beschreiben. Wenn sie sich als geeignet erwies, würde er lediglich ihren Namen und Wohnort übermitteln: Adaliz Mirabeau, Paris. Nicht mehr.
Denn er war das Auge des Hohen Rates, und das Auge sprach nicht, ebenso wenig wie die Stimme handelte oder die Hand beobachtete. Das Auge sieht. Die Stimme spricht. Die Hand straft. Der Geist führt. Das waren die Gesetze des Hohen Rates, und keinem der Ratsmitglieder wäre es eingefallen, sie zu verletzen. Er hatte niemals ein Mitglied des Rates zu Gesicht bekommen; er wusste nicht einmal, woher er wusste, dass es sie gab. Er konnte nicht sagen, woher er die Gesetze des Rates kannte und wie der Geist ihm seine Anweisungen übermittelte, doch diese Anweisungen waren überaus klar, und sie zu befolgen das einzig Wichtige auf der Welt.
Es schien, als wolle Madame Mirabeau beginnen, denn das Gemurmel unter den Zuhörern erstarb. Die Vorträge der Physikerin waren für ihre Unterhaltsamkeit berühmt, wurden im Netz verbreitet wie sonst nur unrealistische Stunts und alberne Katzenvideos, und sie galt trotz ihres Alters als führende Kapazität auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Vor allem gab es angeblich niemanden auf dem Planeten, der so viel über das Wesen der Zeit wusste wie sie, und das war der Grund seiner Anwesenheit. Der Inhalt der Veranstaltung interessierte ihn höchstens am Rande.
‚Finden Sie jemanden, der wirklich etwas von der Zeit versteht’, lautete der Auftrag des Geistes. Das war es, was er konnte: Menschen finden. Die richtigen Menschen. Er lehnte sich zurück und wartete.
„Die Zeit“, begann Adaliz Mirabeau nach einer kurzen Begrüßung, „ist wohl eines der vertrautesten Dinge in unserem Leben. Wir wollen sie uns vertreiben, sie ausnutzen oder totschlagen. Wir sagen, sie fliege oder fließe zäh, sie rinne uns durch die Hände, sie sei Geld. Wir ärgern uns, wenn wir sie vergeuden und freuen uns, wenn wir sie sparen. Und nicht zuletzt nagt sie mit ihrem unerbittlichen Zahn an uns, wie man an meiner Wenigkeit sehen kann.“ Die alte Dame schmunzelte. „Dennoch gibt es aus wissenschaftlicher Perspektive kaum etwas, das wir so wenig begriffen haben, wie die Zeit. Ich möchte Ihnen am heutigen Abend eine Vorstellung davon geben, wie weit wir mit unseren Bemühungen gekommen sind und was uns zum Verständnis fehlt. Insbesondere geht es, wie Sie dem Titel dieser Veranstaltung entnommen haben werden, um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen.“ Der Vortrag war unter dem Titel ‚Zeitreisen und die damit verbundenen Paradoxa‘ angekündigt worden. „Ich verspreche Ihnen“, fuhr Mirabeau fort, „dass ich Sie weder mit den zahllosen Versuchen der Philosophen, den Zeitbegriff zu erklären, noch mit den Formeln der Physiker langweilen werde. Monsieur Klein hier“, – sie wies auf den jungen Mann neben sich, der ihr Assistent zu sein schien – „könnte Ihnen all das, was ich Ihnen an Merkwürdigkeiten vorsetzen werde, auch mathematisch begründen und täte sicherlich nichts lieber als das, denn Monsieur Klein liebt Zahlen. Da ich aber annehme, dass die meisten von Ihnen diese Liebe nicht teilen, möchten wir Sie bitten, uns auch ohne diese Beweisführungen zu glauben.“ Im Publikum erhob sich verhaltenes Gelächter. Der Beobachter hatte diesen Monsieur Klein mit der Brille und der großen Nase bislang nicht wirklich beachtet, doch sein Gespür für Persönlichkeiten lieferte ihm eine schnelle Einschätzung: ein junger, erfolgreicher Wissenschaftler, der die Arroganz des brillanten Denkers aus allen Poren ausdünstete. „Es soll heute auch nicht um technische Schwierigkeiten von Zeitreisen gehen“, fügte Mirabeau hinzu, „obwohl nicht absehbar ist, ob und wann wir diese überwinden können – einige Physiker gehen davon aus, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen und das Ziel in ein paar Jahren oder Jahrzehnten erreichen werden, während andere vermuten, dass die menschliche Zivilisation gar nicht lange genug existieren wird, um die erforderlichen Technologien zu entwickeln. Zu letzteren gehöre auch ich. Andererseits: Wenn Wissenschaftler behaupten, etwas sei unmöglich, liegen sie meistens falsch. Wie dem auch sei, heute Abend möchte ich keine Technik diskutieren, sondern einige grundsätzliche Überlegungen zu Zeitreisen und der Zeit im Allgemeinen mit Ihnen teilen.“
Mirabeau nickte dem Assistenten zu, und Klein startete eine Powerpoint-Präsentation. Auf der Leinwand über dem Podium erschien das Porträt eines Mannes mit wirrem, weißen Haar und heraushängender Zunge, ein Bild, das wohl beinahe jeder Mensch in der westlichen Welt schon einmal gesehen hatte.
„Albert Einstein hat unser Verständnis der Zeit verändert“, fuhr Mme Mirabeau fort. „Er fand heraus, dass die Zeit nicht so absolut ist, wie sie uns erscheint. Wie schnell die Zeit vergeht, hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, von denen der bekannteste sicherlich die Geschwindigkeit ist, mit der wir uns bewegen. Kurz gesagt: je schneller wir sind, desto langsamer vergeht die Zeit. Zu Einsteins Zeiten war dieser Effekt bloße Theorie, doch mittlerweile wurde er viele Male experimentell bestätigt. Das ist ganz einfach: Wir schicken eine unserer genauesten Uhren mit einem unserer schnellsten Flugzeuge um die Welt, und hinterher geht sie im Vergleich zu einer zweiten, am Boden befindlichen Uhr einige Sekundenbruchteile nach. Die Zeit im Flugzeug ist also langsamer vergangen. Wenn Ihr Partner ruhig im Bett liegt und schläft, Sie selbst jedoch aufstehen, in die Küche gehen und sich einen Kaffee holen, sich also durch den Raum bewegen, wird Ihre Zeit ein wenig langsamer laufen als die ihres Partners.“
Der Beobachter bemerkte eine kurze Unruhe im Publikum; Köpfe wurden zusammengesteckt und einige kicherten. Paare, dachte er. Alberne Scherze gehörten wohl in fast jeder Beziehung zum Alltag. Er wusste nicht, ob er jemals eine Beziehung geführt hatte, bezweifelte es jedoch.
„Ähnlich verhält es sich mit der Gravitation“, fuhr Mirabeau fort. „In der Nähe eines sehr schweren Objektes, unter dem Einfluss starker Schwerkraft, vergeht die Zeit langsamer. Ein solches Objekt ist beispielsweise die Erde, und ob Sie es glauben oder nicht: Wenn Sie nicht mindestens die Hälfte Ihres Lebens im Kopfstand verbracht haben, ist Ihr Kopf älter als Ihre Füße, wenn auch nur um eine kaum messbare Zeit.“ Die alte Dame sah prüfend ins Publikum. „Sind Sie noch da? Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, und deshalb können wir es nicht, doch sie führen uns direkt zum ersten der beiden Typen von Zeitreisen, die es theoretisch gibt: die Reise in die Zukunft.“
Der Beobachter schweifte mit seinen Gedanken ab. Er hatte von dieser Art der Zeitreise gehört: wenn man eine Weile in einem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit herum flog und dann zur Erde zurückkehrte, waren dort viele Jahre vergangen, während man selbst nur wenige Stunden unterwegs gewesen war – man war in die Zukunft gereist. Solche Dinge hatten ihn nie sonderlich interessiert, und er wusste, dass auch dem Geist des Hohen Rates nicht daran gelegen war. Der Geist interessierte sich für Reisen in die Vergangenheit.
Über die wahren Beweggründe des Ratsvorsitzenden wusste der Beobachter wenig. Früher einmal hatte er Vermutungen darüber angestellt, welche Ziele der Hohe Rat verfolgte, doch wie so viele Dinge hatte er sich auch das Spekulieren im Laufe der Jahre abgewöhnt. Er erinnerte sich nur dunkel an den jungen Mann, der vor langer Zeit in den Dienst des Rates getreten war. Manchmal, in philosophischen Momenten, fiel ihm der Name des jungen Mannes ein, ein Name, der nicht mehr der seine war, ebenso wenig wie er noch ein Alter oder eine Nationalität besaß. Die Physikerin sprach für eine Französin recht gut englisch, doch für ihn spielte es keine Rolle; sie hätte ebenso gut deutsch, russisch oder Suaheli sprechen können. Das Auge war auch das Ohr des Rates, und es gab kaum eine Sprache, die ihm nicht geläufig war. Hätte sein Körper nicht mit einem untrüglichen Beweis aufgewartet, er hätte wohl sogar sein Geschlecht vergessen. Er wusste nicht einmal mehr genau, wann er sich dieser äußeren Merkmale entledigt hatte, doch es musste ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als er die Schriften des Wissens gefunden hatte und das Auge des Hohen Rates geworden war.
Madame Mirabeau setzte ihre Ausführungen fort. Auf der Leinwand war ein transparenter Würfel erschienen, anhand dessen sie offenbar die Beschaffenheit der Raumzeit erklärte.
„Was gleichzeitig geschieht ist jedoch keineswegs so eindeutig, wie es scheint“, sagte sie gerade. „Nehmen wir an, das sind wir.“ Der Assistent hob die Fernbedienung und ließ ein grünes Männchen in einer Ecke des Würfels erscheinen. „Wir sitzen in unserem ruhigen, sicheren Seitenarm der Milchstraße und zweifeln nicht an unserem Jetzt. Zum anderen haben wir unseren außerirdischen Freund ET, der drei Millionen Lichtjahre entfernt auf seinem Heimatplaneten wohnt.“ Eine rote Figur mit dünnem Hals und riesigen Augen erschien auf der anderen Seite des Würfels. „Befinden wir uns beide in Ruhe, können wir uns auf ein gemeinsames Jetzt einigen. Aufgrund der riesigen Entfernung zwischen uns können jedoch schon geringfügige Bewegungen großen Einfluss darauf ausüben, was wir als gleichzeitig wahrnehmen. Wenn ET sich beispielsweise auf uns zu bewegt, könnten Ereignisse, die für uns noch weit in der Zukunft liegen, für ihn bereits geschehen sein. Er könnte, wenn wir die Schwierigkeiten bei der Nachrichtenübermittlung beiseite lassen, im Fernsehen auf seinem Planeten live beobachten, wie Ihre Enkeltochter hier auf der Erde einen Nobelpreis gewinnt. Nun haben wir ein großes Problem, denn wer von uns hat recht mit seinem Jetzt-Begriff?“ Mirabeau stemmte die Hände in die Hüften und setzte eine strenge Miene auf; dann lächelte sie wieder. „Keine Angst. Wir alle wissen, dass die Zeit nur in eine Richtung verläuft. Niemals setzt sich ein zerbrochener Teller spontan wieder zusammen, nie erheben sich die gelben und roten Blätter eines Baumes vom Boden, um sich an ihre Äste zu heften und zu ergrünen. Und wie gesagt, jünger wird leider auch keiner von uns. Wir Physiker sprechen vom Zeitpfeil. Erst wurde Ihr Großvater geboren, dann Ihr Vater und schließlich Sie selbst.“ Sie breitete die Arme aus. „Et voilá – schon sind wir beim bekanntesten Zeitreise-Paradoxon der Welt.“
Der Beobachter versprach sich keinen Gewinn davon, weiter zuzuhören. Stattdessen öffnete er all seine Sinne, um die Persönlichkeit der alten Dame zu ergründen, sie zu sehen, zu hören und zu spüren, während ihre Worte bedeutungslos an ihm vorüberzogen; die Zuhörer folgten in gespannter Stille, die nur von gelegentlichem Lachen unterbrochen wurde.
Neben den gewöhnlichen Sinnen nutzte er auch seine besonderen Fähigkeiten – Fähigkeiten, die in der Welt schon lange vergessen waren und die nur noch die Mitglieder des Hohen Rates beherrschten. Natürlich gab es Menschen mit außergewöhnlichen Begabungen; kaum jemand wusste das besser als er, denn zumeist bestand seine Aufgabe darin, solche Personen zu finden. Doch bevor diese Leute in die Dienste des Rates traten, konnte man nicht davon sprechen, dass sie ihre Talente beherrschten. Nur mit den Schriften des Wissens konnten sie sie vollständig entwickeln, und diese Schriften beruhten auf den Lehren der Druiden von einst. Gelegentlich malte er sich aus, einen der alten Zauberer zu treffen, und fragte sich, ob das der Grund der Besessenheit des Ratsvorsitzenden für Zeitreisen war, doch stets verblassten diese Fragen rasch und verschwanden im Strudel der bedeutungslosen Realität.
Er grub tiefer im Wesen der alten Frau während sie dem Publikum unlösbare Zeiträtsel erklärte. „Sie wissen vielleicht, dass wir Physiker auf der Suche nach einer Theorie sind, einer einzigen Formel, die alle physikalischen Gesetze umfasst und beschreibt“, sagte sie. „Zeitungen schreiben oft vom Heiligen Gral der Physik, aber wir nennen sie schlicht die Große Vereinheitlichte Theorie. Nehmen wir an, Monsieur Klein hier reist fünf Jahre in die Zukunft und findet heraus, dass die Formel veröffentlicht wurde, und zwar von mir. Er liest die Theorie und ist überwältigt: Der Menschheit stehen nun große Entwicklungen bevor. Frohgemut kehrt er zurück und wartet, muss aber zwei Jahre später feststellen, dass ich an allem Möglichen arbeite, nur nicht an der Theorie. Etwas beunruhigt sagt er sich, dass ich ja noch drei Jahre Zeit habe, doch als er sich nach weiteren zwei erkundigt, habe ich immer noch nicht eine Zeile zu Papier gebracht und werde zudem langsam senil. Jetzt macht er sich ernsthaft Sorgen, und als es ein halbes Jahr später immer noch nicht besser aussieht, beschließt er, einzugreifen. Da er die Theorie gelesen hat, ist es ihm ein Leichtes, mich bei unserem nächsten Treffen auf die wichtigsten Zusammenhänge hinzuweisen, und ein halbes Jahr später erscheint das große Werk – doch wer ist der Urheber? Ich, die ich ohne Monsieur Klein vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre, an der Sache zu arbeiten? Oder er, der ohne die Lektüre meiner Theorie vielleicht nie im Leben auch nur das erste Axiom gefunden hätte? Oder ist gar Wissen aus dem Nichts entstanden?“
Adaliz Mirabeau schien keinerlei Hintergedanken zu hegen, sondern sprach mit einer fröhlichen Begeisterung für die Sache, ohne Eitelkeit oder andere egoistische Motive. Die jugendliche Heiterkeit und die Neugier, die aus ihren Augen sprachen, verbanden sich mit einer gewissen Milde, einer Altersweisheit und Gelassenheit, die der verhärtete Geist des Beobachters nur schwer ertrug. Gerade beendete sie ihre Ausführungen mit dem charakteristischen „Sind Sie noch da?“, doch in ihren Worten schwang nicht die Spur von Herablassung oder Spott. Ihr Lächeln verkündete, dass sie jedem einzelnen der Zuhörer auch das kleinste Detail geduldig erklären würde, bis er es verstand. Diese Frau, da war er sicher, war durch und durch gut.
Sie war vollkommen ungeeignet für die Zwecke des Hohen Rates.
Er war bereits im Begriff aufzustehen, als sein Blick erneut auf den Assistenten fiel. Monsieur Klein stand ungelenk neben dem Rednerpult, die Hüfte leicht eingeknickt, und fingerte an der Fernbedienung in seiner Hand herum. Mit einer fahrigen Bewegung rückte er seine Brille zurecht, und es war offensichtlich, wie sehr er die Zuhörer im Saal verachtete, für wie ausgesprochen begriffsstutzig er sie hielt. Der Beobachter lehnte sich wieder zurück und richtete seine Aufmerksamkeit auf den jungen Mann.
Selten hatte er in einem solch scharfen Verstand geforscht. Eine Fülle von äußerst präzisen Gedanken prasselte auf ihn ein, von deren Inhalt er kaum etwas verstand; offenbar löste Klein nebenbei komplexe mathematische Gleichungen. Mit einem leisen Kopfschütteln konzentrierte der Beobachter sich auf das Wesen und die Gefühle des Assistenten. Klein war von enormem Ehrgeiz getrieben, und die Verachtung, die er dem Publikum entgegenbrachte, galt in geringerem Maß auch für Madame Mirabeau, die nicht einmal in der Lage war, einen Beamer zu steuern. Kaum einmal hatte der Beobachter jemanden gesehen, dessen Geist sich in einem derartigen Ungleichgewicht befand, gewissermaßen das genaue Gegenteil zu der alten, in sich ruhenden Physikerin. Klein musste ein sehr unzufriedener Mensch sein, auch wenn dies nur eine oberflächliche Analyse war.
Möglicherweise bist du es, den ich gesucht habe. Ehrgeiz war ein wunderbarer Hebel, um jemanden zu manipulieren. Für die Stimme des Hohen Rates würde es eine Kleinigkeit darstellen, diesen Mann dazu zu bringen, genau das zu tun was der Geist wollte.
Er lehnte sich wieder zurück, um das Ende des Vortrags abzuwarten. Madame Mirabeau war offenbar bei den entscheidenden Schlussfolgerungen angelangt, doch da er ihren Ausführungen nicht gefolgt war, verstand er nicht alles, was sie sagte.
„Wir haben also gesehen“, verkündete sie gerade, „dass die gesamte Raumzeit, der gesamte Würfel, existiert. Der Fluss der Zeit, der uns so vertraut ist, scheint hingegen ein unzutreffendes Bild zu sein, das nur im menschlichen Geist eine Zuflucht hat und einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhält. Es sei denn, Sie messen ihrem eigenen Standpunkt eine größere Bedeutung zu als dem eines beliebigen anderen Individuums irgendwo im Universum, wie zum Beispiel ET. Verschiedene Beobachter können höchst unterschiedlicher Ansicht darüber sein, welche Ereignisse gleichzeitig geschehen. Mein Jetzt könnte sich von Ihrem Jetzt fundamental unterscheiden, und ein Beobachter in zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung wird mit großer Sicherheit einen vollkommen anderen Jetzt-Begriff haben, der für ihn jedoch genauso real ist, wie unserer für uns. Ich weiß, es ist kaum vorstellbar, denn unsere Wahrnehmung erzählt uns Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, eine andere Geschichte, aber alle Erkenntnisse der modernen Physik weisen darauf hin, dass es sich so verhält. Wenn wir Einstein glauben, ist jeder Punkt der Raumzeit, liege er für uns nun in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft, vollkommen gleichberechtigt mit jedem anderen Punkt.“ Sie machte eine Pause und sah fast mitleidig ins Publikum. „Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich möchte ihnen zum Schluss noch kurz deutlich machen, was diese Erkenntnisse für unser Problem der Zeitreise in die Vergangenheit bedeuten. Können Sie nun, vorausgesetzt, Sie haben eine Zeitmaschine, Ihren Vater erschießen oder nicht?“
Amüsiert registrierte der Beobachter einen leisen Anflug von Interesse irgendwo weit hinten in seinem Gehirn – wie lange war es her, dass ihn etwas wirklich interessiert hatte? –, aber er wusste, dass es zu spät für ihn war, sich zu begeistern. Zu lange hatte er sich allen weltlichen Inhalten verschlossen; zu lange war er das Auge des Hohen Rats gewesen. Kurz meinte er sogar etwas zu spüren, das früher einmal Neid gewesen wäre, Neid auf diese alte Dame, die trotz ihrer Jahre so viel Freude am Leben empfand, doch es schien gleichsam das Gefühl eines anderen Menschen zu sein, das Gefühl des jungen Mannes mit dem Namen und der Nationalität, dem Alter und dem Geschlecht. Er unterdrückte ein Gähnen.
„Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen“, sagte Madame Mirabeau. „Momentan scheint es höchst unwahrscheinlich, dass es jemals möglich sein wird, in die Vergangenheit zu reisen. Ich selbst gehöre zu denen, die vermuten, dass es sich nicht nur technisch, sondern auch prinzipiell als unmöglich erweisen wird. Es ist allerdings bemerkenswert, dass wir kein physikalisches Gesetz entdecken, das dagegen spricht. Wir können die Unmöglichkeit von Vergangenheitsreisen trotz aller Bemühungen nicht beweisen.“ Sie lächelte ihr sanftes Lächeln. „Wenn es aber doch möglich sein sollte, so vermeidet die allgegenwärtige Existenz der gesamten Raumzeit jegliches Paradoxon. Wenn die gesamte Raumzeit existiert, wenn jedes Ereignis unveränderlich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattfindet, dann ist es nicht möglich, ein solches Ereignis zu beeinflussen. Die Tatsache, dass Sie existieren, schließt aus, dass Ihr Vater vor Ihrer Zeugung erschossen wird; denn Kausalität ist ein unumstößliches Prinzip. Man kann sich unzählige Möglichkeiten ausdenken, was geschähe: Sie schießen daneben, der Abzug der Waffe klemmt, jemand läuft dazwischen oder Sie entscheiden sich im letzten Moment um und lassen den armen Mann leben. Jeder Augenblick in der Raumzeit existiert. Für immer. Es ist schwer, diese Beschreibung des Universums zu akzeptieren, denn unsere alltägliche Erfahrung trennt so eindeutig und entschlossen zwischen dem, was war, was ist und was sein wird. Doch wie Einstein es einmal sagte: Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion – wenn auch eine hartnäckige.“ Immer noch lächelnd deutete Adaliz Mirabeau eine Verbeugung an. „Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Möge Ihr Leben noch viele wunderbare Jetzt-Erlebnisse für Sie bereithalten.“
Für einen Moment saßen die Zuhörer wie betäubt da; dann brandete tosender Applaus auf, der minutenlang anhielt und der alten Frau etwas peinlich zu sein schien. Während die Menschen langsam aus dem Saal strömten und Monsieur Klein sich daran machte, den Laptop herunterzufahren, betrachtete der Beobachter den schlaksigen jungen Mann. Es war, so vermutete er, nicht das letzte Mal, dass er diesen Schnösel zu Gesicht bekommen würde. Schon bald würde er für den Hohen Rat arbeiten – die Stimme konnte außerordentlich überzeugend sein. Und sollte sie wider Erwarten scheitern, käme die Hand des Rates ins Spiel; und dann würde es für den klugen Monsieur Klein sehr, sehr unangenehm werden.
|
|
| Nach oben |
|
 |
bibiro
 Klammeraffe Klammeraffe
B
Beiträge: 716
|
B  30.09.2014 08:52 30.09.2014 08:52
von bibiro
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
dieser Prolog gefällt mir besser als der andere, gegenwärtige, den du ebenfalls eingestellt hast, was wahrscheinlich an der personalen Perspektive liegt, so wie ich mich kenne. Die mag ich einfach mehr als die neutrale oder auktoriale.
Mir sind nur ein paar Dinge aufgefallen:
| Zitat: | | schmucke, mit Lehm verputzte Fachwerkhäuser |
Das "schmucke" beißt sich mit der Beschreibung der Armut die später folgt. Sollte auch klar sein, Lehmputz muss man sehr regelmäßig erneuern/flicken und wenn man nichts zu futtern hat, lässt man so was am ehesten schleifen
"mit Lehm verputzte Fachwerkhäuser" wurde mir von historisch belesenen Probelesern in meinem Frühmittelaltersetting (9. Jahrhundert) angekreidet - der Leser würde sich die heute üblichen, freigelegten Fachwerke dabei vorstellen.
| Zitat: | | Gewiss, er verteilte unter den Gemeinen und Hörigen des Stammes, doch das war nichts im Vergleich zum Leid der Menschen. |
Was verteilte er? Wenn du das nicht ausführen willst, dann verwende doch "er spendete den Gemeinen ..." stattdessen.
Hier ein bisschen viel "Reiter"
| Zitat: | | Eporedorix, der Reiterkönig, war der Anführer der vielköpfigen ReitertTruppe, die Dumnorix sich hielt und mit eigenem Gold entlohnte und verpflegte, sodass sie sich ganz dem Kampf hingeben konnte. Er entstammte einer der edelsten Sippen, und es bedeutete eine hohe Ehre, in sein persönliches Gefolge aufgenommen zu werden. Eluskú, Sohn des Biracos, musste ein begnadeter Reiter sein. |
Hier ein bisschen umständlich formuliert
| Zitat: | | die hellblonden Haare mit geflochtenen Zöpfen zusammengebunden |
Vorschlag:
"die hellblonden Haare zu Zöpfen geflochten"
| Zitat: | | „Ich bin Eluskú, Sohn des Biracos!“, rief er. „Bei Magetobriga erschlug ich ... |
Hier würde ich nur vor dem Inquit das Ausrufezeichen stehen lassen und beim Rest der wörtlichen Rede Punkte verwenden. Eluskú wird ja nicht die ganze Zeit schreien.
| Zitat: | | deutete auf einen kleinen, blassen, untersetzten Mann |
Puh, ganz schön viele Adjektive für den armen Mann.
Du könntest versuchen, anstelle eines der Adjektive ein treffenderes Substantiv als "Mann" zu verwenden, wenn du alle drei Eigenschaften als wichtig empfindest. Vielleicht "Winzling" oder "Zwerg"?
Dann fiele "kleinen" weg.
Und das "blassen" könntest du auslagern, durch "mit blasser Gesichtsfarbe" oder "mit fahlem Gesicht"
Somit würde daraus "deutete auf einen untersetzten Winzling mit fahler Gesichtsfarbe"
Da wechseln die Hülsenfrüchte:
Von Linsen
| Zitat: | | Wir verlangen, dass sein Bauchumfang abgemessen wird, und zwar mit mittleren Linsen, so wie es der Ehre unserer Sippe entspricht! Für jede Linse soll er ein Kalb geben, um den Schaden zu ersetzen!“ |
zu Bohnen
| Zitat: | | Die Verse schreiben für einen solchen Fall vor, die Strafe mit gewöhnlichen Bohnen zu bemessen. Sie soll in kleinem Kupfer beglichen und am Brunnen der Kraniche dem Esos dargebracht werden.“ Er tat weitere vier Schläge mit dem Stab, um sein Urteil zu bekräftigen, und stieg langsam von dem Felsen hinunter. „Alisanos, Ihr werdet den Abstand gewissenhaft abmessen, Bohne für Bohne. |
Dann ist mir noch die Stunde als Anachronismus aufgefallen:
| Zitat: | | für jeden Zwölft einer Stunde |
Wiederholung:
| Zitat: | | und warteten an dem kleinen Bach, an dem er sie verlassen hatte |
Vorschlag: "warteten neben dem Bach"
Und noch was zu den Auslassungspunkten (...) http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/auslassungspunkte
Musste ich auch erst dank meiner fähigen Probeleser lernen.
Ach ja, und mir fiel beim ersten Durchlesen noch das Wort "Klientel" auf. Das würde ich durch ein weniger modernes ersetzen.
Grüßle Bibi
|
|
| Nach oben |
|
 |
bibiro
 Klammeraffe Klammeraffe
B
Beiträge: 716
|
B  30.09.2014 09:47 30.09.2014 09:47
von bibiro
|
 |
|
Hallo Zeichenträumer,
jetzt weiß ich, was mich an diesem Prolog irritiert - du beginnst mit einer neutralen Erzählperspektive, ehe du in die personale Erzählperspektive des Beobachters wechselst.
| Zitat: | | Der Beobachter in der letzten Reihe ließ sich tiefer in den Sitz sinken. Auf die anderen Zuhörer mochte er wirken, als interessiere ihn seine Umgebung nicht sonderlich, doch seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. Keiner der Anwesenden würde sich nach dem Vortrag an ihn erinnern können. Es war seine Aufgabe, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und er hatte diese Fähigkeit über lange Jahre perfektioniert. |
Ganz klar neutral, fast schon auktorial (keiner würde sich erinnern können - das greift der Handlung vor und lässt in die Köpfe der Anderen blicken)
Dann geht es mit klarer personaler Perspektive weiter:
| Zitat: | | Hätte er die Frau dort vorne an der Kanzel beschreiben sollen, wäre ihm wohl als erstes das Wort „hutzelig“ in den Sinn gekommen. Sie war, wie er aus seiner Recherche wusste, ... |
An deiner Stelle würde ich den ersten Absatz ebenfalls in die personale Perspektive transferieren, um die Verwirrung, die das auslöst, zu vermeiden.
Das kannst du durch ein paar Hinzufügungen einfach erreichen:
Vorschlag:
| Zitat: | | Der Beobachter in der letzten Reihe ließ sich tiefer in den Sitz sinken. Er achtete darauf, auf die anderen Zuhörer zu wirken, als interessiere ihn seine Umgebung nicht sonderlich, doch seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. Aus Erfahrung wusste er, keiner der Anwesenden würde sich nach dem Vortrag an ihn erinnern können. Es war seine Aufgabe, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und er hatte diese Fähigkeit über lange Jahre perfektioniert. |
So, nun weiter im Text.
| Zitat: | | das Wort „hutzelig“ |
Ich wette, andere Probeleser und gar Lektoren werden dir den Ausdruck ankreiden, weil dialektal, und dir stattdessen "schrumpelig" vorschlagen.
Ich habe bei dem Wort ein altes Weible vor Augen, braun und knittrig, mit von Creme glänzender Haut - ein Fleisch gewordenes Hutzelbrot. Zu süß und zu klebrig, um wirklich zu schmecken und doch süchtigmachend, bis es leer gegessen ist.
Ein schönes Bild. Aber wer hat jemals schon Hutzelbrot gegessen und kann es nachempfinden?
| Zitat: | | Sie war, wie er aus seiner Recherche wusste, 76 Jahre alt, hätte jedoch nach ihrem Äußeren noch älter sein können. Natürlich war sie damit weitaus jünger als er selbst, ... |
Wortwiederholung/Verbfaulheit (nennen es meine geneigten Probeleser)
Das hier gefällt mir richtig, richtig gut:
| Zitat: | | wie sonst nur unrealistische Stunts und alberne Katzenvideos |
Das hier ist schön formuliert, aber ich würde doch etwas hinzufügen:
| Zitat: | | „Die Zeit“, begann Adaliz Mirabeau nach einer kurzen Begrüßung, „ist wohl eines der vertrautesten Dinge in unserem Leben. Wir wollen sie uns die Zeit vertreiben, sie ausnutzen oder totschlagen. Wir sagen, sie die Zeit fliege oder fließe zäh, sie rinne uns durch die Hände, sie sei Geld. Wir ärgern uns, wenn wir sie vergeuden und freuen uns, wenn wir sie sparen. Und nicht zuletzt nagt sie die Zeit mit ihrem unerbittlichen Zahn an uns, wie man an meiner Wenigkeit sehen kann.“ |
Das hier betrifft die Formatierung:
| Zitat: | | ... um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen.“ Der Vortrag war unter dem Titel ‚Zeitreisen und die damit verbundenen Paradoxa‘ angekündigt worden. „Ich verspreche Ihnen“, fuhr Mirabeau fort, „dass ich ... |
Das von mir rot markierte sind die Dialogtexte von Mme. Mirabeau und das dazwischen ist eine Erinnerung des Beobachters. Ergo ein Sprecher-/Denker-/Handelnder-Wechsel, den ich mittels Umbrüchen formatieren würde.
dito:
| Zitat: | | ... diese Beweisführungen zu glauben.“ Im Publikum erhob sich verhaltenes Gelächter. Der Beobachter hatte diesen Monsieur Klein mit der Brille und der großen Nase bislang nicht wirklich beachtet, doch sein Gespür für Persönlichkeiten lieferte ihm eine schnelle Einschätzung: ein junger, erfolgreicher Wissenschaftler, der die Arroganz des brillanten Denkers aus allen Poren ausdünstete. „Es soll heute auch nicht ... |
hier finde ich, der Absatz mit Mirabeaus Anweisung an Klein passt eher an ihren vorangegangen Sprechtext.
| Zitat: | ... im Allgemeinen mit Ihnen teilen.“
Mirabeau nickte dem Assistenten zu, und Klein startete eine Powerpoint-Präsentation. Auf der Leinwand über dem Podium erschien ... |
rot: Sprechen/Handeln Mirabeau
blau: Handeln Klein
schwarz: allgemeine Vorgänge im Vorführraum
kann man aber sicher auch anders sehen
auch hier:
| Zitat: | | ... das sind wir.“ Der Assistent hob die Fernbedienung und ließ ein grünes Männchen in einer Ecke des Würfels erscheinen. „Wir sitzen in ... |
| Zitat: | | Er grub tiefer im Wesen der alten Frau Komma während sie dem Publikum unlösbare Zeiträtsel erklärte. „Sie wissen vielleicht, ... |
Da ist dir ein Fehler mit der Zeichensetzung in der wörtlichen Rede unterlaufen, das musste ich auch erst dank der geduldigen Hinweise meiner Probeleser lernen, dass man nicht beliebig viele Punkte in Verbindung mit einem Komma-Inquit setzen darf.
| Zitat: | | „Wir haben also gesehen“, verkündete sie gerade, „dass die gesamte Raumzeit, der gesamte Würfel, existiert. Der Fluss der Zeit, ...[in der Folge noch weitere Punkte bis zum Ende der wörtlichen Rede] ... mit jedem anderen Punkt.“ |
Ich habe es dir so markiert wie der liebe Probeleser seinerzeit bei mir:
Blau ist, was regelgerecht ist, rot ist falsch.
Du kannst das leicht retten, indem du den ersten Satz komplett vor das Inquit ziehst:
| Zitat: | | „Wir haben also gesehen, dass die gesamte Raumzeit, der gesamte Würfel, existiert“, verkündete sie gerade. „ Der Fluss der Zeit, ...[in der Folge noch weitere Punkte bis zum Ende der wörtlichen Rede] ... mit jedem anderen Punkt.“ |
Und schon ist alles blau = regelgerecht
Ansonsten - nachdem ich für mich die Sperre in meinem Kopf aufgrund der anfänglichen Perspektivverwirrung aufgelöst hatte, ein sehr spannender Anfang, der Lust macht auf mehr!
Grüßle Bibi
|
|
| Nach oben |
|
 |
Timmytoby
 Gänsefüßchen Gänsefüßchen

Alter: 42
Beiträge: 41
|
  01.10.2014 16:46 01.10.2014 16:46
von Timmytoby
|
 |
|
Hey Zeichenträumer,
vorab erstmal ein großes Kompliment. Ich bin ein großer Fan von Texten, die sich mit Zeitreise auseinandersetzen, und deiner hat mir sehr gut gefallen. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als er endete. Du hast es geschafft mich neugierig auf mehr zu machen.
Der Text wirkt auch schon sehr professionell überarbeitet. Ich habe einige lektorierte Bücher aus großen Verlagen gelesen, die mehr Schnitzer enthielten.
Für Verbesserungen musste ich also ein wenig anfangen, Erbsen zu zählen:
| bibiro hat Folgendes geschrieben: |
So, nun weiter im Text.
| Zitat: | | das Wort „hutzelig“ |
Ich wette, andere Probeleser und gar Lektoren werden dir den Ausdruck ankreiden, weil dialektal, und dir stattdessen "schrumpelig" vorschlagen. |
Da hat bibiro schon recht, das war der erste Punkt, an dem ich gestolpert bin in deinem Text. Ich assoziiere »hutzelig« mit jemandem der Dialekt spricht. Wenn dein Protagonist aus einer entsprechenden Region kommt, ist das kein Problem. Das kann dann sogar ein kleiner Hinweis sein. Aber ansonsten würde ich versuchen einen Ersatz zu finden. Ich habe jetzt kein gutes Alternativadjektiv gefunden, aber du könntest mit Nomen experimentieren: Trockenpflaume, gebeugte Eiche, Großmutter, etc.
| Zitat: | | Auf die anderen Zuhörer mochte er wirken, als interessiere ihn seine Umgebung nicht sonderlich, doch seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten Mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. |
Das fand ich jetzt etwas sperrig formuliert, und ich würde vorschlagen du verwendest hier ein bisschen mehr Farbe, statt nur "den Einen, den Anderen".
Auf die Schnelle formuliert:
...durch den Saal, verharrten jeweils nur einen Wimpernschlag auf den in den Saal hereinströmenden Neugierigen, bevor sie unweigerlich zu der alten Frau hinter dem Rednerpult zurückkehrten.
| Zitat: | | „Sind Sie noch da? Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, und deshalb können wir es nicht, doch sie führen uns direkt zum ersten der beiden Typen von Zeitreisen, die es theoretisch gibt: die Reise in die Zukunft.“ |
Die Frage zu Beginn hört sich für mich hölzern an. Vielleicht experimentierst du eher in die Richtung "Habe ich sie schon vergrault?" oder ähnlichem.
Der Satz danach ist sehr verschachtelt. Ich würde ihn aufteilen:
...weswegen wir es nicht können. Was uns zum ersten Typ der theoretisch möglichen Zeitreisen führt: Der Reise in die Zukunft.
| Zitat: | | Wenn man eine Weile in einem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit herum flog und dann zur Erde zurückkehrte, waren dort viele Jahre vergangen, während man selbst nur wenige Stunden unterwegs gewesen war |
"Herum flog" hört sich für mich nicht schön an. Alternativvorschlag:
Näherte man sich theoretisch der Lichtgeschwindigkeit, etwa in einem Raumschiff, und würde nach einigen Stunden zurückkehren, dann müsste man damit rechnen, dass viele Jahre vergangen seien - man wäre im Grunde durch die Zeit gereist.
| Zitat: | | Hätte sein Körper nicht mit einem untrüglichen Beweis aufgewartet, er hätte wohl sogar sein Geschlecht vergessen. Er wusste nicht einmal mehr genau, wann er sich dieser äußeren Merkmale entledigt hatte, |
Das hört sich für mich so an als hätte er sich kastriert. Kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das beabsichtigt war.
| Zitat: |
„Wir sitzen in unserem ruhigen, sicheren Seitenarm der Milchstraße und zweifeln nicht an unserem Jetzt. Zum anderen haben wir unseren außerirdischen Freund ET, der drei Millionen Lichtjahre entfernt auf seinem Heimatplaneten wohnt.“ Eine rote Figur mit dünnem Hals und riesigen Augen erschien auf der anderen Seite des Würfels. |
Die Referenz zu ET ist ein bisschen altbacken (das sind jetzt 33 Jahre). Das kann natürlich beabsichtigt sein, weil sie eine alte Frau ist. Gerade unter Physikern würde ich aber eher Popkultur-Anspielungen erwarten die sich mehr über die UFO-Theoretiker lustig machen. Statt ET einen Grey oder anderen Alien zu verwenden, würde sich für mich frischer anfühlen.
ET als Beispiel zu nehmen fühlt sich für mich auch leicht herablassend an, da es ein Film für Kinder war.
| Zitat: |
Es war, so vermutete er, nicht das letzte Mal, dass er diesen Schnösel zu Gesicht bekommen würde. Schon bald würde er für den Hohen Rat arbeiten – die Stimme konnte außerordentlich überzeugend sein. Und sollte sie wider Erwarten scheitern, käme die Hand des Rates ins Spiel; und dann würde es für den klugen Monsieur Klein sehr, sehr unangenehm werden. |
Schnösel scheint mir nicht ganz zu Monsieur Klein zu passen. Er ist zwar arrogant, aber ich verbinde mit Schnösel eher finanzielle/kulturelle/ästhetische Überlegenheit, nicht intellektuelle.
Das "würde...werden" ist ein wenig schwach als letztes Verb in einem Absatz/Kapitel. Vielleicht kannst du den letzten Satz so umformulieren, dass er etwas kräftiger endet, mit einem aktiven Verb.
Das war soweit alles, was mir aufgefallen ist.
Eines hat mir besonders gut gefallen: Die Art wie du erst das Konzept eines Paradoxon erklärt und dann gegen seine Existenz argumentiert hast, hat sich sehr packend gelesen. Es ist ziemlich schwierig so trockene Infos ansprechend zu verpacken, und das hast du ausgezeichnet hingekriegt!
|
|
| Nach oben |
|
 |
Papa Schlumpf
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 64
Beiträge: 373
Wohnort: Friedersdorf
|
  02.10.2014 21:58 02.10.2014 21:58
von Papa Schlumpf
|
 |
|
Zeitenträumer!
Boah, was'n Teil. Die Fülle des Textes ist nichts für die späte Stunde. Trotzdem konnte ich nicht abbrechen, also: gut gemacht.
Die physikalische Komplexität des Themas hast Du brav an den Mann und die Frau gebracht, Du wirst im Folgenden dieses Wissen noch brauchen, denke ich. Über Einzelheiten reden wir jetzt nicht, es ist ja kein Lehrbuch (genau dort, wo die Raumzeit interessant wird und wirklich schwer verständlich, lässt Du eine Lücke). Mir fehlt aber ein Stück weit die philosophische Dimension des Problems. Die Zeitreise ist kein rein physikalisches Phänomen, wie nichts in der modernen physikalischen Grundlagenforschung, jede Antwort eröffnet ein Universum neuer Fragen, naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher. Da wir Schreiberlinge meist keine Naturwissenschaftler sind (Ausnahmen bestätigen die Regel) ist es eigentlich unser Brot, die philosophischen Abgründe auszuloten. Vielleicht lotest Du noch aus, welches Grundlagenwissen für den Leser wirklich notwendig ist, was eventuell überflüssig oder weniger sinnfällig (den Kubus als Modell fand ich nicht so gelungen, aber das liegt vielleicht an der späten Stunde)
Der Text ist, ich denke, das ging oben schon hervor, flüssig und fesselnd geschrieben, es gibt Wortwiederholungen, hätte und wäre (Konjunktiv ohne Hilfsverb ist außerordentlich reizvoll!), andere Formen von" haben" und "sein",
| Zitat: | | er wusste nicht einmal, woher er wusste, dass es sie gab |
fand ich nicht so gelungen.
Dagegen stört mich der ET überhaupt nicht, im Gegenteil, stünde dort "Alien" implizierten wir den uns feindlich Gesinnten, während Spielbergs Außerirdischer doch äußerst liebenswürdig und friedlich war, und genau diese Eigenschaften sollten wir für gewöhnlich den Fremden zuschreiben, auch wenn wir auf unserem Planeten noch lange nicht so weit sind. Deshalb können wir auch noch nicht interstellar reisen, furchtbar, eroberte diese kriegerische Species auch noch fremde Planetensysteme, zu wenig entfernten wir uns bisher von den Methoden der Conquistadores. Im Zusammenhang mit ET von altbacken zu sprechen empfinde ich übrigens etwa so wie einen Zusammenhang zwischen der Relativitätstheorie und veraltet herzustellen.
Monsieur Klein. Ist ein Schnösel. Denn intellektuell kann es so weit mit ihm nicht sein, sonst sähe er auf die "Unwissenden" um sich nicht herab. Ein Intellektueller besitzt das Wissen, dass seine Mitmenschen mindestens genauso wertvoll sind wie er selbst, nur auf anderem Gebiet. Und er bewundert, was andere mit ihren Händen schaffen (die eigenen linken Pfoten brächten das nicht hin). Wer sich aber erhebt, dem fehlt die Lizenz zur Intellektualität. Er bleibt ein vielleicht hochklassig denkender Schnösel.
So, jetzt ist es gut, einen schönen Feiertag und viele Grüße
Papa Schlumpf.
_________________
Nicht alles, was wir bewirken, haben wir auch gewollt. |
|
| Nach oben |
|
 |
Einar Inperson
 Reißwolf Reißwolf

Beiträge: 1675
Wohnort: Auf dem Narrenschiff
|
  02.10.2014 22:06 02.10.2014 22:06
von Einar Inperson
|
 |
|
Hallo Zeitenträumer,
dies ist keine Textkritik, wie du sie vielleicht wünschst, sondern nur ein kurze Wiedergabe meines Eindrucks.
Ich habe deinen Text schon vor Tagen, er war fast noch ohne Klicks, in einem Zug gelesen. Vielleicht sind da Stolpersteine gewesen. Wenn, dann habe ich mich von denen nicht stören lassen.
Danke fürs Einstellen.
_________________
Traurige Grüße und ein Schmunzeln im Knopfloch
Zitat: "Ich habe nichts zu sagen, deshalb schreibe ich, weil ich nicht malen kann"
Einar Inperson in Anlehnung an Aris Kalaizis
si tu n'es pas là, je ne suis plus le même
"Ehrfurcht vor dem Leben" Albert Schweitzer |
|
| Nach oben |
|
 |
03mtep13
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 35
Beiträge: 64
Wohnort: Linz
|
  02.10.2014 23:11 02.10.2014 23:11
von 03mtep13
|
 |
|
Mein Kompliment. Ich wollte zu dieser späten Stunde eigentlich gar nicht mehr lesen, dachte mir: lies den ersten Absatz, nur um zu sehen, worum es geht.
Ich habe den Text bis zu Ende gelesen und war enttäuscht, jetzt nicht ein Buch in der Hand zu haben, wo es weiter geht. Stolpersteine hatte ich nur mit "hunzelig" wo ich aber eher schmunzeln als die Stirn in Falten legen musste. Der Vorschlag "schrumpelig" der gefallen ist, würde mir deutlich weniger gefallen. "Hunzelig" ist für mich aussagekräftiger. Man kann sich die alte Frau richtig gut vorstellen.
Der Stil gefällt mir auch, Erbsen haben schon andere gezählt und mir wären auch kaum welche aufgefallen.
Was mir aufgefallen ist: Der "Beobachter" ist sehr emotionslos. Was ich aus dem Text entnehmen konnte, ist sein Charakter einfach so. Das finde ich gut, kommt aber ein wenig zu kurz. Auch wenn der Text nur ein kurzer Abriss eines umfangreicheren Manuskripts ist, hier könntest du ein wenig mehr auf diese Charaktereigenschaft eingehen.
Außerdem hätte er physikalische Teil für mich noch etwas umfangreicher sein können, aber es gibt sicher genug Stimmen, die genau das Gegenteil fordern würden. Somit würde ich sagen: du hast eine gute Mitte getroffen.
Ich würde mich freuen, mehr davon lesen zu können, vielleicht die ganze Geschichte auch einmal als Buch in den Händen halten zu dürfen.
WEITER SO!
_________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein |
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  07.10.2014 13:33 07.10.2014 13:33
von Zeitenträumer
|
  |
|
Hallo zusammen,
vielen Dank für Lob, Tadel und die konstruktive Kritik! Ich möchte kurz auf eure Anregungen eingehen, bevor ich eine überarbeitete Version einstelle.
Bibiro:
Da ich eigentlich unbedingt aus personaler Perspektive erzählen will und mir dieser Fauxpas nicht aufgefallen war, danke ich dir ganz besonders für diesen ersten Hinweis! Ich war schon etwas irritiert, als ich in deinem Kommentar zum anderen Teil des Prologs (den ich überarbeiten werde, sobald ich Zeit habe) davon las, aber du hast natürlich völlig Recht.
Timmytoby:
| Zitat: | Zitat:
„Sind Sie noch da? Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, und deshalb können wir es nicht, doch sie führen uns direkt zum ersten der beiden Typen von Zeitreisen, die es theoretisch gibt: die Reise in die Zukunft.“
Die Frage zu Beginn hört sich für mich hölzern an. |
Die alte Professorin folgt einem mir bekannten Vorbild, weshalb ich von der Formulierung nicht abweichen kann ... 
| Zitat: | Die Referenz zu ET ist ein bisschen altbacken (das sind jetzt 33 Jahre). Das kann natürlich beabsichtigt sein, weil sie eine alte Frau ist. Gerade unter Physikern würde ich aber eher Popkultur-Anspielungen erwarten die sich mehr über die UFO-Theoretiker lustig machen. Statt ET einen Grey oder anderen Alien zu verwenden, würde sich für mich frischer anfühlen.
ET als Beispiel zu nehmen fühlt sich für mich auch leicht herablassend an, da es ein Film für Kinder war. |
Sie ist alt genug, denke mit Alien kann sie nicht viel anfangen ... aber vor allem ist doch ET nicht "nur" ein Kinderfilm!
Bibiro & Timmytoby:
Ich sehe die Kritik an "hutzelig" ein, aber bislang ist mir noch nichts Besseres eingefallen. Gesucht ist ein Wort / eine Beschreibung, die die alte Frau als faltig, aber liebenswert erscheinen lässt. "Schrumplig" ist mir zu abwertend, die Nomen passen nicht so gut zum Beobachter, finde ich. Werde ich noch drüber brüten.[/quote]
Papa Schlumpf:
| Zitat: | | Über Einzelheiten reden wir jetzt nicht, es ist ja kein Lehrbuch (genau dort, wo die Raumzeit interessant wird und wirklich schwer verständlich, lässt Du eine Lücke). Mir fehlt aber ein Stück weit die philosophische Dimension des Problems. Die Zeitreise ist kein rein physikalisches Phänomen, wie nichts in der modernen physikalischen Grundlagenforschung, jede Antwort eröffnet ein Universum neuer Fragen, naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher. |
Ja, es ist schwer, dem Einen ist es zu viel, dem Anderen zu wenig. Das wird sich wohl leider nicht ändern lassen. Was die Philosophie betrifft, so habe ich sie bewusst erstmal weggelassen (was ich, da mir dieses Problem bewusst ist, die Vortragende auch ankündigen lasse); sie wird im späteren Verlauf noch thematisiert.
mtep:
| Zitat: | | Was mir aufgefallen ist: Der "Beobachter" ist sehr emotionslos. Was ich aus dem Text entnehmen konnte, ist sein Charakter einfach so. Das finde ich gut, kommt aber ein wenig zu kurz. |
Ja, er ist (fast) vollkommen emotionslos. Das ist beabsichtigt - ich wüsste nicht, wie ich es noch mehr herausstellen sollte.
| Zitat: | | Ich würde mich freuen, mehr davon lesen zu können, vielleicht die ganze Geschichte auch einmal als Buch in den Händen halten zu dürfen. |
Allerdings - mich auch ...
Einar:
Auch ein Kompliment (wenn es eines war) ist immer eine willkommene Rückmeldung! Danke.
Tja, und der Schnösel.... ich verstehe die Kritik, denn tatsächlich impliziert Schnösel eine gesellschaftliche Arroganz, während Kleins Arroganz eine intellektuelle ist. Daher habe ich mich (vorläufig) für "Streber" entschieden.
Ansonsten habe ich die meisten eurer Anregungen umzusetzen versucht.
Viele Grüße an alle,
David
|
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  07.10.2014 13:40 07.10.2014 13:40
von Zeitenträumer
|
  |
|
So, und hier die neue Version. Ich bin nach wie vor dankbar für weitere Verbesserungsvorschläge und Meinungen.
Heute
Der Beobachter in der letzten Reihe ließ sich tiefer in den Sitz sinken. Seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. Er wusste, dass sich keiner der Anwesenden nach dem Vortrag an ihn erinnern würde. Es war seine Aufgabe, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und er hatte diese Fähigkeit über lange Jahre perfektioniert.
Hätte er die Frau dort vorne an der Kanzel beschreiben sollen, wäre ihm wohl als erstes das Wort „hutzelig“ in den Sinn gekommen. Sie war, wie er aus seiner Recherche wusste, 76 Jahre alt, hätte jedoch nach ihrem Äußeren noch älter sein können. Natürlich war sie damit weitaus jünger als er selbst, auch wenn er sein genaues Alter nicht kannte; ihm aber sah man seine Jahre nicht an. Er hätte vermutlich die heitere Gelassenheit geschildert, mit der sie die immer noch in den Saal strömenden Menschen betrachtete, und den Schalk, der in ihren Augen blitzte; vielleicht hätte er sogar erwähnt, dass sie ihm überraschend sympathisch war. Überraschend, weil er sich Gefühle für andere Menschen schon vor langer Zeit abgewöhnt hatte. Sympathie spielte für seine Aufgaben keine Rolle, sondern war im Gegenteil hinderlich, und ganz sicher würde er die alte Physikerin niemals jemandem beschreiben. Wenn sie sich als geeignet erwies, würde er lediglich ihren Namen und Wohnort übermitteln: Adaliz Mirabeau, Paris. Nicht mehr.
Denn er war das Auge des Hohen Rates, und das Auge sprach nicht, ebenso wenig wie die Stimme handelte oder die Hand beobachtete. Das Auge sieht. Die Stimme spricht. Die Hand straft. Der Geist führt. Das waren die Gesetze des Hohen Rates, und keinem der Ratsmitglieder wäre es eingefallen, sie zu verletzen. Er hatte niemals ein Mitglied des Rates zu Gesicht bekommen; er wusste nicht einmal, wie er von ihrer Existenz erfahren hatte. Er konnte nicht sagen, woher er die Gesetze des Rates kannte und wie der Geist ihm seine Anweisungen übermittelte, doch diese Anweisungen waren überaus klar, und sie zu befolgen das einzig Wichtige auf der Welt.
Es schien, als wolle Madame Mirabeau beginnen, denn das Gemurmel unter den Zuhörern erstarb. Die Vorträge der Physikerin waren für ihre Unterhaltsamkeit berühmt, wurden im Netz verbreitet wie sonst nur unrealistische Stunts und alberne Katzenvideos, und sie galt trotz ihres Alters als führende Kapazität auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Vor allem gab es angeblich niemanden auf dem Planeten, der so viel über das Wesen der Zeit wusste wie sie, und das war der Grund seiner Anwesenheit. Der Inhalt der Veranstaltung interessierte ihn höchstens am Rande.
‚Finden Sie jemanden, der wirklich etwas von der Zeit versteht’, lautete der Auftrag des Geistes. Das war es, was er konnte: Menschen finden. Die richtigen Menschen. Er lehnte sich zurück und wartete.
„Die Zeit“, begann Adaliz Mirabeau nach einer kurzen Begrüßung, „ist wohl eines der vertrautesten Dinge in unserem Leben. Wir wollen sie uns vertreiben, sie ausnutzen oder totschlagen. Wir sagen, die Zeit fliege oder fließe zäh, sie rinne uns durch die Hände, sie sei Geld. Wir ärgern uns, wenn wir sie vergeuden und freuen uns, wenn wir sie sparen. Und nicht zuletzt nagt die Zeit mit ihrem unerbittlichen Zahn an uns, wie man an meiner Wenigkeit sehen kann.“ Die alte Dame schmunzelte. „Dennoch gibt es aus wissenschaftlicher Perspektive kaum etwas, das wir so wenig begriffen haben, wie die Zeit. Ich möchte Ihnen am heutigen Abend eine Vorstellung davon geben, wie weit wir mit unseren Bemühungen gekommen sind und was uns zum Verständnis fehlt. Insbesondere geht es, wie Sie dem Titel dieser Veranstaltung entnommen haben werden, um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen.“
Der Vortrag war unter dem Titel ‚Zeitreisen und die damit verbundenen Paradoxa‘ angekündigt worden.
„Ich verspreche Ihnen“, fuhr Mirabeau fort, „dass ich Sie weder mit den zahllosen Versuchen der Philosophen, den Zeitbegriff zu erklären, noch mit den Formeln der Physiker langweilen werde. Monsieur Klein hier“, – sie wies auf den jungen Mann neben sich, der ihr Assistent zu sein schien – „könnte Ihnen all das, was ich Ihnen an Merkwürdigkeiten vorsetzen werde, auch mathematisch begründen und täte sicherlich nichts lieber als das, denn Monsieur Klein liebt Zahlen. Da ich aber annehme, dass die meisten von Ihnen diese Liebe nicht teilen, möchten wir Sie bitten, uns auch ohne diese Beweisführungen zu glauben.“
Im Publikum erhob sich verhaltenes Gelächter. Der Beobachter hatte diesen Monsieur Klein mit der Brille und der großen Nase bislang nicht wirklich beachtet, doch sein Gespür für Persönlichkeiten lieferte ihm eine schnelle Einschätzung: ein junger, erfolgreicher Wissenschaftler, der die Arroganz des brillanten Denkers aus allen Poren ausdünstete.
„Es soll heute auch nicht um technische Schwierigkeiten von Zeitreisen gehen“, fügte Mirabeau hinzu, „obwohl nicht absehbar ist, ob und wann wir diese überwinden können – einige Physiker gehen davon aus, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen und das Ziel in ein paar Jahren oder Jahrzehnten erreichen werden, während andere vermuten, dass die menschliche Zivilisation gar nicht lange genug existieren wird, um die erforderlichen Technologien zu entwickeln. Zu letzteren gehöre auch ich. Andererseits: Wenn Wissenschaftler behaupten, etwas sei unmöglich, liegen sie meistens falsch. Wie dem auch sei, heute Abend möchte ich keine Technik diskutieren, sondern einige grundsätzliche Überlegungen zu Zeitreisen und der Zeit im Allgemeinen mit Ihnen teilen.“
Mirabeau nickte dem Assistenten zu, und Klein startete eine Powerpoint-Präsentation. Auf der Leinwand über dem Podium erschien das Porträt eines Mannes mit wirrem, weißen Haar und heraushängender Zunge, ein Bild, das wohl beinahe jeder Mensch in der westlichen Welt schon einmal gesehen hatte.
„Albert Einstein hat unser Verständnis der Zeit verändert“, fuhr Mme Mirabeau fort. „Er fand heraus, dass die Zeit nicht so absolut ist, wie sie uns erscheint. Wie schnell die Zeit vergeht, hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, von denen der bekannteste sicherlich die Geschwindigkeit ist, mit der wir uns bewegen. Kurz gesagt: je schneller wir sind, desto langsamer vergeht die Zeit. Zu Einsteins Zeiten war dieser Effekt bloße Theorie, doch mittlerweile wurde er viele Male experimentell bestätigt. Das ist ganz einfach: Wir schicken eine unserer genauesten Uhren mit einem unserer schnellsten Flugzeuge um die Welt, und hinterher geht sie im Vergleich zu einer zweiten, am Boden befindlichen Uhr einige Sekundenbruchteile nach. Die Zeit im Flugzeug ist also langsamer vergangen. Wenn Ihr Partner ruhig im Bett liegt und schläft, Sie selbst jedoch aufstehen, in die Küche gehen und sich einen Kaffee holen, sich also durch den Raum bewegen, wird Ihre Zeit ein wenig langsamer laufen als die ihres Partners.“
Der Beobachter bemerkte eine kurze Unruhe im Publikum; Köpfe wurden zusammengesteckt und einige kicherten. Paare, dachte er. Alberne Scherze gehörten wohl in fast jeder Beziehung zum Alltag. Er wusste nicht, ob er jemals eine Beziehung geführt hatte, bezweifelte es jedoch.
„Ähnlich verhält es sich mit der Gravitation“, fuhr Mirabeau fort. „In der Nähe eines sehr schweren Objektes, unter dem Einfluss starker Schwerkraft, vergeht die Zeit langsamer. Ein solches Objekt ist beispielsweise die Erde, und ob Sie es glauben oder nicht: Wenn Sie nicht mindestens die Hälfte Ihres Lebens im Kopfstand verbracht haben, ist Ihr Kopf älter als Ihre Füße, wenn auch nur um eine kaum messbare Zeit.“ Die alte Dame sah prüfend ins Publikum. „Sind Sie noch da? Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, und deshalb können wir es nicht. Dennoch führen sie uns direkt zum ersten der beiden Typen von Zeitreisen, die es theoretisch gibt: zur Reise in die Zukunft.“
Der Beobachter schweifte mit seinen Gedanken ab. Er hatte von dieser Art der Zeitreise gehört: wenn man eine Weile in einem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit umher flog und dann zur Erde zurückkehrte, waren dort viele Jahre vergangen, während man selbst nur wenige Stunden unterwegs gewesen war – man war in die Zukunft gereist. Solche Dinge hatten ihn nie sonderlich interessiert, und er wusste, dass auch dem Geist des Hohen Rates nicht daran gelegen war. Der Geist interessierte sich für Reisen in die Vergangenheit.
Über die wahren Beweggründe des Ratsvorsitzenden wusste der Beobachter wenig. Früher einmal hatte er Vermutungen darüber angestellt, welche Ziele der Hohe Rat verfolgte, doch wie so viele Dinge hatte er sich auch das Spekulieren im Laufe der Jahre abgewöhnt. Er erinnerte sich nur dunkel an den jungen Mann, der vor langer Zeit in den Dienst des Rates getreten war. Manchmal, in philosophischen Momenten, fiel ihm der Name des jungen Mannes ein, ein Name, der nicht mehr der seine war, ebenso wenig wie er noch ein Alter oder eine Nationalität besaß. Die Physikerin sprach für eine Französin recht gut englisch, doch für ihn spielte es keine Rolle; sie hätte ebenso gut deutsch, russisch oder Suaheli sprechen können. Das Auge war auch das Ohr des Rates, und es gab kaum eine Sprache, die ihm nicht geläufig war. Hätte sein Körper nicht mit einem untrüglichen Beweis aufgewartet, er hätte wohl sogar sein Geschlecht vergessen. Er wusste nicht einmal mehr genau, wann sich sein Geist dieser äußeren Merkmale entledigt hatte, doch es musste ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als er die Schriften des Wissens gefunden hatte und das Auge des Hohen Rates geworden war.
Madame Mirabeau setzte ihre Ausführungen fort. Auf der Leinwand war ein transparenter Würfel erschienen, anhand dessen sie offenbar die Beschaffenheit der Raumzeit erklärte.
„Was gleichzeitig geschieht ist jedoch keineswegs so eindeutig, wie es scheint“, sagte sie gerade. „Nehmen wir an, das sind wir.“ Der Assistent hob die Fernbedienung und ließ ein grünes Männchen in einer Ecke des Würfels erscheinen. „Wir sitzen in unserem ruhigen, sicheren Seitenarm der Milchstraße und zweifeln nicht an unserem Jetzt. Zum anderen haben wir unseren außerirdischen Freund ET, der drei Millionen Lichtjahre entfernt auf seinem Heimatplaneten wohnt.“ Eine rote Figur mit dünnem Hals und riesigen Augen erschien auf der anderen Seite des Würfels. „Befinden wir uns beide in Ruhe, können wir uns auf ein gemeinsames Jetzt einigen. Aufgrund der riesigen Entfernung zwischen uns können jedoch schon geringfügige Bewegungen großen Einfluss darauf ausüben, was wir als gleichzeitig wahrnehmen. Wenn ET sich beispielsweise auf uns zu bewegt, könnten Ereignisse, die für uns noch weit in der Zukunft liegen, für ihn bereits geschehen sein. Er könnte, wenn wir die Schwierigkeiten bei der Nachrichtenübermittlung beiseite lassen, im Fernsehen auf seinem Planeten live beobachten, wie Ihre Enkeltochter hier auf der Erde einen Nobelpreis gewinnt. Nun haben wir ein großes Problem, denn wer von uns hat recht mit seinem Jetzt-Begriff?“ Mirabeau stemmte die Hände in die Hüften und setzte eine strenge Miene auf; dann lächelte sie wieder. „Keine Angst. Wir alle wissen, dass die Zeit nur in eine Richtung verläuft. Niemals setzt sich ein zerbrochener Teller spontan wieder zusammen, nie erheben sich die gelben und roten Blätter eines Baumes vom Boden, um sich an ihre Äste zu heften und zu ergrünen. Und wie gesagt, jünger wird leider auch keiner von uns. Wir Physiker sprechen vom Zeitpfeil. Erst wurde Ihr Großvater geboren, dann Ihr Vater und schließlich Sie selbst.“ Sie breitete die Arme aus. „Et voilá – schon sind wir beim bekanntesten Zeitreise-Paradoxon der Welt.“
Der Beobachter versprach sich keinen Gewinn davon, weiter zuzuhören. Stattdessen öffnete er all seine Sinne, um die Persönlichkeit der alten Dame zu ergründen, sie zu sehen, zu hören und zu spüren, während ihre Worte bedeutungslos an ihm vorüberzogen; die Zuhörer folgten in gespannter Stille, die nur von gelegentlichem Lachen unterbrochen wurde.
Neben den gewöhnlichen Sinnen nutzte er auch seine besonderen Fähigkeiten – Fähigkeiten, die in der Welt schon lange vergessen waren und die nur noch die Mitglieder des Hohen Rates beherrschten. Natürlich gab es Menschen mit außergewöhnlichen Begabungen; kaum jemand wusste das besser als er, denn zumeist bestand seine Aufgabe darin, solche Personen zu finden. Doch bevor diese Leute in die Dienste des Rates traten, konnte man nicht davon sprechen, dass sie ihre Talente beherrschten. Nur mit den Schriften des Wissens konnten sie sie vollständig entwickeln, und diese Schriften beruhten auf den Lehren der Druiden von einst. Gelegentlich malte er sich aus, einen der alten Zauberer zu treffen, und fragte sich, ob das der Grund der Besessenheit des Ratsvorsitzenden für Zeitreisen war, doch stets verblassten diese Fragen rasch und verschwanden im Strudel der bedeutungslosen Realität.
Er grub tiefer im Wesen der alten Frau, während sie dem Publikum unlösbare Zeiträtsel erklärte. „Sie wissen vielleicht, dass wir Physiker auf der Suche nach einer Theorie sind, einer einzigen Formel, die alle physikalischen Gesetze umfasst und beschreibt“, sagte sie. „Zeitungen schreiben oft vom Heiligen Gral der Physik, aber wir nennen sie schlicht die Große Vereinheitlichte Theorie. Nehmen wir an, Monsieur Klein hier reist fünf Jahre in die Zukunft und findet heraus, dass die Formel veröffentlicht wurde, und zwar von mir. Er liest die Theorie und ist überwältigt: Der Menschheit stehen nun große Entwicklungen bevor. Frohgemut kehrt er zurück und wartet, muss aber zwei Jahre später feststellen, dass ich an allem Möglichen arbeite, nur nicht an der Theorie. Etwas beunruhigt sagt er sich, dass ich ja noch drei Jahre Zeit habe, doch als er sich nach weiteren zwei erkundigt, habe ich immer noch nicht eine Zeile zu Papier gebracht und werde zudem langsam senil. Jetzt macht er sich ernsthaft Sorgen, und als es ein halbes Jahr später immer noch nicht besser aussieht, beschließt er, einzugreifen. Da er die Theorie gelesen hat, ist es ihm ein Leichtes, mich bei unserem nächsten Treffen auf die wichtigsten Zusammenhänge hinzuweisen, und ein halbes Jahr später erscheint das große Werk – doch wer ist der Urheber? Ich, die ich ohne Monsieur Klein vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre, an der Sache zu arbeiten? Oder er, der ohne die Lektüre meiner Theorie vielleicht nie im Leben auch nur das erste Axiom gefunden hätte? Oder ist gar Wissen aus dem Nichts entstanden?“
Adaliz Mirabeau schien keinerlei Hintergedanken zu hegen, sondern sprach mit einer fröhlichen Begeisterung für die Sache, ohne Eitelkeit oder andere egoistische Motive. Die jugendliche Heiterkeit und die Neugier, die aus ihren Augen sprachen, verbanden sich mit einer gewissen Milde, einer Altersweisheit und Gelassenheit, die der verhärtete Geist des Beobachters nur schwer ertrug. Gerade beendete sie ihre Ausführungen mit dem charakteristischen „Sind Sie noch da?“, doch in ihren Worten schwang nicht die Spur von Herablassung oder Spott. Ihr Lächeln verkündete, dass sie jedem einzelnen der Zuhörer auch das kleinste Detail geduldig erklären würde, bis er es verstand. Diese Frau, da war er sicher, war durch und durch gut.
Sie war vollkommen ungeeignet für die Zwecke des Hohen Rates.
Er war bereits im Begriff aufzustehen, als sein Blick erneut auf den Assistenten fiel. Monsieur Klein stand ungelenk neben dem Rednerpult, die Hüfte leicht eingeknickt, und fingerte an der Fernbedienung in seiner Hand herum. Mit einer fahrigen Bewegung rückte er seine Brille zurecht, und es war offensichtlich, wie sehr er die Zuhörer im Saal verachtete, für wie ausgesprochen begriffsstutzig er sie hielt. Der Beobachter lehnte sich wieder zurück und richtete seine Aufmerksamkeit auf den jungen Mann.
Selten hatte er in einem solch scharfen Verstand geforscht. Eine Fülle von äußerst präzisen Gedanken prasselte auf ihn ein, von deren Inhalt er kaum etwas verstand; offenbar löste Klein nebenbei komplexe mathematische Gleichungen. Mit einem leisen Kopfschütteln konzentrierte der Beobachter sich auf das Wesen und die Gefühle des Assistenten. Klein war von enormem Ehrgeiz getrieben, und die Verachtung, die er dem Publikum entgegenbrachte, galt in geringerem Maß auch für Madame Mirabeau, die nicht einmal in der Lage war, einen Beamer zu steuern. Kaum einmal hatte der Beobachter jemanden gesehen, dessen Geist sich in einem derartigen Ungleichgewicht befand, gewissermaßen das genaue Gegenteil zu der alten, in sich ruhenden Physikerin. Klein musste ein sehr unzufriedener Mensch sein, auch wenn dies nur eine oberflächliche Analyse war.
Möglicherweise bist du es, den ich gesucht habe. Ehrgeiz war ein wunderbarer Hebel, um jemanden zu manipulieren. Für die Stimme des Hohen Rates würde es eine Kleinigkeit darstellen, diesen Mann dazu zu bringen, genau das zu tun was der Geist wollte.
Er lehnte sich wieder zurück, um das Ende des Vortrags abzuwarten. Madame Mirabeau war offenbar bei den entscheidenden Schlussfolgerungen angelangt, doch da er ihren Ausführungen nicht gefolgt war, verstand er nicht alles, was sie sagte.
„Wir haben also gesehen, dass die gesamte Raumzeit, der gesamte Würfel, existiert“, verkündete sie gerade. „Der Fluss der Zeit, der uns so vertraut ist, scheint hingegen ein unzutreffendes Bild zu sein, das nur im menschlichen Geist eine Zuflucht hat und einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhält. Es sei denn, Sie messen ihrem eigenen Standpunkt eine größere Bedeutung zu als dem eines beliebigen anderen Individuums irgendwo im Universum, wie zum Beispiel ET. Verschiedene Beobachter können höchst unterschiedlicher Ansicht darüber sein, welche Ereignisse gleichzeitig geschehen. Mein Jetzt könnte sich von Ihrem Jetzt fundamental unterscheiden, und ein Beobachter in zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung wird mit großer Sicherheit einen vollkommen anderen Jetzt-Begriff haben, der für ihn jedoch genauso real ist, wie unserer für uns. Ich weiß, es ist kaum vorstellbar, denn unsere Wahrnehmung erzählt uns Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, eine andere Geschichte, aber alle Erkenntnisse der modernen Physik weisen darauf hin, dass es sich so verhält. Wenn wir Einstein glauben, ist jeder Punkt der Raumzeit, liege er für uns nun in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft, vollkommen gleichberechtigt mit jedem anderen Punkt.“ Sie machte eine Pause und sah fast mitleidig ins Publikum. „Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich möchte ihnen zum Schluss noch kurz deutlich machen, was diese Erkenntnisse für unser Problem der Zeitreise in die Vergangenheit bedeuten. Können Sie nun, vorausgesetzt, Sie haben eine Zeitmaschine, Ihren Vater erschießen oder nicht?“
Amüsiert registrierte der Beobachter einen leisen Anflug von Interesse irgendwo weit hinten in seinem Gehirn – wie lange war es her, dass ihn etwas wirklich interessiert hatte? –, aber er wusste, dass es zu spät für ihn war, sich zu begeistern. Zu lange hatte er sich allen weltlichen Inhalten verschlossen; zu lange war er das Auge des Hohen Rats gewesen. Kurz meinte er sogar etwas zu spüren, das früher einmal Neid gewesen wäre, Neid auf diese alte Dame, die trotz ihrer Jahre so viel Freude am Leben empfand, doch es schien gleichsam das Gefühl eines anderen Menschen zu sein, das Gefühl des jungen Mannes mit dem Namen und der Nationalität, dem Alter und dem Geschlecht. Er unterdrückte ein Gähnen.
„Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen“, sagte Madame Mirabeau. „Momentan scheint es höchst unwahrscheinlich, dass es jemals möglich sein wird, in die Vergangenheit zu reisen. Ich selbst gehöre zu denen, die vermuten, dass es sich nicht nur technisch, sondern auch prinzipiell als unmöglich erweisen wird. Es ist allerdings bemerkenswert, dass wir kein physikalisches Gesetz entdecken, das dagegen spricht. Wir können die Unmöglichkeit von Vergangenheitsreisen trotz aller Bemühungen nicht beweisen.“ Sie lächelte ihr sanftes Lächeln. „Wenn es aber doch möglich sein sollte, so vermeidet die allgegenwärtige Existenz der gesamten Raumzeit jegliches Paradoxon. Wenn die gesamte Raumzeit existiert, wenn jedes Ereignis unveränderlich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattfindet, dann ist es nicht möglich, ein solches Ereignis zu beeinflussen. Die Tatsache, dass Sie existieren, schließt aus, dass Ihr Vater vor Ihrer Zeugung erschossen wird; denn Kausalität ist ein unumstößliches Prinzip. Man kann sich unzählige Möglichkeiten ausdenken, was geschähe: Sie schießen daneben, der Abzug der Waffe klemmt, jemand läuft dazwischen oder Sie entscheiden sich im letzten Moment um und lassen den armen Mann leben. Jeder Augenblick in der Raumzeit existiert. Für immer. Es ist schwer, diese Beschreibung des Universums zu akzeptieren, denn unsere alltägliche Erfahrung trennt so eindeutig und entschlossen zwischen dem, was war, was ist und was sein wird. Doch wie Einstein es einmal sagte: Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion – wenn auch eine hartnäckige.“ Immer noch lächelnd deutete Adaliz Mirabeau eine Verbeugung an. „Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Möge Ihr Leben noch viele wunderbare Jetzt-Erlebnisse für Sie bereithalten.“
Für einen Moment saßen die Zuhörer wie betäubt da; dann brandete tosender Applaus auf, der minutenlang anhielt und der alten Frau etwas peinlich zu sein schien. Während die Menschen langsam aus dem Saal strömten und Monsieur Klein sich daran machte, den Laptop herunterzufahren, betrachtete der Beobachter den schlaksigen jungen Mann. Es war, so vermutete er, nicht das letzte Mal, dass er diesen Streber zu Gesicht bekommen würde. Schon bald würde er für den Hohen Rat arbeiten – die Stimme konnte außerordentlich überzeugend sein. Und sollte sie wider Erwarten scheitern, käme die Hand des Rates ins Spiel; und dann würde es für den klugen Monsieur Klein sehr, sehr unangenehm werden.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Timmytoby
 Gänsefüßchen Gänsefüßchen

Alter: 42
Beiträge: 41
|
  07.10.2014 17:13 07.10.2014 17:13
von Timmytoby
|
 |
|
Die neue Version hat mir sehr gut gefallen.
Hätte jetzt auf Anhieb auch nichts mehr zu beanstanden. Dein Text liest sich flüssig, macht neugierig und zeichnet ein lebhaftes Bild der Figuren 
|
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  10.10.2014 01:23 10.10.2014 01:23
von Zeitenträumer
|
  |
|
So, erstmal bibiro vielen Dank für deine Kritik, denke ich habe alles umgesetzt. Zudem auch noch einmal gestrafft. Der Text ist nach wie vor zur kritischen Vernichtung freigegeben. Besten Dank!
Aedrini, 13. Jahr, 25. Zyklus
Die Augen des Gehörnten ruhten auf ihm, unergründlich, ewig. Der Druide betrachtete das steinerne Abbild des Gottes, halb Mensch, halb Hirsch, der mit gekreuzten Beinen dasaß, die Widderkopfschlange um den Hals gelegt.
Dich, Cernunnos, dachte er. Insgeheim fürchten sie Dich am meisten. Sie alle. Er lächelte. Ungezählt und vielgestaltig waren die Unsterblichen, doch keiner, so glaubte er, flößte den Menschen so viel Respekt ein wie der Gott mit dem Hirschgeweih: Cernunnos, der Gehörnte, Herrscher über die Anderen Welten.
Der Druide schloss die Augen. „Ich bin der ewige Strom des Flusses“, murmelte er in einer alten Sprache, die nur wenige verstanden. „Ich bin das Allessehende Auge. Ich bin die Waage der Wahrheit. Ich bin die Kraft der Eiche. Sieh durch meine Augen, o Cernunnos, sprich mit meiner Stimme, urteile durch meinen Geist, strafe, wenn es sein muss, durch meine Hand. Und es wird besser sein und nicht schlechter.“
Wie alle Barden und Druiden kannte er die Verse des Rechts, kannte sie besser als die meisten, doch Recht in dieser Welt war etwas anderes als die Gerechtigkeit des Gehörnten, die ewigen Gesetze des Alls und der Zeit. Jeder würde am Ende seines Lebens durch den Schleier in die Anderen Welten gehen, und dort entschied allein Cernunnos über das Dasein und die Wiederkehr eines jeden. Das ist es, was sie so sehr an Dir fürchten. Die Gerechtigkeit.
Der Druide seufzte. Er hatte die Pflichten, die vor ihm lagen, für einen Moment vergessen können, doch die Schatten verrieten ihm, dass es beinahe Mittag war. Wenn Belenos‘ Auge am höchsten stand, würden sich die Sippen der Haeduer auf dem Neunquell in Bibracte versammeln und von ihm erwarten, dass er Recht sprach – ein Recht, das keinem genug war, hatten doch alle zu wenig. Er kniete vor der Statue nieder, um eine letzte Bitte um Weisheit an den Gehörnten zu richten, der ihn gleichgültig anzusehen schien, als wolle er sagen: Ich sehe, die Menschen leiden, doch was soll ich tun? Sie bestimmen selbst über ihr kleines Leben in dieser Welt. Mich kümmern sie nicht, bis sie wieder durch den Schleier gehen.
Der Druide berührte mit der Linken seinen Torques, den goldenen Ring um seinen Hals, und senkte den Kopf; mit der Rechten formte er eine Schale und führte sie langsam aufwärts, bis das Handgelenk die Stirn berührte: das Zeichen der Weisheit. Dann erhob er sich, strich sein Gewand glatt und verließ das Heiligtum.
Kinderstimmen drangen an sein Ohr – Dagomaros und die Kleineren vermutlich, die wieder und wieder den Krieg der Haeduer gegen die Sequaner nachspielten, allerdings mit günstigerem Ausgang als in der Wirklichkeit; denn die Sequaner hatten mit Versprechungen von Land und Gold den Suebenkönig Ariovist über den Rhenos gerufen, dessen Krieger die Felder der Haeduer verwüstet und ihre Rinder gestohlen hatten. Vor zwei Jahresläufen war die Lage der Haeduer immer verzweifelter geworden; viele Krieger waren gefallen und es herrschten Hunger und Krankheit unter den Sippen. In jenem Jahr hatte der Druide das Amt des Vergobret innegehabt und war nach Rom gereist, um den Senat um Hilfe zu bitten. Er war Gast des Marcus Tullius Cicero gewesen, eines der edelsten Männer Roms, und überaus ehrenhaft behandelt worden, doch anstelle schlagkräftiger Legionen hatten ihm die Senatoren vage Versprechungen mit in die Heimat gegeben und nichts war geschehen. Nach diesem Misserfolg hatte er das Amt des Vergobret niedergelegt, auf Druck jener Sippen, die seine enge Verbindung zu Rom immer mit Argwohn betrachtet hatten; das Amt war auf seinen Bruder Dumnorix übergegangen, der diesen Argwohn teilte und aufgrund seines Reichtums und seiner Freigebigkeit überaus beliebt im Volk war. Auch er war jedoch machtlos gewesen: Im letzten Jahr hatte Ariovist die Haeduer bei Magetobriga vernichtend geschlagen, und spätestens seit dieser Niederlage hatte sich der Geist von Armut und Elend fest unter den Sippen eingenistet und wurde von Tag zu Tag mächtiger.
Es war Dumnorix gelungen, Frieden mit Ariovist und den Sequanern zu schließen – einen Frieden, der die Haeduer teuer zu stehen kam. Die Reichen mussten Geiseln stellen und Tribut entrichten und deshalb noch höhere Abgaben von ihren Gefolgsleuten, Schuldnern und Hörigen fordern, um deren Schutz gewährleisten zu können, jedenfalls behaupteten sie das; denn neben dem Schaden durch Geiseln und Tribut hatten sie vor allem die Kontrolle über den Arar verloren, auf der ihr Wohlstand beruhte. Und keinem schadete dies so sehr wie Dumnorix selbst, hatte er doch einen großen Teil der Arar-Zölle über mehrere Winter hinweg gepachtet.
Entgegen seinem ursprünglichen Vorhaben betrat der Druide das Wohnhaus nicht. Er hatte nach Villús Fortschritten sehen wollen, doch in letzter Zeit war ihm immer häufiger danach, allein zu sein; gerade die Gegenwart Villús, der insgeheim immer sein Lieblingssohn gewesen und nun, wie er es sich erhofft hatte, sein Schüler geworden war, bedrückte ihn auf unerklärliche Art und Weise. Er kehrte dem Eingang den Rücken und ging um das Haus herum zu den Stallungen. Tala, Villús Lieblingspferd, tänzelte nervös und schnaubte, als er näherkam; der Druide tätschelte ihr abwesend die Nüstern und schob sich an ihr vorbei, um Prito zu satteln. Welch seltsame Schwermut mir der heutige Tag gebracht hat, dachte er. Oder ist es nicht vielmehr seltsam, dass ich so selten davon ergriffen werde? Gewiss, er verteilte Korn und selten auch Gold unter den Gemeinen und Hörigen des Stammes, doch das war nichts im Vergleich zu deren Leid. Dumnorix gab zwar umso mehr, war er doch ungleich reicher, doch der Druide wusste, dass sein Bruder einzig und allein seinen Einfluss zu stärken trachtete und dass seine Gaben die Not in Wahrheit eher mehrten denn minderten. Oft bereute er, Dumnorix den Weg an die Spitze der Macht geebnet zu haben, doch wer konnte den Stamm in diesen Zeiten besser führen als er?
Abermals seufzend schwang er sich auf Pritos Rücken. „Komm, alter Freund“, sagte er und klopfte den Hals des Rappen. „Was immer der Lauf der Zeiten am heutigen Tag bringen mag, wir werden es doch nur erfahren, wenn wir dabei sind.“
Das Gut der Sippe lag kaum eine Stunde zu Pferd von Bibracte entfernt. Der Druide hing seinen Gedanken nach, und so dauerte es eine Weile, bis er sich der drei Reiter bewusst wurde, die nebeneinander auf dem Weg verharrten als warteten sie auf ihn. Ihm blieb wenig Zeit, sie einzuschätzen, doch es handelte sich offensichtlich um Römer, von kleinerer Statur als die Kelten, kurzhaarig und rasiert und in edle Togen gekleidet. Er kniff die Augen zusammen und erkannte zu seiner Überraschung den Mittleren der drei, einen etwa fünfzig Winter zählenden Mann mit roten Wangen und leichtem Bauchansatz: Lucius Valerius Flaccus. Der Druide hatte ihn einige Male in Narbo getroffen, als er mit den römischen Machthabern verhandelt und Kontakte geknüpft hatte; die Valerii Flacci waren eine der einflussreichsten römischen Familien in Gallien und Hispania, und auch Lucius hatte verschiedene mächtige Ämter bekleidet. Er galt als kluger Staatsmann, jedoch kannte der Druide auch Gerüchte um eine dunkle Vergangenheit Flaccus‘ in den Ländern des Sonnenaufgangs. Seine Begleiter waren jünger und dem Druiden nicht bekannt; ihm schien, als sei einer der beiden gallischer Herkunft, denn sein Haupt war von dichtem blonden Haar bedeckt, wenn es auch nach römischer Mode frisiert war.
Er brachte Prito zum Stehen und hob die Hand zum Gruß, wie es in Rom Sitte war. Flaccus beugte sich zu dem Blonden hinüber und sagte etwas in römischer Sprache, die Diviciacos trotz seiner langjährigen Erfahrung mit den Italikern nur bruchstückhaft beherrschte. Der junge Mann grüßte zurück; Diviciacos bemerkte, dass er ein überaus energisches Kinn und stechende, blaue Augen hatte.
„Seid gegrüßt, Diviciacos, Sohn des Segomo“, rief er auf gallisch. „Möge die Freundschaft zwischen Rom und den Haeduern so lange andauern wie die Zeit. Ich, Gaius Valerius Trocillus, spreche für Lucius Valerius Flaccus, den Gesandten des römischen Senats. Wir bringen eine wichtige Botschaft für den Stamm der Haeduer.“
Trocillus? Diviciacos suchte in seinem Gedächtnis nach einer Erinnerung, und wie üblich fand er sie. Trocillus, Sohn des Caburus, vom Stamm der Helvier in der römischen Provinz. Gemeinsam mit seinem Vater vertritt er die Helvier im Magistrat. Er senkte den Kopf. „Esos schütze Euch auf Euren Wegen“, sagte er. „Wenn es sich um eine wichtige Nachricht für unseren Stamm handelt, so sollte sie dem Rat der Sippen vorgetragen werden.“
Wieder beugte sich Flaccus zu seinem Übersetzer und redete ruhig auf ihn ein. Diviciacos beobachtete die beiden genau und wurde auf einmal von einer unguten Vorahnung beschlichen; er spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufrichteten.
„Wir werden zum Rat sprechen, o Diviciacos“, sagte Trocillus. „Doch es gibt eine weitere Botschaft, die nur für Eure Ohren bestimmt ist. Daher kamen wir ohne Gefolge, um Euch allein zu sprechen.“
Der Mann hatte eine lauernde Art, die Diviciacos in keiner Weise gefiel. Sein Mund war auf einmal trocken.
„Ich bin auf dem Weg nach Bibracte, um Gericht zu halten“, sagte er. „Ihr müsst verstehen, dass meine Pflichten keinen Aufschub dulden.“
„So haltet Gericht“, erwiderte Trocillus; offenbar vertraute Flaccus seinem Übersetzer und ließ ihm weitgehend freie Hand. „Wir werden auf Euch warten.“
Diviciacos war froh, die Römer zunächst vertröstet zu haben, doch ihm war, als verfolge ihn der Blick des blonden Übersetzers bis zu den Mauern Bibractes.
Es war kühl und dunkel im Nemeton, dem heiligen Eichenhain auf der Kuppe des Neunquell. Düster blickten die Götter zwischen den knorrigen Bäumen hindurch, als beobachteten sie drohend jede kleine Handlung der Druiden am Opferschacht, stets bereit, ihren Zorn über die Sterblichen zu bringen. Jeder unter den Haeduern wusste eine Geschichte über diesen Ort zu erzählen, eine beunruhigender als die andere. Es hieß, es lebten dort keine Vögel und Tiere, lediglich die Hüter des Haines und die heiligen Schlangen in den Blätterkronen würden von den Unsterblichen geduldet. Das Laub der alten Bäume zittere unaufhörlich, sagten andere, auch wenn kein Wind blies, und man könne das Stöhnen der Erde und die Todesschreie der ungezählten Opfer hören, deren Blut sich über die Stämme der Eichen ergossen hatte. Viele schauderte es beim bloßen Gedanken an diesen Ort, an dem ewiger Schatten herrschte, und keiner von ihnen hätte jemals gewagt, ihn zu betreten. Diviciacos wusste nicht, wie viel Wahrheit in diesen Legenden lag. Wenn er zwischen den alten Bäumen wandelte, konnte er die Gegenwart der Götter spüren, doch er empfand sie nicht als bedrohlich – im Gegenteil, der heilige Hain übte stets eine beruhigende, erfrischende Wirkung auf ihn aus. Er warf einen Blick zu den Hütern; jeder der beiden erfahrenen Priester hielt einen Falken auf dem Unterarm.
Diviciacos schickte ein letztes stilles Gebet zu den Göttern und trat aus dem Hain hervor. Eine Menschenmenge hatte sich auf dem von hohen Bäumen und einer Palisade gesäumten Platz versammelt, wo die Barden und Druiden Recht sprachen und der Rat der Sippen zusammentrat, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Die beiden Hüter verharrten am Rande des Hains, während der Druide den flachen Felsen erklomm, den die Haeduer den Stein der Worte nannten. Er betrachtete die Wartenden; es waren größtenteils ärmere Gemeinfreie, Handwerker und Bauern, die den Schiedsspruch der Weisen suchten, jene, die gerade noch so viel hatten, dass es nicht zum Aufgeben reichte. Ihre Kleider waren einfach, und wenn auch die einen nach gallischem Brauch in Hosen, die anderen nach römischer Mode in Tunika erschienen waren, so glichen sich ihre Gewänder doch auf merkwürdige Art und Weise, denn die Farben der abgewetzten Stoffe waren längst verblichen und verschmolzen zu einer einförmigen Masse. Unruhig, unter gedämpftem Gemurmel, traten sie von einem Fuß auf den anderen und warfen scheue Blicke in seine Richtung. Als hätten sie sich bereits mit dem Unvermeidlichen abgefunden und kämpften nur noch aus Gewohnheit weiter, kam es ihm in den Sinn. Und dies sind nicht einmal die Ärmsten. Gegen solches Elend sind selbst die Götter machtlos. Er schlug viermal mit dem Stab auf den Boden, um sich Gehör zu verschaffen.
„Esos schütze euch auf euren Wegen“, rief er laut. „Ihr, die gekommen seid, um Recht zu erfahren, hört dies: Ich, Diviciacos, Sohn des Segomo, Erster Druide der Haeduer, Träger des Eichenstabes und Mitglied des Hohen Rates des Nemeton, kenne die Verse der Gerechtigkeit und die Zeichen des Schicksals. Wer gegen das Gesetz des Stammes verstößt, erzürnt die Götter und soll dafür bestraft werden, auf dass ihr Zorn nicht seine Stammesbrüder treffe.“ Prüfend ließ er seinen Blick über die Menge gleiten; die Menschen sahen mit ernsten Mienen zu ihm auf. „So legt nun die Kränze nieder zu Ehren Esos‘ des Allwissenden, der den Menschen das Wort brachte und der seine Hand über die Sippen der Haeduer hält.“
Viele hatten aus Zweigen geflochtene Kränze mitgebracht, welche sie nun einer nach dem anderen zu Füßen der Hüter ablegten, die ruhig am Rande des Hains warteten. Die beiden Priester packten die Falken mit einer schnellen Bewegung im Nacken; Diviciacos war der Vorgang so vertraut wie sein tägliches Bad in den Quellen, denn er hatte dies viele Male selbst getan: Er sah, wie die Vögel sich hilflos zu wehren versuchten, konnte förmlich spüren, wie ihr Gefieder unter panischen Atemzügen bebte und das kleine Herz wild klopfte. Rasch zogen die Hüter goldene, sichelförmige Messer vom Gürtel und ließen die scharfen Klingen über die Kehlen der Falken gleiten, nur so tief, dass das Blut in sanften, gleichmäßigen Schüben herausquoll. Ein Stöhnen ging durch die Menge; viele bewegten die Lippen im Gebet. Die Priester knieten nieder und benetzten achtsam jeden der Kränze mit dem Blut der Falken, während die Geister der Vögel auf ihre Reise durch den Schleier gingen und die Körper in den Händen der Druiden erschlafften.
„Belenos, Allsehender, der du jede Unwahrheit erkennst!“, rief Diviciacos. „Esos, Gütiger, dessen Samen unser Stamm entsprungen ist! Lasst meinen Geist klar sein, auf dass ich Euren Willen zu erkennen und weise zu entscheiden vermag. Ich, Diviciacos, Sohn des Segomo, Sohn des Cerdicis, gelobe bei den Göttern und den Ahnen, jeden zu beurteilen, wie es seinen Taten und seinem Stand gemäß ist.“
Natürlich wusste er bereits, welche Streitfälle zur Sprache kommen würden. Es kostete ihn keine Mühe, sich die Namen aller Beteiligten zu merken; niemals musste er etwas ein zweites Mal hören, um es sich einzuprägen. Er kannte die Namen unzähliger Tiere und Pflanzen ebenso wie die Legenden der Stämme und manch ferner Völker; er wusste vom Lauf der Gestirne und ihrer Bedeutung für das Schicksal der Menschen; er konnte Krankheiten heilen und Wunden verbinden und dafür sorgen, dass eine Kuh fruchtbar wurde. Vor allem aber waren die unzähligen Verse der Zwölf Mysterien tief in sein Gedächtnis eingebrannt, so tief, dass es keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und seinem eigenen Geist gab.
Er hieß jene vortreten, die etwas vorzubringen hatten. Das Gesetz gebot, dass die Sippe, deren Ehre den höchsten Preis hatte, ihr Anliegen zuerst schildern durfte, ein Brauch, der bereits häufig zu Streit im Vorfeld eines Gerichts geführt hatte, doch in diesem Fall gab es keinen Zweifel: Der Ranghöchste war Biracos, ein reicher Landbesitzer und Veteran einiger Schlachten, der zur Gefolgschaft des Dumnorix zählte. Seine Sippe gehörte zwar nicht zu den edelsten, doch stand ihm immerhin ein Sitz an der Ratstafel zu, und so gebot der Brauch, dass sein Anliegen Vorrang hatte. Wie es sich für einen Mann seines Standes gehörte, war Biracos mit Gefolge und einigen Verwandten erschienen, alle hochgewachsen und blond; er selbst mochte vierzig Winter zählen und stand in lässiger Haltung in ihrer Mitte. Als Anhänger des Dumnorix war er naturgemäß römerfeindlich gesinnt und trug daher nach gallischer Mode eine hellrot karierte Hose, ein ebensolches, ärmelloses Wams und einen gebleichten Schnurrbart; um seinen Hals lag ein schmaler, goldener Torques.
„Biracos, Sohn des Vindios“, rief Diviciacos laut. „Ihr seid gekommen, um die Verse des Rechts zu hören, die nichts anderes sind als der Wille der unsterblichen Götter. Wer wird für Euch sprechen?“
Die Mundwinkel des Kriegers kräuselten sich unter dem Schnurrbart leicht nach oben und er deutete eine Verbeugung an. „Eluskú, mein ältester Sohn, der im Gefolge des Eporedorix reitet, o Diviciacos“, verkündete er mit raspelnder Stimme.
Es war offensichtlich, dass der Mann die Ehre seiner Sippe herausstellen wollte, um ein günstigeres Urteil zu erzielen. Eporedorix, der Reiterkönig, war der Anführer der vielköpfigen Truppe, die Dumnorix sich hielt und mit eigenem Gold entlohnte und verpflegte, sodass sie sich ganz dem Kampf hingeben konnte. Er entstammte einer der edelsten Sippen, und es bedeutete eine hohe Ehre, in sein persönliches Gefolge aufgenommen zu werden. Eluskú, Sohn des Biracos, musste ein begnadeter Reiter sein.
Ob Ihr ein ebenso guter Redner seid?, dachte Diviciacos stirnrunzelnd. Er musterte den jungen Mann, der neben seinem Vater stand, die hellblonden Haare mit geflochtenen Zöpfen zusammengebunden, und hatte seine Zweifel. Ich würde bei allen Eichen schwören, dass Ihr noch keine zwanzig Winter gesehen habt.
„So sei es“, sagte er ruhig. „Bringt also Euer Anliegen vor, Eluskú, Sohn des Biracos.“
Der junge Krieger trat vor und warf den Kopf in den Nacken. „Ich bin Eluskú, Sohn des Biracos!“, rief er. „Bei Magetobriga erschlug ich acht Feinde, darunter drei Germanen. Ich reite in der Schar des Eporedorix, und den will ich sehen, der schneller und besser reitet als ich.“ Voller Eifer sah er in die Runde. „Ich spreche vor dem heiligen Hain der Götter für meine Sippe und meinen Vater Biracos, Sohn des Vindios, dem Unrecht geschehen ist. Unrecht durch jenen dort, der sich Licnos nennt!“ Abrupt wandte er sich um und deutete auf einen untersetzten Mann von etwa dreißig Wintern, der nervös seinen Schnurrbart zwirbelte und rasch den Blick senkte, als sich ihm die Augen des Druiden und der versammelten Menge zuwandten.
„Sprecht weiter. Welche Art von Unrecht?“
„Seht ihn Euch an!“, sagte Eluskú abfällig. „Dieser Mann ist Bauer und Hirte. Er besitzt ein wenig Land und einige Schweine und Rinder. Seit vielen Jahren erhält er Schutz von meiner Väter Sippe, ohne den die seine verloren wäre. Mein Vater war sogar so gütig, ihm den besten Bullen aus seiner eigenen Zucht zu leihen, auf dass seine Herde gedeihe.“
Es verlangte Diviciacos danach, den arroganten jungen Krieger zurechtzuweisen, jedoch verbarg er seine Gefühle; es war für ihn nicht mehr als Gewohnheit, sich nichts anmerken zu lassen. „Wie hoch sind die Abgaben, die seine Sippe der Euren für ihren Schutz zahlt?“
„Geradezu frevlerisch gering, o Diviciacos. Jeden Mond zur Rückkehr der Nacht ein Sechst seines Weizens und seiner Milch, und zum Samon, wie es sich gehört, ein Prachtschwein.“
„Ist er Euch etwas schuldig geblieben?“
Eluskú starrte ihn an, als sei er nicht recht bei Trost. „Bei den Neun Quellen, seht ihn Euch an! Er ist fett! Er lässt sich gehen und schmäht auf diese Weise die Götter! Er bringt Schande über die Sippe meiner Väter, und wie sollte er in diesem Zustand anständig arbeiten? Wir verlangen, dass sein Bauchumfang abgemessen wird, und zwar mit roten Linsen, so wie es der Ehre unserer Sippe entspricht! Für jede Linse soll er ein Kalb geben, um den Schaden zu ersetzen!“
Das waren die Worte, die zu sagen man ihm eingebläut hat, dachte Diviciacos. Welch törichter Fehler, einen solch einfältigen Jungen zum Sprecher der Sippe zu erklären, nur weil er eine ehrenhafte Stellung einnimmt. Trotz aller Selbstbeherrschung, die er sich in jahrelanger, harter Übung angeeignet hatte, fiel es ihm schwer, ruhig zu bleiben. Zwar gab es im Gesetz des Stammes die Möglichkeit, Fettleibigkeit zu bestrafen, aber dies war nichts anderes als ein dreister Versuch, einen hilflosen Mann zu enteignen und zu versklaven. Licnos, der Bauer, war sicherlich außerstande, eine solche Strafe zu begleichen – rote Linsen waren klein. Er würde Teile seines kärglichen Besitzes verpfänden müssen und bald immer tiefer in der Schuld der reichen Sippe stehen, schließlich weder Abgaben noch Schulden mehr aufbringen können und letzten Endes seinen Torques und damit seine Freiheit verlieren. Diviciacos hatte häufig machtlos zugesehen, wie solcherlei geschah. Er atmete tief durch.
Am heutigen Tag würde er die Verse gemäß der Gerechtigkeit des Cernunnos auslegen.
„Ihr seid gut beraten worden, Eluskú, Sohn des Biracos“, sagte er bedächtig. „Nicht viele kennen die Verse des Rechts so genau, dass sie ein solches Vergehen mit einer angemessenen Sühne belegen können.“
Der stämmige Bauer stieß einen spitzen Schrei aus und fiel auf die Knie. „Ich flehe Euch an, o Diviciacos …“
„Schweigt!“, fuhr ihn der Druide an „Es ist nicht gut, zwei Geschichten gleichzeitig zu hören.“ Er sah Eluskú in die Augen; um den Mund des jungen Kriegers spielte ein Lächeln.
„Er hat Euch also Käse, Milch und Schwein geliefert?“, fragte Diviciacos.
„Das wohl“, gab Eluskú zögernd zu. Das Lächeln verschwand.
„Dann nehme ich an, Eure Sippe wurde in ihrer Ehre verletzt, indem man Euch seinetwegen beleidigte und verspottete? Es fiel Euch, seit er so fett ist, immer schwerer, eure Töchter zu verheiraten?“
Der Krieger zuckte kurz und setzte zu einer zornigen Entgegnung an, beherrschte sich jedoch und verschränkte die Arme vor der Brust. „Er stellt durch seine schiere Gestalt eine Beleidigung unserer Ehre dar.“
„Erlaubt mir eine Frage, junger Reiter“, fuhr Diviciacos fort. „Welchen Bauchumfang, glaubt Ihr, sollte ein Mann haben?“
Eluskú legte die Stirn in Falten. „Was? Ich… nun, er sollte ein Ebenbild der Götter sein, denen er entstammt!“, rief er verärgert.
„So wie Ihr?“
„So wie ich oder jeder andere hier!“
Diviciacos nickte. „Dann wird Euch sicherlich klar sein, dass ich nicht seinen gesamten Bauchumfang messen kann, da Ihr ihm schwerlich vorwerfen wollt, überhaupt einen Bauch zu haben, nicht wahr? Entscheidend ist vielmehr der Unterschied zwischen seinem und einem Leib wie… nun ja, dem Euren, Eluskú.“
„Dem meinen?“
„Ihr begreift beinahe so schnell, wie Ihr reitet“, sagte Diviciacos. „Wer könnte besser mit seinem Körper als Bild der Götter dienen als ein Reiter des Eporedorix?“ Er ließ seine Worte ihre Wirkung im Geist des verblüfften Kriegers tun und wandte sich dem Bauern zu, der immer noch auf den Knien lag. „Nun zu Euch – Licnos, Sohn des Vectitos, nicht wahr? Steht auf.“
Der Mann kam unsicher auf die Beine und starrte ihn aus seinem feisten, blassen Gesicht heraus an, die Augen weit geöffnet und die Lippen fest aufeinander gepresst.
„Wie kam es, dass Ihr eine solche Leibesfülle annahmt? Warum esst Ihr nicht weniger und übt Euren Körper? Wisst Ihr nicht, dass der Geist leidet, wenn der Leib schwach ist?“
„Ich… weiß es, o Diviciacos“, stammelte Licnos. „Doch die Götter entschieden, mir einen Gaumen zu geben, der Käse liebt, und einen Körper, durch den der Käse gleich zu den Hüften wandert.“
Die Umstehenden kicherten, und auch Diviciacos unterdrückte ein Schmunzeln. Er bemerkte, dass sich Unruhe unter Biracos‘ Gefolge verbreitete; einige murrten leise. Eluskús Gesicht nahm eine leicht rötliche Färbung an. „Was erlaubt sich diese Kreatur?“, rief er laut. „Ist es …“
„Schweigt!“ Diviciacos stieß den Stab auf den Boden, um für Ruhe zu sorgen. „Wie ich schon sagte, es ist nicht gut, zwei Geschichten gleichzeitig zu hören.“ Er wartete einen Moment, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. „Euer Vorschlag, Eluskú, scheint mir jedoch gerecht: Wir messen Licnos‘ Bauch, und den Euren, Sohn des Biracos. Den Unterschied werden wir als Maß für die Strafe heranziehen, den Licnos zu leisten hat. Ist eine der Sippen mit diesem Vorgehen nicht zufrieden, steht es ihr frei, den Rat der Sippen anzurufen und ein Urteil des Vergobret zu fordern.“ Die Männer schwiegen und Diviciacos nickte befriedigt. „Entblößt Euch.“
Der junge Krieger zögerte kurz und warf seinem Vater einen schnellen Blick zu. Dann streckte er die Brust heraus und winkte lässig einen Waffenträger heran, der ihm half, den gehärteten Lederpanzer und den Schwertgurt abzunehmen. Er zeigt seinen Körper gern, dachte Diviciacos grimmig. Es schien ihm, als lege Eluskú mit seiner Kleidung auch die Unsicherheit ab, die ihn kurz befallen hatte. Nachdem seine Schultern entblößt waren, zog er mit einer ruckartigen Bewegung die hochgeschnürte Hose auf die Hüften herunter und sah mit hochgerecktem Kinn in die Menge. Diviciacos stellte befriedigt fest, dass er einen beeindruckenden Brustkorb und beachtliche Muskeln hatte. Auch Licnos, der Bauer, hatte sein Wams abgelegt und nestelte an seinem Hosenbund; sein bleicher, aufgequollener Wanst bereitete ihm sichtlich Unbehagen.
Diviciacos wandte sich einem der Hüter zu. „Es soll Eure Aufgabe sein, den Umfang der Leiber dieser beiden zu messen, Alisanos“, sagte er ruhig. „Messt sorgfältig und genau, das Band gerade über dem Nabel.“
Der Angesprochene, ein erfahrener Druide von mehr als vierzig Wintern, trat zunächst zu dem Hirten und legte dem vor Angst schlotternden Mann ein Lederband um den Wanst. Er machte einen Knoten hinein, um den Umfang zu markieren, und wiederholte die Prozedur bei Eluskú, der mit vor der Brust verschränkten Armen wartete. Diviciacos beobachtete Biracos und seine Sippe; erst jetzt schien ihnen aufzugehen, dass der Druide sie getäuscht hatte: da Eluskú den dicklichen Hirten beinahe um Haupteslänge überragte und von kräftiger Statur war, lagen die beiden Knoten erstaunlich nah beieinander, als der Hüter das Band in die Höhe hielt. Ein Schrei der Empörung ertönte und auch Eluskú gab einen erstaunten Laut von sich. Die Menge tuschelte gespannt.
Diviciacos stieß den Stab auf den Fels bis die Rufe verstummten. „Bleibt noch, den Abstand zwischen den beiden Knoten zu messen“, fuhr er unbeirrt fort. „Wie Ihr, Eluskú, vorhin selbst sagtet, ist Eurer Sippe weder Schaden entstanden noch wurde Eure Ehre verletzt, wohl aber, darin habt Ihr Recht, das Gesetz des Stammes. Die Verse schreiben für einen solchen Fall vor, die Strafe mit gewöhnlichen Bohnen zu bemessen. Sie soll in kleinem Kupfer beglichen und am Brunnen der Kraniche dem Esos dargebracht werden.“ Er tat weitere vier Schläge mit dem Stab, um sein Urteil zu bekräftigen, und stieg langsam von dem Felsen hinunter. „Alisanos, Ihr werdet den Abstand gewissenhaft abmessen, Bohne für Bohne. Ihr, Licnos, Sohn des Vectitos, nehmt das Lederband mit Euch. Zur Trinoux Samonis werden wir Euch erneut vermessen und sehen, ob sich Eure Statur gebessert hat. Und wagt nicht, die Knoten zu versetzen – ich würde es merken, und wenn nicht ich, so die Unsterblichen.“ Abrupt wandte er sich Biracos zu. Die Kiefer des Züchters mahlten vor Wut und sein Schnurrbart zitterte, doch er wagte nicht, dem Urteil des großen Druiden zu widersprechen. Diviciacos senkte die Stimme, sodass nur die Umstehenden ihn verstehen konnten. „Noch etwas, Biracos“, raunte er. „Wenn Ihr noch einmal mit einer solchen Lächerlichkeit meine Zeit verschwendet, werde ich für jeden Zwölft einer Stunde ein Kalb von Euch fordern.“
Er entschied an diesem Nachmittag noch in vielen weiteren Fällen, und Belenos‘ Auge stand tief, als die Menge sich zu zerstreuen begann. Erschöpft wandte sich Diviciacos dem Nemeton zu, um den Göttern im kühlen Dunkel des Hains seinen Dank auszusprechen. Er verabschiedete sich von den Hütern und machte sich auf den Heimweg, vorbei an den von länglichen Mauern eingepferchten Häuschen, in denen die Pferde und Dienerschaft der Edlen untergebracht wurden. Die Arbeit in den Werkstätten der Hammerschmiede, Gießer und Metallarbeiter zu seiner Linken war bereits zum Erliegen gekommen.
Bibracte machte einen friedlichen Eindruck in der abendlichen Sonne, doch Diviciacos fühlte sich, als trage er einen Felsblock von der Größe des Steins der Worte um den Hals und reite gegen einen mächtigen Sturm. Er vermied den Blick auf den vor ihm liegenden steinigen Hügel, den die Haeduer schlicht duron, nannten, Festung, und der auch jetzt noch, beinahe ein Jahr nach Ende des Krieges, mit den Zelten der Flüchtlinge aus den umliegenden Siedlungen und Gehöften übersät war, den kümmerlichen Behausungen jener, deren Atem schon seit vielen Nächten nicht mehr nach Cervisia gerochen hatte. Rasch wusch er Hände und Gesicht an der Quelle der Tränen und lenkte Prito auf direktem Wege zum inneren Tor, doch erst als er auch den äußeren Wall passiert hatte, begann die Anspannung des Gerichts von ihm abzufallen. Er konzentrierte seine Sinne auf die Natur um ihn herum, ließ den Gedanken an all das Elend und die Not der Menschen freien Lauf, bis sie sich langsam zerstreuten, sein Geist sich leerte und mit neuen Bildern, Klängen und Gerüchen füllte, Eindrücken, die nichts bedeuteten, sondern schlicht waren.
Die Römer warteten neben dem Bach, an dem er sie verlassen hatte. Sie erhoben sich, als er sich näherte, und Trocillus trat ihm entgegen.
„Es ist gut, dass Ihr gekommen seid, o Diviciacos. Die Freundschaft zwischen Rom und den Haeduern ist beiderseits ein hohes Gut, das wir pflegen wollen wie unsere eigenen Kinder, nicht wahr?“
Droht er mir?, fragte sich Diviciacos, oder verspottet er mich nur? „So sprecht“, sagte er heiser. „Welche Kunde sendet der Senat den Haeduern, die zu geheim für die Ohren des Vergobret ist?“ Er wusste, dass er schon mit dieser Frage das Gesetz des Stammes verletzte, doch etwas im Verhalten der drei Gesandten veranlasste ihn, sie anzuhören. Nach kurzem Wortwechsel mit Flaccus ergriff Trocillus erneut das Wort.
„Genau gesagt, stammt unsere Botschaft nicht vom Senat. Sie stammt vom künftigen Statthalter der gallischen Provinzen. Ihr werdet von ihm gehört haben; sein Name ist Gaius Iulius Caesar.“
Sie sprachen eine Weile, und als Diviciacos einige Zeit später seinen Heimweg fortsetzte, war sein Herz von Angst und Hoffnung gleichermaßen erfüllt. Die kommenden Nächte und Winter würden für die Haeduer nicht einfacher werden als die vergangenen; doch vielleicht hatten die Götter sich noch nicht gänzlich von ihnen gewandt.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Floki
 Schneckenpost Schneckenpost
F
Beiträge: 11
Wohnort: München
|
F  08.11.2014 11:41 08.11.2014 11:41
von Floki
|
 |
|
Hi Zeitenträumer! 
Insgesamt finde ich deinen Stil eigentlich ganz angenehm zu lesen; trotzdem sind mir einige Dinge aufgefallen, die verhinderten, dass mich dieser Anfang in die Geschichte "reingezogen" hat.
| Zeitenträumer hat Folgendes geschrieben: |
Heute
Der Beobachter in der letzten Reihe ließ sich tiefer in den Sitz sinken. Seine Augen schweiften unter gesenkten Lidern durch den Saal, fixierten mal den Einen, mal den Anderen, und kehrten immer wieder zu der alten Frau am Rednerpult zurück. Er wusste, dass sich keiner der Anwesenden nach dem Vortrag an ihn erinnern würde. Es war seine Aufgabe, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und er hatte diese Fähigkeit über lange Jahre perfektioniert.
Hätte er die Frau dort vorne an der Kanzel beschreiben sollen(Warum sollte er das tun? Warum beschreibt er sie nicht einfach? Finde ich zu indirekt), wäre ihm wohl als erstes das Wort „hutzelig“(hätte ich die Kommentare nicht gelesen, hätte ich nicht den blassesten Schimmer, was das bedeuten soll) in den Sinn gekommen. Sie war, wie er aus seiner Recherche wusste, 76 Jahre alt, hätte jedoch nach ihrem Äußeren noch älter sein können(Warum auch hier nicht direkter, z.B.: "sah aber noch deutlich älter aus als das"). Natürlich war sie damit weitaus jünger als er selbst, auch wenn er sein genaues Alter nicht kannte; ihm aber sah man seine Jahre nicht an. Er hätte vermutlich die heitere Gelassenheit geschildert(Dann sollte er das hier doch einfach mal machen  ), mit der sie die immer noch in den Saal strömenden Menschen betrachtete, und den Schalk, der in ihren Augen blitzte; vielleicht hätte er sogar erwähnt, dass sie ihm überraschend sympathisch war. Überraschend, weil er sich Gefühle für andere Menschen schon vor langer Zeit abgewöhnt hatte. Sympathie spielte für seine Aufgaben keine Rolle, sondern war im Gegenteil hinderlich, und ganz sicher würde er die alte Physikerin niemals jemandem beschreiben. Wenn sie sich als geeignet erwies, würde er lediglich ihren Namen und Wohnort übermitteln: Adaliz Mirabeau, Paris. Nicht mehr. (Mir ist schon klar, dass du diesen Absatz so formuliert hast, um diese Information einstreuen zu können, aber ich finde dennoch, dass dieser Absatz viel zu indirekt und statisch klingt.) ), mit der sie die immer noch in den Saal strömenden Menschen betrachtete, und den Schalk, der in ihren Augen blitzte; vielleicht hätte er sogar erwähnt, dass sie ihm überraschend sympathisch war. Überraschend, weil er sich Gefühle für andere Menschen schon vor langer Zeit abgewöhnt hatte. Sympathie spielte für seine Aufgaben keine Rolle, sondern war im Gegenteil hinderlich, und ganz sicher würde er die alte Physikerin niemals jemandem beschreiben. Wenn sie sich als geeignet erwies, würde er lediglich ihren Namen und Wohnort übermitteln: Adaliz Mirabeau, Paris. Nicht mehr. (Mir ist schon klar, dass du diesen Absatz so formuliert hast, um diese Information einstreuen zu können, aber ich finde dennoch, dass dieser Absatz viel zu indirekt und statisch klingt.)
Denn er war das Auge des Hohen Rates, und das Auge sprach nicht, ebenso wenig wie die Stimme handelte oder die Hand beobachtete. Das Auge sieht. Die Stimme spricht. Die Hand straft. Der Geist führt. Das waren die Gesetze des Hohen Rates, und keinem der Ratsmitglieder wäre es eingefallen, sie zu verletzen. Er hatte niemals ein Mitglied des Rates zu Gesicht bekommen; er wusste nicht einmal, wie er von ihrer Existenz erfahren hatte. Er konnte nicht sagen, woher er die Gesetze des Rates kannte und wie der Geist ihm seine Anweisungen übermittelte, doch diese Anweisungen waren überaus klar, und sie zu befolgen das einzig Wichtige auf der Welt.
Es schien, als wolle Madame Mirabeau beginnen, denn das Gemurmel unter den Zuhörern erstarb. Die Vorträge der Physikerin waren für ihre Unterhaltsamkeit berühmt, wurden im Netz verbreitet wie sonst nur unrealistische Stunts und alberne Katzenvideos(gelungener Vergleich), und sie galt trotz ihres Alters als führende Kapazität auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Vor allem gab es angeblich niemanden auf dem Planeten, der so viel über das Wesen der Zeit wusste wie sie, und das war der Grund seiner Anwesenheit. Der Inhalt der Veranstaltung interessierte ihn höchstens am Rande.
‚Finden Sie jemanden, der wirklich etwas von der Zeit versteht’, lautete der Auftrag des Geistes. Das war es, was er konnte: Menschen finden. Die richtigen Menschen. Er lehnte sich zurück und wartete.
„Die Zeit“, begann Adaliz Mirabeau nach einer kurzen Begrüßung, „ist wohl eines der vertrautesten Dinge in unserem Leben. Wir wollen sie uns vertreiben, sie ausnutzen oder totschlagen. Wir sagen, die Zeit fliege oder fließe zäh, sie rinne uns durch die Hände, sie sei Geld. Wir ärgern uns, wenn wir sie vergeuden und freuen uns, wenn wir sie sparen. Und nicht zuletzt nagt die Zeit mit ihrem unerbittlichen Zahn an uns, wie man an meiner Wenigkeit sehen kann.“ Die alte Dame schmunzelte. „Dennoch gibt es aus wissenschaftlicher Perspektive kaum etwas, das wir so wenig begriffen haben, wie die Zeit. Ich möchte Ihnen am heutigen Abend eine Vorstellung davon geben, wie weit wir mit unseren Bemühungen gekommen sind und was uns zum Verständnis fehlt. Insbesondere geht es, wie Sie dem Titel dieser Veranstaltung entnommen haben werden, um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen.“ (gut! wirkt auf mich authentisch und ich kann durchaus abkaufen, dass der Rest des Vortrages spannender ist als Katzenvideos)
Der Vortrag war unter dem Titel ‚Zeitreisen und die damit verbundenen Paradoxa‘ angekündigt worden.
„Ich verspreche Ihnen“, fuhr Mirabeau fort, „dass ich Sie weder mit den zahllosen Versuchen der Philosophen, den Zeitbegriff zu erklären, noch mit den Formeln der Physiker langweilen werde. Monsieur Klein hier“, – sie wies auf den jungen Mann neben sich, der ihr Assistent zu sein schien – „könnte Ihnen all das, was ich Ihnen an Merkwürdigkeiten vorsetzen werde, auch mathematisch begründen und täte sicherlich nichts lieber als das, denn Monsieur Klein liebt Zahlen. Da ich aber annehme, dass die meisten von Ihnen diese Liebe nicht teilen, möchten wir Sie bitten, uns auch ohne diese Beweisführungen zu glauben.“
Im Publikum erhob sich verhaltenes Gelächter. Der Beobachter hatte diesen Monsieur Klein mit der Brille und der großen Nase bislang nicht wirklich beachtet, doch sein Gespür für Persönlichkeiten lieferte ihm eine schnelle Einschätzung: ein junger, erfolgreicher Wissenschaftler, der die Arroganz des brillanten Denkers aus allen Poren ausdünstete. ("ausdünstet" klingt auf mich hier nicht sehr passend, da es zusammen mit dem vorhergehenden "aus" ein wenig nach Wiederholung riecht - aber das ist Jammern auf hohem Niveau)
„Es soll heute auch nicht um technische Schwierigkeiten von Zeitreisen gehen“, fügte Mirabeau hinzu, „obwohl nicht absehbar ist, ob und wann wir diese überwinden können – einige Physiker gehen davon aus, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen und das Ziel in ein paar Jahren oder Jahrzehnten erreichen werden, während andere vermuten, dass die menschliche Zivilisation gar nicht lange genug existieren wird, um die erforderlichen Technologien zu entwickeln. Zu letzteren gehöre auch ich. Andererseits: Wenn Wissenschaftler behaupten, etwas sei unmöglich, liegen sie meistens falsch. Wie dem auch sei, heute Abend möchte ich keine Technik diskutieren, sondern einige grundsätzliche Überlegungen zu Zeitreisen und der Zeit im Allgemeinen mit Ihnen teilen.“
Mirabeau nickte dem Assistenten zu, und Klein startete eine Powerpoint-Präsentation.(Ich finde es etwas merkwürdig, dass ein "arroganter" und genialer Wissenschaftler hier als "Laufbursche" fungiert. Warum sollte er das tun? Irgendeine Art der Erklärung wäre hier vielleicht nicht verkehrt, z.B. dass er die Vortragende für so genial hält, dass er sich von ihr rumkommandieren lässt, obwohl das sonst nicht seine Art ist.) Auf der Leinwand über dem Podium erschien das Porträt eines Mannes mit wirrem, weißen Haar und heraushängender Zunge, ein Bild, das wohl beinahe jeder Mensch in der westlichen Welt schon einmal gesehen hatte.
„Albert Einstein hat unser Verständnis der Zeit verändert“, fuhr Mme(würde ich ausschreiben; man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass allen solche Abkürzungen geläufig sind. Selbst ansonsten gebildete Menschen könnten darüber etwas stolpern, wenn sie im Französischen nicht bewandert sind. Generell finde ich Abkürzungen in Romanen eher störend.) Mirabeau fort. „Er fand heraus, dass die Zeit nicht so absolut ist, wie sie uns erscheint. Wie schnell die Zeit vergeht, hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, von denen der bekannteste sicherlich die Geschwindigkeit ist, mit der wir uns bewegen. Kurz gesagt: je schneller wir sind, desto langsamer vergeht die Zeit. Zu Einsteins Zeiten war dieser Effekt bloße Theorie, doch mittlerweile wurde er viele Male experimentell bestätigt. Das ist ganz einfach: Wir schicken eine unserer genauesten Uhren mit einem unserer schnellsten Flugzeuge um die Welt, und hinterher geht sie im Vergleich zu einer zweiten, am Boden befindlichen Uhr einige Sekundenbruchteile nach. Die Zeit im Flugzeug ist also langsamer vergangen. Wenn Ihr Partner ruhig im Bett liegt und schläft, Sie selbst jedoch aufstehen, in die Küche gehen und sich einen Kaffee holen, sich also durch den Raum bewegen, wird Ihre Zeit ein wenig langsamer laufen als die ihres Partners.“
Der Beobachter bemerkte eine kurze Unruhe im Publikum; Köpfe wurden zusammengesteckt und einige kicherten. Paare, dachte er. Alberne Scherze gehörten wohl in fast jeder Beziehung zum Alltag. Er wusste nicht, ob er jemals eine Beziehung geführt hatte, bezweifelte es jedoch.
„Ähnlich verhält es sich mit der Gravitation“, fuhr Mirabeau fort. „In der Nähe eines sehr schweren Objektes, unter dem Einfluss starker Schwerkraft, vergeht die Zeit langsamer. Ein solches Objekt ist beispielsweise die Erde, und ob Sie es glauben oder nicht: Wenn Sie nicht mindestens die Hälfte Ihres Lebens im Kopfstand verbracht haben, ist Ihr Kopf älter als Ihre Füße, wenn auch nur um eine kaum messbare Zeit.“ Die alte Dame sah prüfend ins Publikum. „Sind Sie noch da?(Es wirkt etwas abrupt, dass sie das so kurz einstreut (für die Zuhörer scheinbar sinnlos) und dann sofort weiterredet.) Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, und deshalb können wir es nicht. Dennoch führen sie uns direkt zum ersten der beiden Typen von Zeitreisen, die es theoretisch gibt: zur Reise in die Zukunft.“
Der Beobachter schweifte mit seinen Gedanken ab. Er hatte von dieser Art der Zeitreise gehört: wenn man eine Weile in einem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit umher flog und dann zur Erde zurückkehrte, waren dort viele Jahre vergangen, während man selbst nur wenige Stunden unterwegs gewesen war – man war in die Zukunft gereist. Solche Dinge hatten ihn nie sonderlich interessiert, und er wusste, dass auch dem Geist des Hohen Rates nicht daran gelegen war. Der Geist interessierte sich für Reisen in die Vergangenheit.
Über die wahren Beweggründe des Ratsvorsitzenden wusste der Beobachter wenig. Früher einmal hatte er Vermutungen darüber angestellt, welche Ziele der Hohe Rat verfolgte, doch wie so viele Dinge hatte er sich auch das Spekulieren im Laufe der Jahre abgewöhnt. Er erinnerte sich nur dunkel an den jungen Mann, der vor langer Zeit in den Dienst des Rates getreten war. Manchmal, in philosophischen Momenten, fiel ihm der Name des jungen Mannes ein, ein Name, der nicht mehr der seine war, ebenso wenig wie er noch ein Alter oder eine Nationalität besaß. Die Physikerin sprach für eine Französin recht gut englisch, doch für ihn spielte es keine Rolle; sie hätte ebenso gut deutsch, russisch oder Suaheli sprechen können. Das Auge war auch das Ohr des Rates(Das hat mich etwas stutzig gemacht - zuerst sagst du, er sei ausschließlich das Auge, nun ist er aber plötzlich doch auch was anderes. Als Leser mindert das mein Vertrauen in den Erzähler. Aber vielleicht ist das ja gewollt?), und es gab kaum eine Sprache, die ihm nicht geläufig war. Hätte sein Körper nicht mit einem untrüglichen Beweis aufgewartet, er hätte wohl sogar sein Geschlecht vergessen. Er wusste nicht einmal mehr genau, wann sich sein Geist dieser äußeren Merkmale entledigt hatte, doch es musste ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als er die Schriften des Wissens gefunden hatte und das Auge des Hohen Rates geworden war.
Madame Mirabeau setzte ihre Ausführungen fort. Auf der Leinwand war ein transparenter Würfel erschienen, anhand dessen sie offenbar die Beschaffenheit der Raumzeit erklärte.
„Was gleichzeitig geschieht ist jedoch keineswegs so eindeutig, wie es scheint“, sagte sie gerade. „Nehmen wir an, das sind wir.“ Der Assistent hob die Fernbedienung(was für eine Fernbedienung?) und ließ ein grünes Männchen in einer Ecke des Würfels erscheinen. „Wir sitzen in unserem ruhigen, sicheren Seitenarm der Milchstraße und zweifeln nicht an unserem Jetzt. Zum anderen haben wir unseren außerirdischen Freund ET, der drei Millionen Lichtjahre entfernt auf seinem Heimatplaneten wohnt.“ Eine rote Figur mit dünnem Hals und riesigen Augen erschien auf der anderen Seite des Würfels. „Befinden wir uns beide in Ruhe, können wir uns auf ein gemeinsames Jetzt einigen. Aufgrund der riesigen Entfernung zwischen uns können jedoch schon geringfügige Bewegungen großen Einfluss darauf ausüben, was wir als gleichzeitig wahrnehmen. Wenn ET sich beispielsweise auf uns zu bewegt, könnten Ereignisse, die für uns noch weit in der Zukunft liegen, für ihn bereits geschehen sein. Er könnte, wenn wir die Schwierigkeiten bei der Nachrichtenübermittlung beiseite lassen, im Fernsehen auf seinem Planeten live beobachten, wie Ihre Enkeltochter hier auf der Erde einen Nobelpreis gewinnt. Nun haben wir ein großes Problem, denn wer von uns hat recht mit seinem Jetzt-Begriff?“ Mirabeau stemmte die Hände in die Hüften und setzte eine strenge Miene auf; dann lächelte sie wieder. „Keine Angst. Wir alle wissen, dass die Zeit nur in eine Richtung verläuft. Niemals setzt sich ein zerbrochener Teller spontan wieder zusammen, nie erheben sich die gelben und roten Blätter eines Baumes vom Boden, um sich an ihre Äste zu heften und zu ergrünen. Und wie gesagt, jünger wird leider auch keiner von uns. Wir Physiker sprechen vom Zeitpfeil. Erst wurde Ihr Großvater geboren, dann Ihr Vater und schließlich Sie selbst.“ Sie breitete die Arme aus. „Et voilá – schon sind wir beim bekanntesten Zeitreise-Paradoxon der Welt.“
Der Beobachter versprach sich keinen Gewinn davon, weiter zuzuhören. Stattdessen öffnete er all seine Sinne, um die Persönlichkeit der alten Dame zu ergründen, sie zu sehen, zu hören und zu spüren, während ihre Worte bedeutungslos an ihm vorüberzogen; die Zuhörer folgten in gespannter Stille, die nur von gelegentlichem Lachen unterbrochen wurde.
Neben den gewöhnlichen Sinnen nutzte er auch seine besonderen Fähigkeiten – Fähigkeiten, die in der Welt schon lange vergessen waren und die nur noch die Mitglieder des Hohen Rates beherrschten. Natürlich gab es Menschen mit außergewöhnlichen Begabungen; kaum jemand wusste das besser als er, denn zumeist bestand seine Aufgabe darin, solche Personen zu finden. Doch bevor diese Leute in die Dienste des Rates traten, konnte man nicht davon sprechen, dass sie ihre Talente beherrschten. Nur mit den Schriften des Wissens konnten sie sie vollständig entwickeln, und diese Schriften beruhten auf den Lehren der Druiden von einst. Gelegentlich malte er sich aus, einen der alten Zauberer zu treffen, und fragte sich, ob das der Grund der Besessenheit des Ratsvorsitzenden für Zeitreisen war, doch stets verblassten diese Fragen rasch und verschwanden im Strudel der bedeutungslosen Realität.
Er grub tiefer im Wesen der alten Frau, während sie dem Publikum unlösbare Zeiträtsel erklärte. „Sie wissen vielleicht, dass wir Physiker auf der Suche nach einer Theorie sind, einer einzigen Formel, die alle physikalischen Gesetze umfasst und beschreibt“, sagte sie. „Zeitungen schreiben oft vom Heiligen Gral der Physik, aber wir nennen sie schlicht die Große Vereinheitlichte Theorie. Nehmen wir an, Monsieur Klein hier reist fünf Jahre in die Zukunft und findet heraus, dass die Formel veröffentlicht wurde, und zwar von mir. Er liest die Theorie und ist überwältigt: Der Menschheit stehen nun große Entwicklungen bevor. Frohgemut kehrt er zurück und wartet, muss aber zwei Jahre später feststellen, dass ich an allem Möglichen arbeite, nur nicht an der Theorie. Etwas beunruhigt sagt er sich, dass ich ja noch drei Jahre Zeit habe, doch als er sich nach weiteren zwei erkundigt, habe ich immer noch nicht eine Zeile zu Papier gebracht und werde zudem langsam senil. Jetzt macht er sich ernsthaft Sorgen, und als es ein halbes Jahr später immer noch nicht besser aussieht, beschließt er, einzugreifen. Da er die Theorie gelesen hat, ist es ihm ein Leichtes, mich bei unserem nächsten Treffen auf die wichtigsten Zusammenhänge hinzuweisen, und ein halbes Jahr später erscheint das große Werk – doch wer ist der Urheber? Ich, die ich ohne Monsieur Klein vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre, an der Sache zu arbeiten? Oder er, der ohne die Lektüre meiner Theorie vielleicht nie im Leben auch nur das erste Axiom gefunden hätte? Oder ist gar Wissen aus dem Nichts entstanden?“
Adaliz Mirabeau schien keinerlei Hintergedanken zu hegen, sondern sprach mit einer fröhlichen Begeisterung für die Sache, ohne Eitelkeit oder andere egoistische Motive. Die jugendliche Heiterkeit und die Neugier, die aus ihren Augen sprachen, verbanden sich mit einer gewissen Milde, einer Altersweisheit und Gelassenheit, die der verhärtete Geist des Beobachters nur schwer ertrug. Gerade beendete sie ihre Ausführungen mit dem charakteristischen „Sind Sie noch da?“, doch in ihren Worten schwang nicht die Spur von Herablassung oder Spott. Ihr Lächeln verkündete, dass sie jedem einzelnen der Zuhörer auch das kleinste Detail geduldig erklären würde, bis er es verstand. Diese Frau, da war er sicher, war durch und durch gut.
Sie war vollkommen ungeeignet für die Zwecke des Hohen Rates.
Er war bereits im Begriff aufzustehen, als sein Blick erneut auf den Assistenten fiel. Monsieur Klein stand ungelenk neben dem Rednerpult, die Hüfte leicht eingeknickt, und fingerte an der Fernbedienung in seiner Hand herum. Mit einer fahrigen Bewegung rückte er seine Brille zurecht, und es war offensichtlich, wie sehr er die Zuhörer im Saal verachtete, für wie ausgesprochen begriffsstutzig er sie hielt. Der Beobachter lehnte sich wieder zurück und richtete seine Aufmerksamkeit auf den jungen Mann.
Selten hatte er in einem solch scharfen Verstand geforscht. Eine Fülle von äußerst präzisen Gedanken prasselte auf ihn ein, von deren Inhalt er kaum etwas verstand; offenbar löste Klein nebenbei komplexe mathematische Gleichungen. Mit einem leisen Kopfschütteln konzentrierte der Beobachter sich auf das Wesen und die Gefühle des Assistenten. Klein war von enormem Ehrgeiz getrieben, und die Verachtung, die er dem Publikum entgegenbrachte, galt in geringerem Maß auch für Madame Mirabeau, die nicht einmal in der Lage war, einen Beamer zu steuern. Kaum einmal hatte der Beobachter jemanden gesehen, dessen Geist sich in einem derartigen Ungleichgewicht befand, gewissermaßen das genaue Gegenteil zu der alten, in sich ruhenden Physikerin. Klein musste ein sehr unzufriedener Mensch sein, auch wenn dies nur eine oberflächliche Analyse war.
Möglicherweise bist du es, den ich gesucht habe. Ehrgeiz war ein wunderbarer Hebel, um jemanden zu manipulieren. Für die Stimme des Hohen Rates würde es eine Kleinigkeit darstellen, diesen Mann dazu zu bringen, genau das zu tun was der Geist wollte.
Er lehnte sich wieder zurück, um das Ende des Vortrags abzuwarten. Madame Mirabeau war offenbar bei den entscheidenden Schlussfolgerungen angelangt, doch da er ihren Ausführungen nicht gefolgt war, verstand er nicht alles, was sie sagte.
„Wir haben also gesehen, dass die gesamte Raumzeit, der gesamte Würfel, existiert“, verkündete sie gerade. „Der Fluss der Zeit, der uns so vertraut ist, scheint hingegen ein unzutreffendes Bild zu sein, das nur im menschlichen Geist eine Zuflucht hat und einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhält. Es sei denn, Sie messen ihrem eigenen Standpunkt eine größere Bedeutung zu als dem eines beliebigen anderen Individuums irgendwo im Universum, wie zum Beispiel ET. Verschiedene Beobachter können höchst unterschiedlicher Ansicht darüber sein, welche Ereignisse gleichzeitig geschehen. Mein Jetzt könnte sich von Ihrem Jetzt fundamental unterscheiden, und ein Beobachter in zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung wird mit großer Sicherheit einen vollkommen anderen Jetzt-Begriff haben, der für ihn jedoch genauso real ist, wie unserer für uns. Ich weiß, es ist kaum vorstellbar, denn unsere Wahrnehmung erzählt uns Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, eine andere Geschichte, aber alle Erkenntnisse der modernen Physik weisen darauf hin, dass es sich so verhält. Wenn wir Einstein glauben, ist jeder Punkt der Raumzeit, liege er für uns nun in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft, vollkommen gleichberechtigt mit jedem anderen Punkt.“ Sie machte eine Pause und sah fast mitleidig ins Publikum. „Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich möchte ihnen zum Schluss noch kurz deutlich machen, was diese Erkenntnisse für unser Problem der Zeitreise in die Vergangenheit bedeuten. Können Sie nun, vorausgesetzt, Sie haben eine Zeitmaschine, Ihren Vater erschießen oder nicht?“
Amüsiert registrierte der Beobachter einen leisen Anflug von Interesse irgendwo weit hinten in seinem Gehirn – wie lange war es her, dass ihn etwas wirklich interessiert hatte? –, aber er wusste, dass es zu spät für ihn war, sich zu begeistern. Zu lange hatte er sich allen weltlichen Inhalten verschlossen; zu lange war er das Auge des Hohen Rats gewesen. Kurz meinte er sogar etwas zu spüren, das früher einmal Neid gewesen wäre, Neid auf diese alte Dame, die trotz ihrer Jahre so viel Freude am Leben empfand, doch es schien gleichsam das Gefühl eines anderen Menschen zu sein, das Gefühl des jungen Mannes mit dem Namen und der Nationalität, dem Alter und dem Geschlecht. Er unterdrückte ein Gähnen.
„Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen“, sagte Madame Mirabeau. „Momentan scheint es höchst unwahrscheinlich, dass es jemals möglich sein wird, in die Vergangenheit zu reisen. Ich selbst gehöre zu denen, die vermuten, dass es sich nicht nur technisch, sondern auch prinzipiell als unmöglich erweisen wird. Es ist allerdings bemerkenswert, dass wir kein physikalisches Gesetz entdecken, das dagegen spricht. Wir können die Unmöglichkeit von Vergangenheitsreisen trotz aller Bemühungen nicht beweisen.“ Sie lächelte ihr sanftes Lächeln. „Wenn es aber doch möglich sein sollte, so vermeidet die allgegenwärtige Existenz der gesamten Raumzeit jegliches Paradoxon. Wenn die gesamte Raumzeit existiert, wenn jedes Ereignis unveränderlich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattfindet, dann ist es nicht möglich, ein solches Ereignis zu beeinflussen. Die Tatsache, dass Sie existieren, schließt aus, dass Ihr Vater vor Ihrer Zeugung erschossen wird; denn Kausalität ist ein unumstößliches Prinzip. Man kann sich unzählige Möglichkeiten ausdenken, was geschähe: Sie schießen daneben, der Abzug der Waffe klemmt, jemand läuft dazwischen oder Sie entscheiden sich im letzten Moment um und lassen den armen Mann leben. Jeder Augenblick in der Raumzeit existiert. Für immer. Es ist schwer, diese Beschreibung des Universums zu akzeptieren, denn unsere alltägliche Erfahrung trennt so eindeutig und entschlossen zwischen dem, was war, was ist und was sein wird. Doch wie Einstein es einmal sagte: Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion – wenn auch eine hartnäckige.“ Immer noch lächelnd deutete Adaliz Mirabeau eine Verbeugung an. „Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Möge Ihr Leben noch viele wunderbare Jetzt-Erlebnisse für Sie bereithalten.“
Für einen Moment saßen die Zuhörer wie betäubt da; dann brandete tosender Applaus auf, der minutenlang anhielt und der alten Frau etwas peinlich zu sein schien. Während die Menschen langsam aus dem Saal strömten und Monsieur Klein sich daran machte, den Laptop herunterzufahren, betrachtete der Beobachter den schlaksigen jungen Mann. Es war, so vermutete er, nicht das letzte Mal, dass er diesen Streber zu Gesicht bekommen würde. Schon bald würde er für den Hohen Rat arbeiten – die Stimme konnte außerordentlich überzeugend sein. Und sollte sie wider Erwarten scheitern, käme die Hand des Rates ins Spiel; und dann würde es für den klugen Monsieur Klein sehr, sehr unangenehm werden(Gut! Macht neugierig auf mehr). |
Alles in allem muss ich sagen, dass ich ein wenig zweifle, ob dieses Kapitel eine gute Wahl für den Anfang der Geschichte ist. Du bringst hier enorm viel Beschreibungen, innere Monologe und ähnliches, und die eigentliche Handlung könnte man in einem kurzen Absatz zusammenfassen. Diese Szene ist extrem bewegungsarm, alle stehen oder sitzen nur rum, und für jemanden, dem die physikalischen Trivia schon bekannt sind, ist auch die Rede der Physikerin eher uninteressant. Ich verstehe schon, dass es für Leser, die sich mit der Materie nicht auskennen sinnvoll ist, sie in die Thematik ein wenig einzuführen, aber ich finde, das sollte nicht ganz am Anfang geschehen, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Durch einige wenige Stellen wird angedeutet, dass es später viel mehr Action geben könnte - und von daher unterstelle ich jetzt mal, dass du genau solche Leser ansprechen willst, die auch ein gewisses Level an Action in ihren Romanen erwarten. Gerade solche Leser schreckst du aber, so fürchte ich, eher ab, wenn du eine so handlungsarme Szene an den Anfang des Romans stellst.
Trotzdem muss ich sagen, dass dein Schreibstil sehr gekonnt wirkt und ich würde auch gerne wissen, wie es weitergeht. Ich sehe auf jeden Fall das Potential der Geschichte! 
|
|
| Nach oben |
|
 |
Zeitenträumer
 Leseratte Leseratte
Z
Alter: 44
Beiträge: 123
|
Z  09.11.2014 16:01 09.11.2014 16:01
von Zeitenträumer
|
  |
|
Hallo Floki,
erstmal besten Dank für deine positive wie negative Kritik und dafür, dass du durchgehalten hast, obwohl es dich nicht reingezogen hat.
Was den Actionmangel betrifft, hast du recht - hier gibt es recht wenig, und im Laufe der Geschichte wird es mehr. Es geht mir, da in meiner Geschichte Zeit das große Thema ist, hier vor allem darum, eine gewisse Grundstimmung der Zeit gegenüber zu erzeugen, das Bewusstsein dafür zu wecken. Gleichzeitig möchte ich ein wenig Spannung erzeugen, indem ich die Dinge über den Hohen Rat andeute. Daher auch der erste Absatz; vielleicht finde ich noch einen Weg, ihn "direkter" zu gestalten. Da bin ich natürlich auch dankbar für Anregungen.
Zu deiner Kritik im Einzelnen:
| Zitat: | | ein junger, erfolgreicher Wissenschaftler, der die Arroganz des brillanten Denkers aus allen Poren ausdünstete. |
Gekauft. Ich werde mir was besseres einfallen lassen.
| Zitat: | | Klein startete eine Powerpoint-Präsentation.(Ich finde es etwas merkwürdig, dass ein "arroganter" und genialer Wissenschaftler hier als "Laufbursche" fungiert. Warum sollte er das tun? Irgendeine Art der Erklärung wäre hier vielleicht nicht verkehrt, z.B. dass er die Vortragende für so genial hält, dass er sich von ihr rumkommandieren lässt, obwohl das sonst nicht seine Art ist.) |
Hm, also zum Einen ist sie die Koryphäe, aber vor allem läuft es an Universitäten meist so. Sie könnte allerdings auch einen HiWi für diese Aufgabe nehmen, da hast du schon recht.
Die Abkürzung (Mme) ist Mist und auch inkonsequent gehandhabt, werde ich ändern.
| Zitat: | | Die alte Dame sah prüfend ins Publikum. „Sind Sie noch da?(Es wirkt etwas abrupt, dass sie das so kurz einstreut (für die Zuhörer scheinbar sinnlos) und dann sofort weiterredet.) |
Ich verstehe was du meinst. WÜrde es die Sache verbessern, wenn ich danach noch einen Satz einschöbe? Z. B.:
Die alte Dame sah prüfend ins Publikum. „Sind Sie noch da?", fragte sie und legte den Kopf schief; dann nichte sie befriedigt. "Es war niemals ein evolutionärer Vorteil, solche relativistischen Phänomene wahrnehmen zu können, ... "
| Zitat: | | Das Auge war auch das Ohr des Rates(Das hat mich etwas stutzig gemacht - zuerst sagst du, er sei ausschließlich das Auge, nun ist er aber plötzlich doch auch was anderes. Als Leser mindert das mein Vertrauen in den Erzähler. Aber vielleicht ist das ja gewollt?) |
War eigentlich so gedacht, dass er eben das "Wahrnehmungsorgan" des Rates ist. Kommt vielleicht nicht rüber.
Nochmals vielen Dank - ich werde weiter daran arbeiten, auch ohne (äußere) Action genug Spannung zu erzeugen, um Leute zum Weiterlesen zu animieren.
Beste Grüße,
David
|
|
| Nach oben |
|
 |
Floki
 Schneckenpost Schneckenpost
F
Beiträge: 11
Wohnort: München
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 1 von 5 |
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
| Empfehlung | Empfehlung | Buch | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






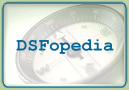
 Login
Login



 )
)