  |
|
| Autor |
Nachricht |
Pompidou
 Erklärbär Erklärbär
P
Alter: 61
Beiträge: 3
Wohnort: 89231 Neu-Ulm
|
P  12.04.2020 13:01 12.04.2020 13:01
DEAD END - das Ende des Fortschritts / Ein dystopischer Abenteuerroman
von Pompidou
|
   |
|
DEAD END
Das Ende des Fortschritts
Apokalyptischer Abenteuerroman
von Marc U. Wilde
((Bild: Hand hält waagerechtes Starkstromkabel mit freiliegenden Kupferadern links und rechts. Links blank und elektrisch leitfähig, rechts grün oxydiert und ohne Funktion))
((Klappentext Schutzumschlag vorne))
Die Zukunft gehört den Wenigen.
Denn die Meisten haben keine.
Der erfolgreiche Kreativdirektor Tom Kaysan kündigt seinen Job mit 28 Jahren – in der Werbebranche hat er alles erreicht, was man dort erreichen kann. Jetzt will er etwas vollkommen Neues beginnen. Was genau, steht noch in den Sternen.
Um auf neue Gedanken zu kommen, macht Tom Urlaub bei Freunden auf der Nordseeinsel Langeoog. Von dort aus hebt er die Welt so gründlich aus den Angeln, wie es vor ihm noch kein Mensch vermocht hat.
((Klappentext Schutzumschlag hinten))
Wolfenbüttel im Jahr 2271
Nach dem Untergang der Zivilisation zu Beginn des Jahrtausends ist die Erde nur noch dünn mit Menschen besiedelt.
Das in Tausenden von Jahren angesammelte Wissen aus der Zeit vor dem Untergang der Industriegesellschaft ist verloren. Wissenschaft und Fortschritt existieren nicht mehr.
Mit einer Ausnahmen: In den Laboratorien der Vereinigten Grafschaften von Germanien bestehen im Jahr 2271 noch Reste davon. Und im Hauptquartier der Reichsführung ist man über weite Teile der menschlichen Geschichte im Bilde. Sie wird dort allerdings auf ganz eigene Weise interpretiert.
Die Generaldirektorin der Vereinigten Grafschaften kämpft in diesen Zeiten mit einem großen Problem: Die religiöse Ideologie, mit der sie ihre Untertanen im Zaum hält, beginnt zu zerfallen.
Dem Chrislam, der Staatsreligion, stehen immer mehr abtrünnige Sekten und Häretiker gegenüber. Die Anhängerschaft Gottallahs und seines Propheten Jesumed schwindet ebenso wie der Respekt vor dem Bibloran, der heiligen Schrift.
Die Generaldirektorin Jeanette von Kaysan publiziert die vorliegende Erzählung im Jahre 2271, um ihre Untertanen wieder in den Griff zu bekommen. Mit einem neuen, alle Lebensbereiche durchdringenden Mythos.
Prolog
Zu Beginn des 2. Jahrtausends n. Chr. leben knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als 95 % davon leben durch eine Infrastruktur, die weltweit miteinander vernetzt ist. Diese komplexe Infrastruktur sorgt für die entscheidenden Lebensbedingungen – mit politischen, wirtschaftlichen, sozialen und technischen Leistungen.
Ein unentbehrlicher Energielieferant für die globale Infrastruktur ist elektrischer Strom. Elektrizität fließt von Kraftwerken durch Kupferleitungen zu Fabriken, Anlagen und Geräten der Industriellen Welt und treibt diese zum Wohle der Menschheit an.
Dass ca. 8 Milliarden Menschen auf der Erde ohne elektrischen Strom überleben, ist nicht wahrscheinlich. Es ist so wahrscheinlich wie das Überleben eines schwer kranken Intensivpatienten ohne Intensivstation.
((Romanbeginn))
13. August im Jahre 2171. Aushang für alle Reichsfunktionäre in Schloss Wolfenbüttel, Hauptquartier der Vereinigten Grafschaften von Germanien:
Neu: Original-Manuskripte von Tom Kaysan veröffentlicht
Streng vertraulich – nur für den Dienstgebrauch!
Vor einiger Zeit ist es hier bei uns in den Grafschaften gelungen, Maschinen zu bauen, die Schrift auf Papier drucken. Mittlerweile ist der technische und wirtschaftliche Aufwand dafür auf ein vertretbares Maß gesunken.
So können wir mit Druckschriften die Kommunikation und Verwaltung innerhalb der Reichsführung jetzt ebenso deutlich verbessern wie die Agitation und Propaganda für unsere Untertanen.
Damit sieht sich die Familie von Kaysan endlich in der Lage, die Manuskripte unseres Ahnen Tom Kaysan zu veröffentlichen und unter dem Titel
„DIE ABENTEUER DES TOM KAYSAN IN VERGANGENENEN ZEITEN“
einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Um unsere Untertanen mit guter Unterhaltung zu erfreuen und die Überlieferungen um unseren Reichsgründer zu aktualisieren, zu vertiefen und so unsere Herrschaft weiter zu festigen.
Die Reichsführung gibt zwei verschiedene Versionen heraus: eine unzensierte Fassung mit den Anmerkungen von Jeanette von Kaysan VI. für die Reichsleitung. Und eine leicht verständliche Version für unser Volk.
Jeanette v. Kaysan VI. fasste die Schriften Tom Kaysans zusammen und versah sie zum besseren Verständnis der Reichsleitung mit zeitgemäßen und erhellenden Anmerkungen. Diese sind im fortlaufenden Text mit <Texteinschub> gekennzeichnet. Diese Texteinschübe sind in der Volksausgabe aus nahe liegenden Gründen nicht enthalten.
Mit der vorliegenden Publikation können die Ereignisse während der Kupferoxydation und des Zusammenbruchs der Industriellen Welt dem Volk der Vereinigten Grafschaften jetzt endlich aus erster Hand zugänglich gemacht werden.
Damit treten wir auch den dubiosen Erzählungen und lächerlichen Märchen über den Ursprung unseres Reiches entschieden entgegen, genauso wie der um sich greifenden Ketzerei.
Die Startauflage der Volksversion umfasst 169 Schriftrollen für die Kerngrafschaften, die von Vorlesern in den neu geschaffenen Lesehäusern nach Sonnenuntergang vorgetragen werden. Die Ortsgruppenführer sind aufgerufen, für einen zahlreichen Besuch der Vorlesungen Sorge zu tragen!
Jeanette v. Kaysan VI.
Wolfenbüttel, den 4. Juni des Jahres 2171
Jeanette von Kaysan VI., Senatorin für Bildung, Familie und Soziales.
Generaldirektorin der Vereinigten Grafschaften von Germanien.
DIE ABENTEUER DES TOM KAYSAN IN VERGANGENEN ZEITEN
Sonderausgabe für Angehörige der Reichsleitung. Streng vertraulich!
Kapitel 1
Vom Himmel hoch
13. August, 00:12. Tom Kaysan fühlte sich jung, stark und frei. Er jubelte innerlich. Er spürte, wie frische Energie seinen Körper und Geist durchströmte. Sie summte wie Starkstrom in seinen Nervenbahnen. Tom hatte seinen Job an den Nagel gehängt und fühlte sich wie neu geboren.
Er wanderte in der sternklaren Nacht am abgelegenen Ostende der Nordseeinsel Langeoog bei Ebbe übers menschenleere Watt. Es war kurz nach Mitternacht und wegen des Neumondes so dunkel, dass er in der Finsternis auf etwas Kaltes, Glitschiges trat, (Seetang, eine Qualle, ein toter Fisch?), ausrutschte, das Gleichgewicht verlor und um ein Haar im Priel neben ihm gelandet wäre. Glücklicherweise fing er sich mit rudernden Armen gerade noch so eben. Denn was gibt es Dümmeres, als einem erhabenen Schauspiel mit nassem Hosenboden beizuwohnen?
Kühler Schlick drückte sich zwischen seinen nackten Zehen hoch. Ihn fröstelte. Gänsehaut überzog seine Beine, die in abgeschnittenen Jeans steckten. Ein abgewetzter Troyer schützte seinen Oberkörper vor dem frischen Wind aus West. Tom strich sich seine kinnlangen Haare aus dem Gesicht.
Mal schneiden lassen, sagte er sich.
In der salzigen Luft um ihn herum roch es nach angeschwemmtem Tang, nach Schlick und nach dem Meer. Tom roch das gern. Die Nordsee rauschte 200 Meter weiter weg mit trägen Schlägen leise an die Waterkant. Er blickte dorthin:
Nichts zu sehen, viel zu finster.
Er hielt im Gehen inne und hob sein Haupt erneut zum Himmel hoch. Die Luft war so klar wie selten. Kein Wölkchen, kein Hauch von Dunst störte den Kontrast zwischen dem tiefen Schwarz des Kosmos und den grell funkelnden Sternen darin. Tom schienen sie zum Greifen nah.
Die Vorstellung am Firmament wurde immer berauschender.
Was für ein phantastischer Anblick!
Leuchtende Schwärme von Sternschnuppen zogen gleißend über den Nachthimmel, wie die Gischt eines gigantischen Wasserfalls – lautlos und in Zeitlupe.
Die kleinen und großen Meteore regneten wie ein Monsun aus Licht aus der Schwärze des Alls auf die Erde herab. Als würde Hephaistos, der griechische Gott des Feuers, Funken stiebend am Schicksal des Weltenganges schmieden.
Tom sah gebannt zu.
Am Himmel war vom kurzen Aufblitzen bis hin zu Kilometer langen Lichtschweifen alles zu sehen: Meteore, die beim Eintritt in die Atmosphäre erst schlagartig aufglühten, um dann schnell zu vergehen - oder um feierlich gemessen auf ihrem Weg zur Erde lange Leuchtspuren zu ziehen.
All das geschah wieder und wieder und immer wieder: eine Sinfonie aus leuchtendem Sternenstaub voller Pracht und Magie.
Tom umfing ein gewaltiger kosmischer Zauber, den er aufsog wie ein Süchtiger die Droge.
Ist das Leben etwa so auf die Erde gekommen?, fragte er sich.
Als göttlicher Funke?
Durch Zufall?
Oder aus Versehen?
Tom war wie in Trance, die Zeit stand still für ihn. Fast erwartete er seine ganz persönliche Erleuchtung.
<Texteinschub 1 Beginn>
Diese himmlische Vorstellung wiederholt sich Jahr für Jahr zur gleichen Zeit. Seit vielen Jahrmillionen. Immer Mitte August, wenn sich die Bahn der Erde mit der Bahn der Perseiden kreuzt. Dieser Meteorschwarm besteht aus dem staubfeinen bis brockengroßen Verlustmaterial des Schweifs von 109P/Swift-Tuttle, eines Kometen, den schon zu Tom Kaysans Zeiten kaum ein Mensch kannte.
Diese eindrucksvollen Meteorschwärme sahen im Industriezeitalter nur wenige Menschen mit ihren eigenen Augen. Weil sich damals kaum jemand mitten in stockfinsterer Nacht weit ab der hellen Ortschaften (mit elektrischen Lampen beleuchtet!) im Freien aufhielt.
Und ordentlich finster muss es schon sein, denn sonst überstrahlen menschliche Lichtquellen dieses fabelhafte Schauspiel aus dem All.
<Texteinschub Ende>
Etwas zischte knapp über Toms Kopf hinweg - schnell wie der Blitz warf er sich zu Boden. In seinen Adern pulsierte Adrenalin:
Das war knapp!
Mit scharfem Klatschen schlug etwas hinter ihm im Schlick ein. Keine 20 Meter weit weg.
Im Lichtkegel seiner Taschenlampe sah er einen kleinen Krater, der sich munter mit Sand und Wasser füllte. In einer halben Minute würde von der Einschlagstelle nichts mehr zu sehen sein.
Von der Einschlagstelle zog eine feine Dampffahne Richtung Ost. Tom besah sich das und sagte sich:
Wohin auch sonst, bei Wind aus West?
Bis gleich darauf der Groschen fiel:
Ein Meteorit!
Mit drei Sätzen war Tom an Ort und Stelle. Er prüfte mit den Fingern vorsichtig die Temperatur des nassen Sandes.
Heiß!
Aber der kalte Schlick kühlte das kosmische Geschoss schnell ab. So hatte er das Fundstück bald geborgen und hielt es im Schein seiner Taschenlampe in der Hand:
Das Äußere des Meteoriten bestand aus porösem Material. Tom schlug den Brocken gegen einen großen Strandkiesel, sodass mürbe Schlacken abplatzten. Davon befreit hielt Tom den Kern in der Hand: eine wulstige, metallisch wirkende Knolle aus ineinander verschachtelten Kugelabschnitten. Insgesamt so groß wie eine mittlere Kartoffel - aber viel schwerer.
Sieht aus wie Erz, wie eine Manganknolle oder wie eine mineralische Druse.
Er schlug den Meteoritenkern nochmal kräftig an den Kiesel. Das satte Klacken klang nach massivem Metall.
Tom stand noch eine Weile im Watt und sah sich das Himmelsspektakel mit den Sternschnuppen über ihm weiter an. Aber mit seinen Gedanken war er nicht mehr ganz dabei.
Metall aus dem Weltall?
Das musste näher untersucht werden. Gleich morgen in Luigis Werkstattschuppen.
Auch weil er im nassen Watt langsam kalte Füße bekam, machte sich Tom auf den sechs Kilometer langen Weg zurück zum Inseldorf.
Auf seinem Weg musste er an das Gespräch mit Jan Goldbek denken, das er vor 10 Tagen bei seinem Abschied von der Werbeagentur Young & Jacoby geführt hatte, für die er vier Jahre lang Ruhm und Ehre eingefahren hatte.
Kapitel 2
Adieu Advertising
4. August, 16:30. Tom Kaysan war genau das, was man einen kreativen Kopf nennt. Er sprühte vor Ideen und spielte in der Hamburger Werbeagentur Young & Jacoby die erste Geige.
Tom verschmolz eine grandiose Idee nach der anderen zu einzigartigen Werbekampagnen. Mit Erfolg – sie gingen um die Welt, sie gewannen begehrte Preise und zierten gelehrte Bücher. Tom hatte es in der Branche weit gebracht: Die Ergebnisse seiner Arbeit grenzten fast an Hellseherei.
Jetzt lockten ihn berühmte Agenturen nach London, New York, Paris usw. Er war das fleischgewordene Klischee des Shooting Stars – kleine grüne Männchen erwarteten ihn schon mit offenen Armen auf dem Mars.
Was Tom allerdings nichts mehr bedeutete. Denn er hatte geschafft, was er sich vorgenommen hatte: Er hatte aus seinen Projekten alles herausgeholt, was drin war.
Mehr ging einfach nicht, die Luft war raus.
Das war der eine Grund, weswegen sich die Werbung für ihn erledigt hatte. Der andere war die schleichende Erkenntnis, dass man Menschen mit immer neuen Produkten nicht glücklicher macht. Mehr noch: Dass Werbung in Zeiten überflüssiger Produkte, die knappe Ressourcen verschlingen, mehr als verwerflich ist. Die Titelseite einer Zeitung hatte es für Tom kürzlich auf den Punkt gebracht. Der Leitartikel oben auf der Seite trug die Schlagzeile:
„Der Weltklimarat warnt: Es ist 5 Minuten nach 12!“
Weiter unten stand eine Werbeanzeige von Porsche:
„Kaufen Sie ein Auto mit 600 PS!“
Sich Beides einzugestehen, war Tom als leidenschaftlichem Werbefachmann nicht leicht gefallen. Als er es dann aber doch tat, war es ihm, als würde durch sein Inneres ein alles durchdringendes elektrisierendes Knistern gehen. Als würde er mit einem Quantensprung in eine neue Dimension vorstoßen. Anschließend wirkten die Dinge um ihn herum auf sonderbare Weise ungewohnt und fremd - aber auch jungfräulich und frisch.
Tom schritt durch den langen Gang der Agentur. Er spürte seine Freiheit so stark, dass er seine Freude darüber am liebsten mit einem lauten Tarzanschrei Kund getan hätte.
Das ließ er aber lieber bleiben.
Denn er war auf dem Weg zu seinem Chef.
Über seine aktuellen Gedanken zum Thema Werbung hatte er Jan Goldbek schon letzte Woche in Kenntnis gesetzt. Der war jedoch mit schwammigen Phrasen ausgewichen. Deshalb klopfte Tom an seine Tür, um jetzt reinen Tisch zu machen.
Goldbek war der leitende Gesellschafter von Young & Jacoby. Er hatte einen kantigen Schädel mit einem dichten grauen Bürstenhaarschnitt. Goldbek trug einen seriösen Gesichtsausdruck mit harten, klugen Augen zur Schau. Er hatte den richtigen Riecher für die Branche. Und er war ein kerniger Typ, im Gespräch gerade heraus.
So wie Tom ja auch:
“Ich habe dir vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mit der Werbung durch bin. Der Ofen ist aus.“
In Goldbeks Gesicht zuckten Muskeln, als wollte er etwas erwidern.
Aber Tom war schneller:
„Da hilft auch kein Wenn und Aber“.
Goldbek schwieg.
Tom sah seinen ehemaligen Chef an, als betrachtete er eine historische Fotografie.
Goldbek musterte Tom dagegen scharf, wie schon oft. Tom Kaysan war ein markanter Typ. Seine grau-grünen Augen unter den langen dunklen Wimpern und dem halblangen Haupthaar verliehen ihm etwas Feminines. Was in leicht irritierendem Kontrast zu seinem übrigen Körperbau stand.
Er hat etwas Archaisches an sich, sagte sich Goldbek. Wie eine Figur von Homer. Aber ob sich ein Odysseus sein Leben lang in einer Werbeagentur wohlgefühlt hätte?
Goldbeks erster Impuls war, Tom von seinem Entschluss abzubringen. Doch eine innere Stimme sagte ihm, dass es so gut und richtig war, wie Tom sich entschieden hatte. Aber er wollte es aus Toms eigenem Mund hören.
„Also, warum?“, fragte Goldbek und lehnte sich in seinem Sessel zurück.
„Was für eine Frage!“, lachte Tom. „Warum denn nicht? Du weißt doch: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Meine Erfolge kann ich nicht mehr toppen. Ich bin aus der Branche rausgewachsen.“
„Nach deinem Job lecken sich Tausende die Finger“, sagte Goldbek.
„Ja, Tausende von Einfaltspinsel. Die sich noch nie gefragt haben, aus welchem Grund man die Instinkte der Leute nach mehr und immer mehr immer weiter anstacheln soll. Die breite Masse kann sich heute Wünsche erfüllen, die vor 50 Jahren undenkbar waren. Damals fuhren die Leute im VW Käfer mit 34 PS über die Alpen nach Rimini in den Urlaub. Heute fahren sie im Porsche Cayenne mit 600 PS durch die Innenstadt, um anzugeben. Das Leben der Menschen heute ist aber keineswegs erfüllter als vor 50 Jahren. Konsum ist nun einmal kurzes Glück ohne Erfüllung.“
„Du warst vier Jahre lang mit Feuereifer dabei“, sagte Goldbek.
„Als junger Kerl habe ich darauf gebrannt, in der Werbung zu arbeiten. Es war schick, interessant und lukrativ. Bis ich erkannt habe, was die Weltwirtschaft tief im Innersten zusammenhält:
Die Gier nach mehr. Nach immer mehr und mehr.
Das ist so monströs wie sinnlos.
Das ist mir zu billig.
So einfach ist das.“
Tom spreizte seine rechte Hand auf dem Tisch. Er hatte lange kräftige Finger. Wie ein Pianist.
„Wie hast du das geschafft, mehr als 30 Jahren in der Werbebranche am Ball zu bleiben? Warum machst du nicht was Sinnvolles mit deinen Fähigkeiten?“, fragte Tom.
Goldbek fixierte ihn mit seinen grauen Augen.
„Dass du über kurz oder lang so reden so würdest, ist mir schon lange klar. Ich habe das Ganze ja irgendwann auch mal kapiert. Allerdings habe ich andere Konsequenzen gezogen als du.
Denn ich verdiene gerne Geld. Und noch lieber gebe ich es aus.
Aus gutem Grund. Du musst dir nur die Erfolge des Fortschritts in den letzten 300 Jahren ansehen.“
Goldbek lächelte glatt. Das konnte er gut.
„Das Streben nach Konsum und Besitz ist die Kraft, die den Wohlstand für uns alle bereitstellt. Durch immer mehr Konsum geht es den Menschen heute auf der ganzen Welt immer besser. Noch nie gab es so wenig Hunger, Krankheit und Krieg wie heute.
Naturwissenschaft plus Kapitalismus, daraus ist der Fortschritt gemacht, der mit Isaac Newton im 18. Jahrhundert langsam Fahrt aufnahm. Um die Menschheit endlich gedeihen zu lassen – nach dreitausend Jahren Stagnation seit der Antike.
Antibiotika rettet heute jeden Tag vielen Millionen Menschen das Leben. Demokratie ist die vorherrschende Regierungsform weltweit. Sklaverei und Kinderarbeit sind geächtet und mit den Rechten für Frauen, Homosexuellen und Transgendern geht es stramm voran. Nur mal so als kleine Auswahl von Vorteilen der Marktwirtschaft. Ist das etwa nichts Sinnvolles? Und ich treibe den Fortschritt mit meiner Arbeit und meinem Konsum mit voran.“
„Das sind durchaus sinnvolle Ergebnisse, aber letztlich nur Nebenprodukte der Wirtschaft“, sagte Tom. „Der Kapitalismus ist ja nicht auf hehre Ziele wie ewigen Frieden oder immerwährende Glück für die Menschen ausgerichtet. Sondern auf das Befriedigen niederer Triebe wie Gier, Wollust und Macht. Diese Motive fördern den Fortschritt, sicherlich. Aber diese Erfolge dabei sind nichts anderes als die Späne beim Hobeln.“
„Genau so ist das“, sagte Goldbek.
Er kam in Fahrt.
„Der Weg ist das Ziel. Die Entwicklung von Wissenschaft und Fortschritt ist nur möglich durch immerwährende Ambition und Strebsamkeit. Durch die Gier. Die Gier ist im Menschen genetisch verankert. Gier ist die Antwort der Evolution auf den permanenten Mangel in der Wildnis – sie ist für die Menschheit seit 3 Millionen Jahren der entscheidende Antrieb.
Mit Gier und Intelligenz hat sie sich der Mensch zum Herrscher des Planeten aufgeschwungen. Die Wissbegier ist die Triebkraft, die den Menschen dem Mittelalter entrissen und den heutigen Humanismus etabliert hat.
Was willst du mehr?
Und weil die Gier tief in der Natur des Menschen verwurzelt ist, sollte man ihr nicht zuwider handeln. Denn das wäre ja pervers. Oder nicht?“
„Du machst es dir einfach“, sagte Tom. „Wir brauchen Klasse statt Masse.“
„Sehen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Mittlerweile sterben ja mehr Menschen an den Folgen von Überernährung als an Unterernährung. Denk nur an Diabetes und Fettleibigkeit. Wo man hobelt, da fallen Späne, das stimmt. Nur fallen sie manchmal auf die falsche Seite.“
Goldbek lachte.
„Was willst du jetzt machen?“, fragte er, nachdem er genug gelacht hatte.
„Ich mache auf Langeoog ein paar Tage Urlaub. Ausspannen, Perspektive wechseln und so. Die Sonne, der Strand und das Rauschen der See: Das ist alles ziemlich meditativ. Da komme ich mit meinen Freunden vom Internat schnell auf neue Gedanken.
„Da habe ich keine Sorge, an Ideen hat es bei dir ja keinen Mangel.“
Deshalb ist dein Abgang ja auch ein herber Schlag für die Agentur“, dachte Goldbek als Tom gegangen war und er aus dem Fenster auf die Straße sah. Als würde die Zukunft von Young & Jacoby da unten in der Gosse liegen.
Tom hat es schon drauf, sinnierte er. Möglicherweise erfindet er ja so etwas Geniales wie den Klettverschluss. Oder er macht etwas ganz anderes, was die Welt verändert.
Was Tom auch bald tat.
<Texteinschub 2 Beginn>
Die Menschen verfügen heute im Jahr 2271 über die gleichen Gene wie vor 250 Jahren im Industriezeitalter. Das sind die Erbanlagen, die unsere Ahnen schon in der Steinzeit zu absoluten Erfolgstypen machten.
Damals sorgten diese Gene für athletische Individuen, die sich in kleinen Gruppen mit einfachen Mitteln in rauer Umwelt als Wildbeuter gut zu behaupten wussten. Diese Menschen waren genetisch optimal an das Leben in der Wildnis im Stammesverband von wenigen Dutzend Individuen angepasst.
Seit dem Beginn der Sesshaftigkeit, der fatalsten Erfindung der Menschheit, also seit dem Sündenfall vor 12.000 Jahren, hatte sich die Menschheit von den steinzeitlichen Verhältnissen weit weg entwickelt – die Menschen machten sich mehr und mehr von ihrer natürlichen Umwelt unabhängig: Sie schufen sich ihre eigene.
Im Industriezeitalter mussten die Menschen nicht mehr in lebensfeindlicher Wildnis um ihr Überleben kämpfen. Sie lebten nicht mehr in kleinen, überschaubaren Gruppen, sondern in Staaten mit vielen Millionen Menschen, mit unüberschaubaren politischen Interessen und vielfach verflochtenen Warenströmen rund um die Welt. Sie lebten im materiellen Überfluss und moralischer Dekadenz. Denn ihre Millionen Jahre alten Gene waren damals und sind heute nach wie vor bestens auf das Leben von Jägern und Sammlern in kleinen Gruppen ausgerichtet.
Diese grundsätzliche Fehlsteuerung der Industriellen Menschheit mit den uralten genetisch verankerten Algorithmen, die das heutige menschliche Verhalten noch immer bestimmen, verursachte die vielen weitreichenden Fehlentwicklungen der Menschen seit der Neolithischen Revolution - in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Angefangen bei der Zerstörung der Natur über die Fehlverteilung von Wohlstand bis hin zu der fatalen Abhängigkeit vom Kupfer.
GOTTALLAH sei Dank, dass ER diese tief greifenden Fehlentwicklungen vor 250 Jahren mit einem Schlag korrigiert hat.
Wir danken dem HERRN, dass wir heute über Einsichten verfügen, die uns gegen Entwicklungen dieser Art wappnen.
<Texteinschub Ende>
Kapitel 3
Das Eiscafé Venezia
12. August, 12:30. Tom strebte auf Langeoog zur Mittagszeit mit dem Fahrrad entspannt vom Strand gen Souvenirgeschäft, um dem Inhaber, einem bekannten Trinker, Postkarten abzukaufen.
Beim Zahlen entdeckte Tom in einer Wandnische hinter der Kasse eine Flasche Wodka und daneben einen Wecker.
Wozu das?, wunderte sich Tom. Etwa für den ersten Schluck am Morgen?
Vom Souvenirgeschäft radelte er weiter zum Venezia, Pizzeria und Eiscafé in einem. Auf dem Weg dorthin ließ er seinen Blick über die vielen farbenfroh dekorierten Stände, Auslagen, Kioske und die vielen anderen Angebote auf den Straßen schweifen. Überall lockte Tand und Tinnef, um die Touristen möglichst billig von ihrem Geld zu trennen. Hier und da erklangen Melodien, die das Herz beschwingten. Farbenfrohe Wimpel und Fähnchen flatterten überall im Wind.
Tom grüßte hier und winkte da - viele seiner ehemaligen Mitschüler waren geborene Insulaner und standen im Begriff das elterliche Hotel, das elterliche Ladengeschäft, den elterlichen Bootsverleih usw. zu übernehmen. Falls sie das nicht schon getan hatten.
Durch Toms Kurzurlaube auf der Insel war der Kontakt zu seinen Schulkameraden nie abgerissen. Die meisten erinnerten sich gerne an die gemeinsame Schulzeit mit den Internatsschülern.
An Tom auch.
Während seiner Fahrt zum Venezia kamen Tom die vielen Gespräche über Gott und die Welt in den Sinn, die sie als Internatszöglinge miteinander geführt hatten. Denn um sich mit Menschen des eigenen oder anderen Schlages auszutauschen, ergeben sich in einer Internatsschule deutlich mehr Gelegenheiten, als auf einer Schule, in denen die Schüler lediglich während des Unterrichts beisammen sind.
In einer Internatsschule ist man dagegen Rund um die Uhr zusammen. So lernt man sich selbst und andere Menschen besser kennen. Ob man will oder nicht.
Zu der Zeit hatte Tom auch Donatella kennengelernt, die jetzige Chefin vom Venezia. Damals hatten sie ein bisschen miteinander geflirtet und hin und wieder einen Zug vom Joint getan. Außerdem sahen sich die beiden laufend im Venezia, denn das illustre Lokal war ein beliebter Treffpunkt des Inselvolks. Donna arbeitete dort nach der Schule am Nachmittag. Und nach dem Abitur den ganzen Tag.
Heute war Donna eine üppige, dunkle Schönheit, ganz klassisch, so wie Sophia Loren in jungen Jahren. Körperlich an den richtigen Stellen von allem eine Spur zu viel. Männer sahen sie gerne an.
Tom auch.
Als sich Donnas Eltern in der Nähe von Neapel zur Ruhe setzten, übernahm sie das Geschäft: Das Venezia war ihr Leben.
Das teilte sie mit Luigi, ihrem Mann aus dem Mezzogiorno.
Luigi kleidete sich mit feinen Anzügen gut und teuer. Er trug einen vier Tage alten schwarzen Stoppelbart und auf seiner Adlernase eine kleine klassische Sonnenbrille von Oakley. Ihre dunklen Gläser wirkten wie zwei schwarze Löcher in seinem scharf geschnittenen Gesicht, in seinem Mundwinkel steckte ein Zigarillo. Seine schwarzen, halblangen Haare hatte er streng nach hinten gekämmt. Luigi sah lebensgefährlichen aus - das machte ihm einen Heidenspaß.
Luigi war ein prima Kerl, Toms Freund und ein ebenso guter Koch wie Ehemann. Er servierte wie ein junger Gott und träumte mit Donna ihren gemeinsamen Traum: von einem italienischen Restaurant mit Eisdiele in der Karibik - die beiden hatten die nasskalten Winter auf Langeoog herzlich satt.
Als Tom beim Venezia vorfuhr, hockte Luigi in seinem feinen Zwirn oben auf der Treppe zur Veranda. Seine Füße steckten in schmalen schwarzen Stiefeletten, die spitz zuliefen wie Stilette. Er sah aus wie ein mordgieriger Killer, der nur darauf wartete, seinen Gegner auf offener Straße im blutigen Duell niederzumachen.
Luigi sah bewegungslos zu, wie sich Tom langsam näherte. Vom Kirchturm schlug es 12:00 Uhr Mittag: Ding. Dang. Deng. Dong.
Luigi schnellte beim letzten Glockenschlag wie aus der Pistole geschossen hoch. Er schnappte sich den Besen, der an der Treppe lehnte und fegte mit großen Schwüngen die Stufen vom Sand frei. Die Sandkörner pfiffen links und rechts durch das schmiedeeiserne Geländer wie Schrotgarben.
„Luigi, du noch hier und nicht in Hollywood?“, lachte Tom.
Luigi grinste zurück: „Kaffee?“
„Ja“, rief Tom und stellte sein Rad unten vor der Veranda ab.
Er setzte sich an den Tresen und Luigi machte sich routiniert an der Kaffeemaschine zu schaffen. Er servierte Toms Espresso mit einer eleganten, blitzschnellen Handbewegung. Sie war so schnell, dass Tom sie kaum war nahm. Er sah tief in seine Tasse: Der Kaffee hatte beim Servieren nicht geschwappt - die Tassenwand war keinen Millimeter hoch benetzt.
Tom schnupperte an seinem aromatischen Espresso, nahm einen Schluck, sah zu Luigi rüber und sagte:
„Saubere Arbeit.“
Luigi sagte:
„Prego.“
Stunden später, als Tom nach einem langen Nachmittag am Strand das Venezia am Abend wieder betrat, lehnten Donna und Jenny Agena mit einer Flasche Prosecco hinten am Tresen, wo kein Tourist etwas zu suchen hatte.
Donna winkte den sonnenverbrannten Tom hinzu.
Jenny war drei Jahre älter als Tom. Sie war groß und blond und schön und hatte Tom während der Schulzeit überhaupt nicht beachtet. Aber das hatte sich geändert.
Als Tom näher kam, schenkte sie ihm einen vielsagenden Blick.
Ihre Augen strahlten.
Die Drei plauderten über Dinge, über die man abends in einer Pizzeria spricht.
Tom erzählte, dass er für den erkrankten Strandkorbwart Joe von Strandabschnitt 5 eingesprungen war. Er erzählte auch von der Geschäftsstrategie seines Strandkorbwartskollegen Klaus von Strandabschnitt 4. Sie war einfach: Wer nicht genug Trinkgeld gab, landete neben den stinkenden und scheppernden Mülleimern mit den Wespen. Oder bei den Duschen mit den schreienden und spritzenden Kindern.
„Die Touris kapieren das schnell“, sagte Klaus.
Tom sagte, dass er solche Geschäftspraktiken ablehne.
Am Strand war es Tom wieder ein mal mehr aufgefallen, wie intensiv die Leute ihre Smartphones benutzten – sie waren süchtig nach den kleinen Dopaminkicks in ihrem Hirn, die auch vollkommen belanglose Informationen auslösten.
Die Sommergäste schienen sich mit ihren Smartphones mehr als mit ihrem tatsächlichen Urlaub zu beschäftigen – um imposante Bilder an Freunde & Follower zu posten: Unsere Strandburg ist die größte und schönste! Um mit der Familie wichtige Infos auszutauschen (Mama hat Migräne) oder um Wikipedia nach Wissenswertem zu durchforsten (Ebbe & Flut – was ist denn das?).
„Vor 13 Jahren hat Apple das iPhone auf den Markt gebracht. Solche Geräte steuern mittlerweile das Verhalten von einigen Milliarden Menschen. Mit vermeintlich wichtigen Informationen, ohne die sie vor 2007 genauso glücklich und zufrieden waren wie heute. Jetzt können sich die meisten Leute ihr Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen“, sagte Tom.
„Wenn das so weiter geht, wie soll das in den nächsten 13 Jahren aussehen?“, fragte Donna.
„Man wickelt seine Kommunikation via Smartphone ab, weil es es einfach und bequem ist“, sagte Jenny.
„Der unbequemste Faktor ist dabei die Bedienung per Hand –tippen, wischen und so weiter. Dieses primitive Hantieren muss weg, das ist weder zeitgemäß noch zukunftsweisend. Es geht um den schnellen Datenfluss zwischen Mensch und Maschine, um eine direkte Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Daran wird heute mit Hochdruck gearbeitet.“
„Interessante Variante“, bemerkte Luigi, den man gar nicht hatte kommen sehen.
„Es geht also darum, die 90 Milliarden Nervenzellen eines menschlichen Gehirns direkt mit einem Computer zu verbinden. Ausschließlich gesteuert durch mentale Befehle dieses Menschen.“
„So steht’s in der neuesten Ausgabe vom „American Scientific“, sagte Jenny.
„Menschen, deren Gehirn man direkt mit einem Elektronengehirn koppelt, würden sich zu einer hyperintelligenten Lebensform aufschwingen. Zu Cyborgs mit einem Intelligenzquotienten von 1000 oder noch weit mehr. Das wäre ein wahnsinniger Entwicklungssprung, mächtiger als alle anderen Entwicklungen der letzten 3 Millonen Jahre menschlicher Evolution zusammen“, sagte Tom.
„Wenn man ein einzelnes Gehirn direkt mit einem Computer verbinden kann, dann kann man ja auch mehrere Gehirne über Computer mit anderen Gehirnen verbinden“, schloss Donna scharfsinnig.
„Wie irre das wäre, wenn man so auf die im Gehirn eines beliebig anderen Menschen gespeicherten Informationen direkt zugreifen könnte. Wenn man also nicht in einer Datenbank nachschlägt. Sondern sich an die gespeicherten Informationen eines Fremden erinnert, als wäre es das eigene Gedächtnis. An dessen früheste Kindheitserinnerungen, an sein in vielen Jahren erworbenes Fachwissen, an seine aktuellen Sorgen und Nöte“, rief Tom.
„Und jetzt stellt euch einmal vor“, grinste Luigi, „man verbindet zwei Milliarden menschlicher Gehirne mit zwei Milliarden Computern zu einem einzigen Netzwerk.“
„Das wäre ein galaktisches System. Das System „Gott“ würde dagegen aussehen wie ein Sandkorn neben dem Mount Everest“, sagte Tom.
„Das ist Gotteslästerung!“, zischte Donna.
„Das ist normal“, sagte Jenny, „seit 300 Jahren läuft die technische Entwicklung immer schneller. Was machbar ist, das wird auch gemacht.“
<Texteinschub 3 Beginn>
Die rasante Entwicklung der Industriellen Welt lässt sich mit einer Exponentialfunktion beschreiben – deren grafische Darstellung eine immer schneller und steiler ansteigende Kurve entspricht.
Am Ende der Exponentialfunktion des industriellen Fortschritts steht ein theoretisch ins Unendliche gesteigertes Wachstum hinsichtlich Schnelligkeit, Größe und Komplexität.
Da das physikalisch aber nicht möglich ist, musste die Entwicklung der Industriellen Welt zwangsläufig in irgendeiner Form enden.
<Texteinschub Ende>
Das Venezia füllte sich wie an jedem Sommerabend mit Feriengästen. Donatella griff den Saisonkräften am Tresen und an den Tischen unter die Arme.
Nachdem Jenny Tom noch einen Augenblick zu lange angesehen hatte, machte sie sich auf den Weg nach nebenan ins Deutsche Haus. Sie hatte das älteste Hotel Langeoogs von ihren Eltern geerbt, dort wollte sie nach dem Rechten sehen.
Sie blieb neben Tom noch kurz stehen.
„Falls du später noch Lust auf internationale Spezialitäten bekommst, bist du bei mir im Deutschen Haus herzlich willkommen.“
Kleine Pause.
“Jederzeit“, fügte sie hinzu und bedachte Tom mit einem hungrigen Blick.
„Jenny, du machst mir wirklich Appetit“, sagte Tom. Er fühlte sich geschmeichelt, dass ihm die schönste Frau der Insel den Hof machte.
Als sie fort war, sah Tom Donna bei der Arbeit zu: Wie sie am Tresen mit präzisen, flüssigen Bewegungen einschenkte, austeilte, aufwischte, auswrang, kassierte, mit den Gästen sprach und so weiter. Sie war ganz in ihrem Element, wie ein Fisch im Wasser.
Nach einer Weile tauchte sie flugs wie Flipper zum Kühlschrank hinunter und kam mit einer Flasche kalten Tresters wieder hoch. Damit setzte sie sich zu Tom.
„Donna, du bewegst dich hinter deinem Tresen wie eine Schauspielerin, die die Rolle ihres Lebens jeden Tag aufs Neue spielt.“
Donna lächelte ihn fragend an.
„Du kennst den Namen des Stücks“, sagte Tom.
Sie neigte ihr schönes Haupt leicht zu seiner Seite, strich sich eine Strähne ihres dunklen Haars aus dem Gesicht zurück und fragte:
„La Donna da Venezia?“
„La Dolce Vita!“, gab Tom zurück.
Beide mussten lachen, weil es einerseits so banal war, aber auch so durch und durch wahr.
Die beiden tranken Grappa und Donna hauchte Tom einen Kuss auf die Wange.
„Ein schönes Bild“, sagte sie versonnen und betrachtete ihre eleganten langen Finger. Diese zierten sorgfältig gepflegte Spitzen.
Vom Tresen her sah Luigi mit einem Auge zu den beiden hin. Mit dem anderen besah er sich seinen linken Zeigefinger. Den hatte er sich an der Glut seines Zigarillos versehentlich verbrannt.
Die Brandstelle kühlte er mit einem Strahl kalten Wassers aus dem Wasserhahn, den der mächtige, auf der höchsten Düne vor dem Dorfe thronende, alles auf der Insel überragende, rot-weiß gestreifte Wasserturm, das Wahrzeichen Langeoogs, speiste.
Kapitel 4
Fokko Gerdes
13. August, 14:00. Nach dem Mittagsbetrieb stand Tom in Luigis Werkstattschuppen neben dem Venezia. Vor ihm auf der Werkbank lag der Meteorit. Luigi kam vom Tresen nicht weg, im Venezia war noch zu viel los. Was ihn schon wurmte, denn einen waschechten Meteoriten bekommt man nicht alle Tage zu sehen.
Also sah sich Tom das kosmische Fundstück alleine an.
Knollig, grau-braun, unscheinbar bis unansehnlich lag das Ding vor ihm. Kein anderer Mensch hätte es im Watt wahrgenommen. Geschweige denn eingesammelt und mitgenommen.
Tom überlegte, wie er vorgehen sollte. Er überlegte, den Meteoriten mit dem Trennschleifer einfach in der Mitte durchzuschneiden, um sein Inneres zu untersuchen.
Genau das tat er auch – und sofort hing feiner, kaum sichtbarer Staub in der Luft. Man sah ihn nur, wenn er in den Sonnenstrahlen tanzte, die durch die Ritzen des Bretterschuppens schienen.
Tom sah sich den Querschnitt des Objekts an. Der von außen unscheinbare Meteorit bestand augenscheinlich zum größten Teil aus einer metallischen Substanz von kupferroter Färbung.
Türkisgrüne Adern zogen sich durch seine Mitte. Nach außen hin fein wie Spinnweben, nach innen hin dicker werdend. Das linsengroße grüne Zentrum, auf das diese Strukturen zuführten, war hohl. Tom nahm Luigis Taschenmikroskop zur Hand. Das Bild, das sich ihm beim Blick dadurch bot, erinnerte ihn an eine mit unzähligen Diamanten gespickte Smaragdmine: Winzig kleine, hypnotisch leuchtende, türkisgrüne Kristallnadeln kleideten das Innerste des Meteoriten wie in einer Druse aus. Dicht an dicht filigran gefügt und fein überzogen mit schimmerndem, weißen Staub.
Wie Aladins Schatzkammer, dachte Tom.
So etwas hatte er noch nicht gesehen.
Sehr ästhetisch, was uns Swift-Tuttle da aus den Tiefen des Weltalls geschickt hat. Was das wohl sein mag?
Vielleicht ein Stück Erz vom Ende des Weltalls?
Teil eines interstellaren Raumschiffs?
Der Stein der Weisen?
Tom ließ seiner Phantasie freien Lauf.
Und lag in allen Fällen daneben.
Denn es war die Büchse der Pandora.
Tom bekam wegen des feinen Staubes einen Niesanfall. Und wirbelte damit noch mehr Staub auf. Sodass er immer heftiger niesen musste und auch den letzten Rest der weißen Partikel aus dem Meteoriten herausprustete.
Tom riss die Tür auf und wankte unter großem „Hatschi“ in einer unsichtbaren Staubwolke aus dem Schuppen nach draußen auf die Barkhausenstraße. Dort rannte er Fokko Gerdes direkt in die Arme. Der Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Langeoog hatte sich vor der anstehenden Einsatzübung mit seinen Männern im Venezia gestärkt. So wie immer am Samstag zu Beginn des wöchentlichen Manövers.
Das Feuerwehrauto, ein grandioser Magirus Jupiter Langhauber, stand direkt in Lee von Luigis Werkstattschuppen.
„Tom Kaysan, was ist denn mit dir los? Und das schon am helllichten Tage! Was sollen denn die Sommergäste denken?“, schnauzte Fokko Tom an.
Dann musste auch Fokko niesen.
Nachdem er sich lauthals geschnäuzt hatte, sprang er schneidig in den Magirus. Mit einer routinierten Drehung aus dem Handgelenk ließ er den kraftvollen V-8 Reihenmotor aufheulen. Dann schaltete er das blendende Blaulicht und das gellende Martinshorn ein, um die Touristen mit Sack und Pack auf der sonst autofreien Insel von der Straße auf die Gehsteige und in die Grünanlagen zu treiben.
Er wollte seine Übung zügig beginnen. Und aus Erfahrung wusste er, dass es auf diesem Weg am schnellsten ging. Denn die Sommergäste waren offenbar der Meinung, man habe ihnen die Straßen geschenkt. Was ja nun wirklich nicht der Fall war.
Der Brandmeister lächelte dünn. Er legte den 1. Gang ein, trat voll aufs Gas und ließ die Kupplung schlagartig kommen - der mächtige Motor brüllte auf und der Magirus und machte einen Satz nach vorne, sodass auch der letzte Touri rasch beiseite sprang.
Tom kannte das Spielchen der Feuerwehr. Es hatte sich seit seiner Schulzeit nicht geändert.
Die Masche stammte wahrscheinlich aus der Zeit, als es noch keine Touristenmassen auf der Insel gab. Sondern nur massenweise Schafe.
Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr saßen Tom und Luigi auf der Verandatreppe des Venezias. Sie warteten auf die Rückkehr der Feuerwehr. Wie so viele andere Menschen auch.
Denn die gestaltete Fokko immer recht spektakulär. Er heizte wie bei der Abfahrt brüllend laut und blendend hell mit über 90 Sachen die Barkhausenstraße entlang. Erst wenige Meter vor dem Venezia nahm er das Gas weg, blockierte mit der Handbremse kurz die Hinterachse, um das Monstrum von Magirus dann mit einem präzisen Lenkraddreh nach links und aufheulendem Vollgas nach rechts zum Driften zu bringen – so dass die Fuhre in Zeitlupe mit einer eleganten Vierteldrehung und durchdrehenden Hinterräder vor dem Venezia zum Stehen kam.
Genau rechtwinklig zur Bordsteinkante.
Dafür hatte Fokko lange geübt.
Seine Fans klatschten dann frenetisch Beifall und ließen ihn hochleben. Fokkos dynamisches Vorfahren war für die Touristen ein echtes Highlight.
In der Hochsaison jede Woche aufs Neue.
Immer Samstagnachmittag um Vier.
So auch heute. Jedenfalls zu Beginn.
Denn statt vor dem Venezia zu Bremsen und den Kurs zu ändern, jagte die Langeooger Feuerwehr wild schlingernd, ohrenbetäubend laut und unglaublich nah am Venezia vorbei. Um gleich darauf mit wüstem Getöse in das Ladengeschäft für Freizeit- und Strandbedarf zu krachen, das Fokkos Eltern führten.
Der Magirus schlug mit seinen ungebremsten 25 Tonnen wie eine Fliegerbombe ein. Eine große Staubwolke stob hoch in die Luft. Der schwer mit Löschwasser betankte LKW rammte seine keilförmige Front bis zur Windschutzscheibe in das zerborstene Schaufenster des Geschäfts, in dem Fokkos Mutter an der Kasse saß.
Tom und Luigi stürmten los und standen gleich darauf im zerstörten Laden vor dem Magirus. Die beiden sahen auf den ersten Blick, dass nicht mehr viel zu helfen war. Die Motorhaube des Magirus troff vor Blut.
Die Windschutzscheibe des Feuerwehrautos war zu harmlosen Krümeln zerfallen. Die große Schaufensterscheibe jedoch zu langen scharfen Dolchen gesplittert.
Einer davon steckte in Fokkos linker Augenhöhle, andere hatten sein Gesicht zerschlitzt. Seinen Brustkorb hatte die Lenksäule zerquetscht, als wäre er von Pappe.
Das Gesicht des mittleren Beifahrers hatte eine massive Glasscherbe wie ein Fallbeil vom Rest des Schädels abgetrennt. Es lag flach auf der Motorhaube, die weit vor Entsetzen aufgerissenen Augen blickten nach oben. Das Gesicht sah aus wie eine obszöne Flunder im Fischgeschäft.
Den Kopf des rechten Beifahrers hatte ein stählernes Armierungseisen aus dem geborstenen Fenstersturz zerrissen.
Die Oberkörper der drei toten Männer von den Frontsitzen neigten sich nach vorne aus der Kabine, als wären sie Schauspieler beim Schlussapplaus.
Hinter ihnen konnte man die Überreste der anderen Feuerwehrleute erkennen - der tonnenschwere Löschwassertank des Magirus hatte sich bei der Kollision hinten aus seiner Verankerung gerissen, die Männer auf der Rückbank zermalmt und nach vorne gepresst.
Unter der aufgesprungenen Fahrertür lag Frau Gerdes neben ihrer Kasse, vom Kotflügel halb enthauptet. Sie lag da in ihrem blutroten Totenbett aus Kleingeld und Scheinen.
Die Motorhaube war einen großen Spalt breit aufgesprungen. Tom sah in den Motorraum hinein. Ein Sonnenstrahl schien auf die Starterbatterie. Tom erhaschte einen Blick auf die Kupferlitzen, die von ihren beiden Polen zum Anlasser führten. Die Litzen waren aber nicht kupferrot. Sondern so grün wie das Innere des Meteoriten aus dem All.
Da schau her.
Tom kannte nicht alle Bestandteile eines Autos, die Kupfer enthielten. Das Bremssystem des Löschwagens offenbar schon.
Es roch streng nach Benzin.
Tom wurde schlecht.
„Raus hier!“, rief er und riss Luigi hinter sich her.
Draußen rannten die Menschen aufgeregt durcheinander. Männer brüllten, Frauen schrien, Kinder weinten. Viele Leute machten Schnappschüsse, andere drehten Videos, telefonierten oder taten alles zugleich. Alle Gaffer schubsten und rempelten, um besser sehen zu können.
Aus dem Benzintank des Magirus tropfte es auf den heißen Auspuff. Der Sprit fing Feuer. Kurz danach explodierte der Tank mit einem dumpfen Knall.
Die Menge schrie auf und wich zurück. Stichflammen leckten vom Magirus an der Fassade des Gerdes’schen Hauses zum Himmel hoch. Eine gewaltige Wolke aus Rauch und Staub breitete sich über dem Ort des Unglücks aus. Sie hüllte alles ein.
Ein Idiot schrie: „Feuerwehr!“
Da diese nicht mehr vorhanden war, weitete sich der Brand, angefacht vom Wind aus West, schnell auf alle drei Geschosse des Hauses aus. Oben angekommen sprang das Feuer flugs von Dachstuhl zu Dachstuhl der Nachbarhäuser, bis sie alle fünf lichterloh in Flammen standen.
Die Urlauber eilten in hellen Scharen von allen Seiten herbei, aus Lokalen, Läden und vom Strand, um ihre geruhsamen Urlaubsimpressionen mit echten Sensationen zu garnieren:
Was für ein prasselndes Flammenmeer!
Was für panische Hausbewohner!
Was für eine irre Schau!
Hunderte mit Handys und Kameras bestückte Hände reckten sich der prasselnden Feuersbrunst entgegen. Die sensationsgeile Menschenmenge wogte auf der Straße mit lauten Rufen nach vorn zur Feuerfront. Wo sie immer mehr hysterisch schreiende Leute in die Flammen zu drücken drohte.
Was die hinten schiebenden Menschen aber nicht sehen konnten. Denn etwas zu sehen bekommen wollten die hinten Stehenden unbedingt. So wie alle anderen ja auch.
Die vier Inselpolizisten waren machtlos gegen die immer mächtiger werdenden Menschenmassen.
Taschendiebstahl und Zechprellerei – das war ihr Metier. Nicht aber Tausende von entfesselten Urlaubern. Die Polizisten wurden schlichtweg ignoriert und samt ihrer Fahrräder von der Straße in die Büsche gedrückt.
Sie konnten nichts mehr tun, als auf Verstärkung vom Festland zu warten.
Kapitel 5
Kupfer oxydiert
13. August, 16:25. Tom und Luigi entdeckten Donna und Jenny, die abseits der Menschenmenge die Köpfe zusammensteckten. Die beiden Freunde eilten hinzu.
„Luigi, Tom, was um Gottes willen ist denn da passiert?“, hustete Donna.
„Sieht so aus, als wären die Bremsen bei dem Feuerwehrwagen ausgefallen“, rief Luigi. „Kein Wunder bei der alten Karre. Aber Fokko wollte ja nichts Neues, sonst hätte er seine Show komplett neu einstudieren müssen.“
Tom sah vor seinem geistigen Auge das Türkisgrün im Inneren des Meteoriten und an den Kupferlitzen des Löschwagens.
Grünspan – oxydiertes Kupfer! Die Staubwolke aus dem Meteoriten.
Die Erkenntnis traf ihn voller mit Wucht. Er schwankte, als würde er zu schwer tragen.
„Seht euch mal die Leute da vorne an“, rief Luigi mit Blick auf eine Traube Feriengäste mit Smartphones, Tablet-Computern, Handycams etc., die sich ihre geöffneten Batterieschächte gegenseitig präsentierten. Ihre Gesichter drückten Verblüffung und Wut aus.
„Schau mal in das Batteriefach deines Telefons“, sagte Tom zu Donna. „Ich habe meines nicht dabei.“
Sie tat, wie ihr geheißen. Dort lachten sie aber keine blanken Leiterbahnen an, sondern tückisches Türkis. Sie drückte auf den Knopf zum Einschalten. Null Funktion.
„Kurz bevor Fokko auf seinem Rückweg durchkam, fiel in der Küche vom Venezia die Mikrowelle aus“, sagte Luigi. „Und kurz danach der Mixer.“
Die Kabel der Küchengeräte waren also zwei Stunden nach dem Öffnen des Meteoriten zerstört. Bei den dünnen Leiterbahnen von Handy & Co. geht es natürlich schneller. Und bei einer explosiven Verseuchung, wie der Magirus sie verursacht hat, geht es noch viel schneller.
Toms Kehle schnürte sich zu.
„Sieht aus, als ob das Kupfer hier auf der Insel plötzlich oxydiert. Dann ist der Strom bald weg“, sagte er tonlos.
„Die Wasserleitungen in den Häusern sind auch aus Kupfer“, sagte Jenny. Die Vier sahen sich unheilschwanger an.
„Abwarten“, sagte Donna optimistisch, „vielleicht ist der Spuk ja Morgen schon vorbei.“
Immer mehr Touristen kamen in die Verlegenheit, ihre Lieben daheim nicht mehr über die spektakulären Vorgänge auf der Insel informieren zu können. Der Versand von sensationellen Fotos und aufwühlenden Filmen kam schnell zum Erliegen, bis sämtliche Geräte ausgefallen waren. Danach sahen die Leute dem flammenden Inferno zu, ohne es auch nur mit einem Pixel dokumentieren und teilen zu können.
„Was ist das hier für eine Scheiße! Von einer deutschen Ferieninsel kann man im Digitalzeitalter ja wohl ein funktionierendes Internet erwarten!“, fluchte ein Feriengast in der Nähe.
Solche Äußerungen führten zu noch mehr Unruhe. Überall wurde laut geredet und gerufen. Die Touristen verstanden die Welt nicht mehr: Das furchtbare Unglück mit dem Magirus und die brennenden, langsam zusammenbrechenden Häuser konnte man ja noch begreifen. Das kannte man aus Film und Fernsehen.
Aber der Exitus aller elektrischen Geräte, die zum alltäglichen Leben einfach dazu gehören? Das war ja nicht zu fassen!
Hinzu kam die Abwesenheit von Ordnung. Vom Festland war noch keine Verstärkung gekommen. Weder für die Polizei noch für die Feuerwehr. Es gab auf der Insel keine Autorität mehr, die den Lauf der Dinge in geordnete Bahnen wies. Die Leute wurden immer aggressiver.
Donna, Luigi und Tom fanden sich im Venezia hinterm Tresen wieder. Jenny war nebenan im Deutschen Haus. Die Pizzeria war rappelvoll. Denn nach all dem Gaffen und Grölen in der Gluthitze des Brandes, nach der Aufregung in den Wolken aus Rauch und Staub hatten die Feriengäste Durst.
Sie dachten tatsächlich, das Leben gehe zumindest hier in der Pizzeria wie gewohnt weiter. Sie meinten, dass man sich hier von den hanebüchenen Vorgängen draußen erholen und einen Gang runterschalten könnte. Die Touris dachten, sie könnten im Venezia einfach mal Pause machen.
Aber da hatten sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Weil die Zapfanlage für kühles Bier, Cola und Co. ausgefallen war, schenkten Donna, Luigi und Tom in der hochsommerlichen Wärme Flaschenware aus dem Hof aus.
Von den Saisonkräften war nichts zu sehen, deshalb mussten die drei Freunde die Touristenschwemme alleine stemmen. Ein hoffnungsloses Unterfangen, wie sich herausstellte:
Denn es ging zu langsam.
Und Kaffee gab es wegen der defekten Kaffeemaschine auch nicht mehr. Genau sowenig wie Tee.
Und die Erfrischungsgetränke erfrischten in lauwarmem Zustand auch nicht. Und davon gab es auch nicht mehr viel.
Und das Bier war zuerst aus.
„Was, kein Bier? Was für ein Scheißladen!“, wurde Tom von einem bulligen Typ mit rotem Gesicht angefahren. Er trug einen lächerlichen Trilby-Hut, der mindestens eine Nummer zu klein auf seinem Glatzkopf thronte.
Das Stimmengewirr der Gäste wurde immer bedrohlicher, bis
ihr Unmut in blanke Wut umschlug. Sie keiften und brüllten ihre Bestellungen und Forderungen über den Tresen. Ihr Geschrei und Getrampel wurde immer lauter. Richtung Eingang hörte man es krachen – dort war man dabei, aus Stuhlbeinen Schlagwaffen zu machen. Zwei Urlauber schickten sich an, über den Tresen zu steigen, um sich mit Gewalt das zu holen, was ihnen ihrer Meinung nach zustand.
Luigi griff zum Feuerlöscher, sah Tom ohne Worte entschlossen an und ließ seinen Blick zum anderen Feuerlöscher am Gang zu den Toiletten neben Tom schweifen.
Tom verstand.
Er riss das Gerät aus dem Wandhalter, zog den Sicherungssplint und richtete die Düse auf den Mann vor ihm auf dem Tresen.
„In die Augen!“, rief Luigi.
Tom drückte ab.
Luigi auch.
Das fordernde Geschrei der Feriengäste verwandelte sich in schmerzerfülltes Geheul, als der beißende Löschschaum in ihre Gesichter schoss. Um ihre brennenden Qualen zu lindern, rieben sich die Leute verzweifelt die Augen. Und trieben sich die ätzenden Chemikalien noch tiefer in die Augenhöhlen - ihre irren Schreie gellten wie von tausend verfluchten Höllenhunden.
Es war nicht zum Aushalten.
„Raus hier, ab zu Jenny ins Deutsche Haus“, brüllte Tom.
Sie flüchteten aus dem Venezia durch den alten Keller ins Hotel nebenan.
„Da seid ihr ja, ich hab mir schon Sorgen gemacht“, rief Jenny, als die drei schnaufend auf der Kellertreppe des Deutschen Hauses auftauchten. „Ich habe den Lärm aus dem Venezia gehört. Was ist passiert?“
„Die Kundschaft hat uns rausgeschmissen, unser Service hat ihnen nicht gepasst. Jetzt verarbeiten diese Leute das Venezia gerade zu Kleinholz“, rief Donna wütend.
„Wie sieht’s hier bei dir aus?“
„Hier ist der Strom komplett weg –ganz schlecht für ein 4-Sterne-Hotel.“ Jenny deutete mit dem Daumen hinter sich zur Rezeption, an der die Hotelgäste Schlange standen, um wegen „unzumutbarer Zustände“ umgehend abzureisen.
„Draußen sieht es nicht besser aus.“ Sie deutete durchs Fenster auf die Bahnhofstraße. Dort sah man Menschen aufgeregt hin und her eilen. In dem Tumult brüllten Väter nach ihren Familien, Mütter riefen in höchsten Tönen nach ihren verlorenen Kindern und die verlorenen Kinder heulten Rotz und Wasser.
Es wurde gedrängelt, geschubst und gestoßen. Alle hatten nur ein Ziel: den Hafen.
„Die Leute drehen durch“, sagte Luigi, „Ich frage mich, wo die vom Festland bleiben, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Die sind im Notfall doch sonst immer im Handumdrehen mit ihren Rettungskreuzern und Hubschraubern da. Irgend etwas läuft hier ganz gewaltig schief.“
„Die Touris rennen uns bald die Bude ein“, sagte Jenny, „Wir müssen das Hotel verbarrikadieren. Und wir müssen Trinkwasser speichern, bevor die Kupferleitungen ihren Geist aufgeben.“
Jenny instruierte das verbliebene Personal für die Befestigung des Deutschen Hauses: Die Fenster im Erdgeschoss mit den schweren Eichentischen aus dem Restaurant blockieren, die Bretter aus der Saunalandschaft herausreißen und damit die Fenster im 1. und 2. Stock zunageln.
Donna, Tom und Luigi fassten mit an, einige der wenigen noch verbliebenen Gäste auch. Die große Mehrheit der Logiergäste verließ das Deutsche Haus jedoch Richtung Hafen. Wie die Ratten das sinkende Schiff.
Kapitel 6
Der Hubschrauber vom Festland
13. August, 18:30. Polizei und Feuerwehr ließen sich noch immer nicht blicken. Stattdessen tauchte ein großer Armeehubschrauber mit heulenden Turbinen und knatternden Rotoren am Himmel auf. Der Helikopter überflog den Ort langsam und systematisch. Er kreiste so tief, dass die Besatzung in der Kanzel und in den geöffneten Seitenluken zum Greifen nah erschien. Die Menschen im Heli trugen Schutzanzüge wie man sie von Chemie- und Reaktorunfällen kennt. Mächtige Staubwolken wirbelten zur Seite weg, sie stoben nach oben und um den Helikopter herum.
Die Leute am Boden sahen zu ihm auf und fragten sich, wo er denn wohl landen würde und was die Laboranten hier zu suchen hätten. Aber der Hubschrauber landete nicht, sondern warf Flugblätter ab.
Mit „Quarantänezone Langeoog“ waren sie überschrieben und mahnten zu Ruhe und Ordnung. Alle Hebel seien in Bewegung gesetzt, um der „Anomalie“ auf der Insel auf den Grund zu gehen und für Abhilfe zu sorgen. Einsatzkräfte, Wissenschaftler und Hilfsgüter kämen schon in Bälde aus der Luft und über die See. Ein Sanitätsschiff werde in Kürze im Hafen einlaufen. Der Fährbetrieb zum Festland ruhe bis auf Weiteres. Das Verlassen der Insel sei im Interesse der Allgemeinheit untersagt, Zuwiderhandlungen würden streng bestraft. Patrouillenboote von Marine, Zoll und Bundespolizei würden diese Anordnung überwachen, hieß es abschließend mit Brief und Siegel.
„Seht ihr, man tut was!“, rief Donna. „Bald ist alles wieder wie früher!“
Da hat man auf dem Festland ja schnell Wind vom Ernst der Lage bekommen, dachte Tom.
Er hatte sich zu Beginn der Katastrophe gewaltige Vorwürfe gemacht, denn die furchtbaren Ereignisse der letzten Stunden hatte allein er zu verantworten. Er hatte die Feuerwehrleute und Frau Gerdes auf dem Gewissen. Und er war sich sicher, dass ihnen bald noch mehr Tote folgen würden. Viel mehr.
Hunderte, Tausende? Wohl eher ein paar Millionen, wenn die Kettenreaktion so weiter geht.
Tom hatte etwas getan, das so monströse Folgen nach sich zog, dass er sich daran im Moment seltsam unbeteiligt fühlte – so als würde er sich als Schauspieler selber doubeln.
Nachdem der Helikopter seine Ladung abgeworfen hatte, schraubte er sich schnell in die Höhe und drehte gen Festland ab. Aber der Hubschrauber war auf seinem Weg aus Ost wohl zu lange in dem Wind aus West geflogen. Denn erst kam der Klang des kraftvollen Knatterns ins Stottern, dann kippte der Hubschrauber langsam nach links, kam ins Trudeln und schmierte mit grässlich aufjaulenden Turbinen vollends ab. Der Heli explodierte in einem Feuerball irgendwo zwischen Bahnhof und Hafen.
Unglaublich, wie schnell sich dieses Phänomen entwickelt. Diese Dynamik hat etwas Lebendiges an sich. Es lebt und vermehrt sich. Dieses Etwas scheint hier sein Paradies auf Erden gefunden zu haben.
Gegen 21:00 Uhr ging die Sonne unter. Ohne die elektrischen Straßenlampen wurde es finster in Langeoogs Straßen. Und mit dem Strom war auch die Wasserversorgung versiegt. Jetzt saßen 12.000 Feriengäste und Insulaner zusammengedrängt auf dem Eiland fest. Ohne nennenswerte Vorräte. Ohne Trinkwasser. Ohne Informationen vom Rest der Welt.
Urlauber und Insulaner, sie alle waren schwer geschockt. So verbrachten sie zagend die erste dunkle Nacht. Die Leute klammerten sich an die Hoffnung auf Hilfe vom Festland, die sie jede Minute erwarteten. Viele Stunden lang. Sie warteten die ganze Nacht in ihren dunklen Quartieren.
Erst die Sonne brachte am nächsten Morgen der Insel das lang ersehnte Tageslicht. Doch auch dann kam die versprochene Hilfe nicht. Kein Wasser und kein Proviant aus der Luft, kein Arzt von der See. Der Mittag verstrich und die Menschen sagten sich, dass das Warten auf Hilfe wohl vergeblich ist.
Am Hafenkai drängten sich mittlerweile Hunderte von kranken Menschen in der Hoffnung auf Ärzte und Arznei.
Tausende von gesunden Menschen tummelten sich im Hafenbecken und hatten alle vorhandenen Schiffe und Boote geentert, um trotz des amtlichen Verbots auf Teufel komm raus zum Festland überzusetzen.
Sowohl die Kranken als auch die Gesunden, sie scheiterten alle.
Erstere, weil kein Sanitätsschiff kam.
Es kam nie.
Die anderen, weil die Boote mit Menschen vollkommen überladen noch im Hafen sanken. Auf einem Schoner saßen die Leute beim Kentern in Trauben bis hoch in die Wanten.
Viele stürzten in ihr Unglück.
So wie junge Frau Pomreinke, die leichten Fußes auf einen Lastkahn sprang, während dieser mit der Dünung vom Kai wegschwang. Sodass sie dessen Deck verfehlte und sie sich – Platsch! - zwischen den Ziegeln der Kaimauer und dem Rumpf des Schiffes im Wasser wiederfand. Bei der nächsten Woge schwang das Schiff zurück zur Mauer. Es gurgelte und knirschte leise. Beim nächsten Schwung - wieder weg vom Kai - sahen die Umstehenden, wie die arme Frau in einem Kranz aus Blasen langsam gen Hafengrund entschwand.
Von Patrouillenbooten war nichts zu sehen. Dieser noch Vorgestern viel befahrene Teil der südlichen Nordsee war bis zur Kimm frei von jedwedem Schiffsverkehr.
<Texteinschub 4 Beginn>
250 Jahren nach der Kupferkatastrophe betreiben die Vereinigten Grafschaften ein Labor mit historischen Geräten, in denen Aluminium, Gold und Silber die elektrische Leitung übernommen haben.
So konnten unsere Wissenschaftler das extraterrestrische Bakterium untersuchen, das Kupfer zu elektrisch nicht leitendem Kupferoxyd zersetzt. Unsere Forscher gaben ihm den lateinischen Namen „Aesamator“ – der Kupferliebende.
Die Untersuchungsergebnisse im Überblick:
Aesamator ist ein einfacher Organismus, ähnlich der anaeroben Archaebakterien in der Tiefsee, die mit ihrem Eisen-Schwefel-Stoffwechsel Energie gewinnen. Aesamator hingegen oxidiert bei seinem Stoffwechsel und seiner rasanten Vermehrung Kupfer.
Das Bakterium selber ist für den menschlichen Organismus im Übrigen vollkommen harmlos.
Bei ungünstigen Umweltbedingungen verkapselt sich Aesamator zu mehreren Millionen Exemplaren in extrem widerstandsfähigen Sporen, die Jahrtausende, wahrscheinlich sogar Jahrmillionen oder noch länger überdauern können. Mit einer Ausnahme: Salzwasser löst die Sporen sofort auf und wirkt auf das Bakterium umgehend tödlich.
<Texteinschub Ende>
Kapitel 7
Luigi entpuppt sich
14. August, 11:30. Die Gemeindeverwaltung hatte mit der Inselpolizei Ordnungskräfte organisiert. Auf freiwilliger Basis.
Das war auch der Grund, warum sich die Ordner fast ausschließlich aus Insulanern rekrutierten. Denn diese hatten ein vitales Interesse an Recht und Ordnung, um ihren Besitz, also Häuser, Maschinen, Tiere und andere Dinge von Wert, zu schützen. Die Touristen dagegen besaßen nichts weiter als ihre Koffer.
So kamen ein paar hundert Freiwillige zusammen, fast die Hälfte der wehrtüchtigen männlichen Insulaner. Die andere Hälfte nahm die Dinge lieber selber in die Hand. Die 700 Ordner hatten die Aufgabe, unter 12.000 Menschen für Ruhe zu sorgen und die knappen Lebens- und Arzneimittel gerecht zu verteilen.
Im Kurhaus war das Hilfszentrum eingerichtet, hier fand die Verteilung der knappen Güter statt. Geduldig standen die Menschen an den mit Stacheldraht und Sandsäcken gesicherten Ausgabestellen an, um ihre kargen Rationen zu empfangen. Quittiert wurde mit einem Stempel auf den Handrücken, um Doppelvergaben zu vermeiden.
Die Ordnungskräfte liefen in Gruppen Streife, um Präsenz zu zeigen. Überall präsent sein konnten sie natürlich nicht, dafür waren sie zu wenige. So konnten flinke Spitzbuben oft weniger flinken Hilfsgutempfängern ihre Rationen entreißen. Und eine zweite gab es nicht, denn Doppelvergaben waren, wie schon erwähnt, nicht vorgesehen.
Kurz nach Mittag begann es auf der Insel zu gären. Rowdys zogen in Trupps durch die Straßen des Inseldorfs, durch die Dünen und die Strände. Sie waren mehr oder weniger alkoholisiert und pöbelten jeden an, der ihnen über den Weg lief. Oder es setzte gleich Schläge. Die Prügeleien unter den rivalisierenden Gruppen wurden immer heftiger, ihr Geschrei gellte immer lauter. Es floss immer mehr Blut.
Dass die Sonne am Abend unterging, machte die Sache nicht besser. Nach Einbruch der zweiten Nacht ohne Strom lag Langeoog wieder im Dunkeln. Im Gegensatz zu gestern war die Hoffnung auf Hilfe jedoch vergangen – denn davon hatte man hier im Katastrophengebiet außer dem nutzlosen Flugblatt seit mehr als 24 Stunden weder gehört noch gesehen.
Dafür hatte man gelernt, dass Straftaten in keinster Weise mehr geahndet wurden. Man konnte machen, was man wollte. Hauptsache, man kam keinem Stärkeren in die Quere.
Es gab kein Licht, die wenigen Kerzen waren schon gestern in der ersten stromlosen Nacht verbraucht worden. Es gab kein Wasser, die Pumpen standen still. In den Klosettschüsseln schwappte die braune Brühe bis zum Rand. Jetzt wurde in die Büsche geschissen.
Der Gestank von Kot und Urin hing in den Straßen, in denen es so finster war wie im Mittelalter. Hinter den dunklen Fenstern der hübschen Backsteinhäuser rußten nur noch improvisierte Ölfunzeln vor sich hin. Angst hing in der Luft.
Kaum zu glauben, dass der ehemals idyllische Kur- und Ferienort nur zwei Abende zuvor noch die fröhliche Stimmung einer bunten, beschaulichen Kirmes verbreitet hatte.
Um 22:30 kamen Jenny und Donna vom Dachboden des Hotels, das alle Gebäude bis auf den Wasserturm auf Langeoog überragte, hinunter ins Erdgeschoss.
Die Lobby am Eingang mit Sofas und Couchtischen hatte sich dort als allgemeiner Treffpunkt etabliert. Hier hatten sich die noch verbliebenen Hotelgäste und Saisonkräfte nach den Befestigungsarbeiten im Hotel versammelt. Man blickte in graue Gesichter.
„Von Bensersiel ist nichts zu sehen“, rief Jenny. „Genau sowenig wie von Dornumersiel und von Neuharlingersiel. Es ist absolut kein Licht vom Festland zu sehen. Von ein paar Sternschnuppen abgesehen herrscht da nur Schwärze.
Die Kupferpest ist drüben angekommen.
Wir sind allein.
Wir sind hier ganz auf uns allein gestellt.“
In dieser zweiten Nacht der Kupferoxydation reagierten die Menschen auf die Katastrophe ganz unterschiedlich. So begannen die einen, rauschende Partys zu feiern, als hätte ihr letztes Stündlein geschlagen.
Wann auch sonst? Denn wer wusste schon, was morgen war?
Also ließen sie die Sau raus.
Erst Hunderte, dann Tausende – bald wogte ein gewaltiges Menschenmeer zwischen den Häusern und durch die Dünen hinunter zum Strand. Erleuchtet von flackernden Flammen, von in Frittierfett getränkten Fackeln.
Tom lehnte im Dunkeln des 3. Stocks im Deutschen Haus am Fenster und sah sich das Treiben auf der Straße an. Viel war nicht zu erkennen, außer sch
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gliese581
Leseratte
G
Beiträge: 198
Wohnort: Sankt Augustin
|
G  12.04.2020 14:08 12.04.2020 14:08
von Gliese581
|
 |
|
Ich hab nur den Anfang des Textes gelesen (ist zu lang für meine knappe Zeit).
Hier nur eine Anmerkung. Meteore sind die Leuchterscheinungen, Meteorite sind die Festkörper, die verglühen oder auf die Erde fallen. Somit ist dieser Satz:
… Meteore, die beim Eintritt in die Atmosphäre
m.E. nicht korrekt (ähnliches an anderen Stellen).
Trotzdem hat mir der Text (soweit gelesen) ganz gut gefallen.
_________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein |
|
| Nach oben |
|
 |
Pompidou
 Erklärbär Erklärbär
P
Alter: 61
Beiträge: 3
Wohnort: 89231 Neu-Ulm
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gliese581
Leseratte
G
Beiträge: 198
Wohnort: Sankt Augustin
|
G  12.04.2020 14:27 12.04.2020 14:27
von Gliese581
|
 |
|
Meteore sind die Leuchterscheinungen – auch Sternschnuppen genannt
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/meteoriten/
_________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein |
|
| Nach oben |
|
 |
Thomas74
 Exposéadler Exposéadler

Alter: 49
Beiträge: 2329
Wohnort: Annaburg
|
  12.04.2020 14:31 12.04.2020 14:31
von Thomas74
|
 |
|
Ich hab trotz der Länge durchgehalten, die Idee hinter der Geschichte gefällt mir. 
Ist das Buch schon in irgendeiner Form erschienen?
_________________
Optimismus ist, bei Gewitter in einer Kupferrüstung auf dem höchsten Berg zu stehen und "Scheiß Götter!!" zu rufen. |
|
| Nach oben |
|
 |
Gliese581
Leseratte
G
Beiträge: 198
Wohnort: Sankt Augustin
|
G  12.04.2020 14:50 12.04.2020 14:50
von Gliese581
|
 |
|
Also wäre der richtige Ausdruck "Meteoroide".
Übrigens leuchten die auch nicht. Es ist die Ionisation der umgebenden Moleküle, die zum Leuchten angeregt werden. Ja, und das nennt man dann Meteor.
_________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein |
|
| Nach oben |
|
 |
Pompidou
 Erklärbär Erklärbär
P
Alter: 61
Beiträge: 3
Wohnort: 89231 Neu-Ulm
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gliese581
Leseratte
G
Beiträge: 198
Wohnort: Sankt Augustin
|
G  12.04.2020 18:03 12.04.2020 18:03
von Gliese581
|
 |
|
Sorry, aber das ist immer noch falsch. Meteor ist die Leuchterscheinung. Das, was du meinst, sind Meteoroide!
Und verglühen müssen sie nicht. Die Leuchterscheinung tritt auch dann auf, wenn sie nicht verglühen - also auf der Erde zu Meteoriten werden.
_________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein |
|
| Nach oben |
|
 |
Xeomer
 Leseratte Leseratte

Alter: 36
Beiträge: 135
Wohnort: Xeothon
|
  16.04.2020 22:30 16.04.2020 22:30
von Xeomer
|
 |
|
Hallo Pompidou,
du wolltest gerne Feedback haben, das möchte ich dir gerne gebe. Bedenke dabei, dass es sich um eine persönliche Meinung handelt.
Im kleinen Klappentext vorne fehlt mir genau ein Satz, der einen Bezug zur Katastrophe, dem Untergang der Menschheit oder zur Apokalypse herstellt. Im Laden würde ich das Buch nach dem Lesen des kurzen Klappentextes wieder weg legen. Zugegebenermaßen, würde ich vermutlich mit dem hinteren anfangen, was diesen Umstand wieder wettmacht. Hier finde ich den ersten Absatz sehr spannend. Das Thema Religion im zweiten Absatz, schreckt mich dagegen wieder etwas ab. Du merkst, ich bin mir hier uneins.
Kommen wir zu den Jahreszahlen:
2271 Zivilisation untergegangen
2171 Gibt es einen Aushang?! oder soll das auch 2271 sein und es hat sich da ein Zahlendreher eingemogelt?
Kapitel 1 startet dann wann? Sag nicht am 13. August 
Ich vermute Mal, jetzt zu unserer Zeit. Ich würde es noch einmal genau dazu schreiben, gerade wenn du mehr als einen Zeitsprung machst.
| Zitat: | Die Vorstellung am Firmament wurde immer berauschender.
Was für ein phantastischer Anblick!
Leuchtende Schwärme von Sternschnuppen zogen gleißend über den Nachthimmel, wie die Gischt eines gigantischen Wasserfalls – lautlos und in Zeitlupe.
Die kleinen und großen Meteore regneten wie ein Monsun aus Licht aus der Schwärze des Alls auf die Erde herab. Als würde Hephaistos, der griechische Gott des Feuers, Funken stiebend am Schicksal des Weltenganges schmieden.
Tom sah gebannt zu.
Am Himmel war vom kurzen Aufblitzen bis hin zu Kilometer langen Lichtschweifen alles zu sehen: Meteore, die beim Eintritt in die Atmosphäre erst schlagartig aufglühten, um dann schnell zu vergehen - oder um feierlich gemessen auf ihrem Weg zur Erde lange Leuchtspuren zu ziehen.
All das geschah wieder und wieder und immer wieder: eine Sinfonie aus leuchtendem Sternenstaub voller Pracht und Magie.
Tom umfing ein gewaltiger kosmischer Zauber, den er aufsog wie ein Süchtiger die Droge.
Ist das Leben etwa so auf die Erde gekommen?, fragte er sich.
Als göttlicher Funke?
Durch Zufall?
Oder aus Versehen? |
Ist mir etwas zu dick aufgetragen. Ich verstehe aber, dass es ein entscheidendes Ereignis ist.
| Zitat: | Denn die gestaltete Fokko immer recht spektakulär. Er heizte wie bei der Abfahrt brüllend laut und blendend hell mit über 90 Sachen die Barkhausenstraße entlang. Erst wenige Meter vor dem Venezia nahm er das Gas weg, blockierte mit der Handbremse kurz die Hinterachse, um das Monstrum von Magirus dann mit einem präzisen Lenkraddreh nach links und aufheulendem Vollgas nach rechts zum Driften zu bringen – so dass die Fuhre in Zeitlupe mit einer eleganten Vierteldrehung und durchdrehenden Hinterräder vor dem Venezia zum Stehen kam.
Genau rechtwinklig zur Bordsteinkante.
Dafür hatte Fokko lange geübt.
Seine Fans klatschten dann frenetisch Beifall und ließen ihn hochleben. Fokkos dynamisches Vorfahren war für die Touristen ein echtes Highlight.
In der Hochsaison jede Woche aufs Neue.
Immer Samstagnachmittag um Vier.
So auch heute. Jedenfalls zu Beginn.
Denn statt vor dem Venezia zu Bremsen und den Kurs zu ändern, jagte die Langeooger Feuerwehr wild schlingernd, ohrenbetäubend laut und unglaublich nah am Venezia vorbei. Um gleich darauf mit wüstem Getöse in das Ladengeschäft für Freizeit- und Strandbedarf zu krachen, das Fokkos Eltern führten.
Der Magirus schlug mit seinen ungebremsten 25 Tonnen wie eine Fliegerbombe ein. Eine große Staubwolke stob hoch in die Luft. Der schwer mit Löschwasser betankte LKW rammte seine keilförmige Front bis zur Windschutzscheibe in das zerborstene Schaufenster des Geschäfts, in dem Fokkos Mutter an der Kasse saß. |
Ok, es gibt also Bakterien die Kupfer auffressen. Nehmen wir einmal an, dass passiert ziemlich schnell und der Fahrer fährt ziemlich fahrlässig, warum genau kann er nicht bremsen? Ich bin kein Autoexperte, aber die Bremsen funktionieren doch hydraulisch mit Druck und Bremsflüssigkeit. Die sollten auch ohne Strom funktionieren. Versteh mich nicht falsch, ich kann damit Leben. Es ist mir nur aufgefallen.
| Zitat: | So etwas hatte er noch nicht gesehen.
Sehr ästhetisch, was uns Swift-Tuttle da aus den Tiefen des Weltalls geschickt hat. Was das wohl sein mag?
Vielleicht ein Stück Erz vom Ende des Weltalls?
Teil eines interstellaren Raumschiffs?
Der Stein der Weisen?
Tom ließ seiner Phantasie freien Lauf.
Und lag in allen Fällen daneben.
Denn es war die Büchse der Pandora. |
Warum darauf hinweisen? Lass den Leser doch darauf kommen. Es ist ohnehin sehr offensichtlich.
Den Rest habe ich ehrlich gesagt mehr überflogen, da es doch einiges an Text ist. Ich finde die Grundidee mit den Bakterien sehr spannend. Mich interessiert auch vor allem, wie du die Gesellschaft nach der Apokalypse erdacht hast. Ein kleiner Dämpfer ist für mich aktuell das Religions-Mischmasch-Gebilde, aber hier kann ich mich täuschen.
Ich hoffe meine Anmerkungen helfen dir.
Viele Grüße,
Xeomer
_________________
"Zone 84" Buchtrailer: youtube.com/watch?v=ZygK3Te0jV8 |
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 1 von 1 |
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
|






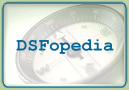









 Login
Login