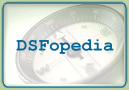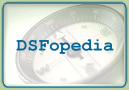|
|
| Autor |
Nachricht |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  20.07.2017 17:46 20.07.2017 17:46
Autobio 1
von Christof Lais Sperl
|
   |
|
|
Neue Version »
Ich wollte meine Autobio mit Fiktion vermengen, und arbeite dazu eine große Arbeit von mir (Amex) durch. Es fällt viel Überflüssiges weg, nur das Wichtigste soll noch zum Zuge kommen. Hier wäre der erste Teil von sehr viel mehr. Mancher und Manchem könnte es bekannt vorkommen.
1
Wenn es zu langweilig wird, drücke ich Farben. Beide Daumen auf die geschlossenen Augenlider, schon ringeln sich Schnüre bunter Jetons durchs Dunkelrot. Nehme ich den Druck, dauert es ein paar Sekunden, bis das grüngelb verstellte Bild wieder klar ist. Sonst gibt es hier nicht viel zu sehen. Links die Fensterreihe mit den dürren Bäumen und den buckligen Krähen, die davon herunterblicken. Und dann sitzt einer vor mir, dessen Kopfhaut durch das kurz geschorene Haar mäandert. In der Form einer flüssigen Hirnrinde drücken sich beflaumte Wülste von unten nach oben, von links nach rechts. Meistens blickt der Vordermann an die Decke, wiegt seinen in die Hände gestützten Kopf hin und her.
Ich bin ein Arschloch.
Und ein hässliches dazu. Damit fängt alles an. Morgens schäme ich mich vor dem eigenen Spiegelbild im Bad, ohrfeige mich, klitsch, klatsch, links und rechts. Um das Selbst zu strafen. Das sich langsam rötende Sackgesicht aus der Welt zu kloppen.
Die anderen sehen ohne Spiegel, wie es um mich steht. Ihr Blick schmerzt. Die würden schon verstehen, warum sich einer wie ich selbst auf die Fresse gibt. Doch öffentlich wäre mir die Selbstzüchtigung dann doch zu geisteskrank. Deshalb bewahre ich das Geheimnis nur für mich. Draußen klappt es auch ohne Selbstklatschen, wenn es nur ums Rotwerden gehen soll. Denn ich werd von ganz alleine rot. Schon wenn die anderen mich nur anstarren.
Einmal nur war es anders, da stand da ein neues Mädchen rum. Die war so pott, dass es mir richtig Angst gemacht hat. Mir wurde schlecht, ohne dass ich genau bestimmen konnte, woran ich die Abneigung festgemacht hatte. Vielleicht lag’s auch nur daran, dass sie nur so regungslos rumstand, ohne was zu sagen. Ich weiß das nicht. Von manchen Farben wir mir auch immer schlecht. Von Silber metallic zum Beispiel. Da weiß ich auch nicht, was an der Farbe so schlimm sein soll, aber ich könnte sofort loskotzen, wenn ich einen Güterzug mit einem Tankwagen in Silber metallic sehe. Grün ist auch schlimm. Vor allem mit Gelb. Das erinnert mich an den Spinat mit Spiegelei, zu dem mich meine Mutter zwingt. Ich schließe immer die Augen und würge das eklige Zeug runter, so schnell, dass ich den widerlich erdigen Geschmack kaum spüre. Wenn man das auf der Zunge zergehen lassen würde, wüsste man, was es heißt, ins Gras zu beißen. Danach will ich mir immer ein paar Treets nehmen, aber meine Mutter verbietet das. Ich soll das Essen schätzen lernen, und erstmal noch an dem Spinatgeschmack im Hals leiden.
Meine Mutter macht auf Normalleben. Wo ich doch weiß, dass die Welt nur dazu gemacht ist, mich zu bescheißen. Ein Schmierentheater von kosmischen Ausmaßen, in dem jeder seine festgelegte Rolle spielt. Um mich Arschgesicht hinters Licht zu führen. Genauso wie die Krähen mitspielen, die von da oben runtergucken. Ein Schnippchen aber habe ich der Kackwelt geschlagen: Ich hab das alles durchschaut. Also, das mit den Rollen und so. Eigentlich hätte mir ja mal einer bescheid sagen können. Aber vielleicht haben die Mitleid mit mir, und denken ich kapiere nix. Irgendeiner muss ihn ja spielen, den Blöden. Und die passende Hackfresse nach außen tragen. Die mit Niveafett gebändigten Scheißlocken undefinierbarer Farbe. Die nach unten weisenden Mundwinkel, die jeden sofort depressiv machen. Abends gucke ich ins Spiegelbild. Aber dann doch wieder gucke ich, meine ich. Ich liebe den Nervenkitzel, der sich einstellt. Wohlig laufen Schauer über den Rücken. Das fühlt sich fast so gut an, wie die Gänsehaut, wenn ich im letzten Moment am Güterbahnhof vor so einer herannagelnden Lok über die vielen Geleise renne, und nicht genau weiß, auf welchem das Teil nun kommt.
Wenn ich tot bin, ist sowieso egal. Dann werde ich ein Friedhofsbaum. Meine Asche dringt als Nährstoff in die Wurzeln. Formt ein Abbild der Pflanze. Ob sie vorher am Grab heulen werden, wenn sie von oben in die Grube glotzen? Ich glaube kaum. Wegen so einem Sackgesicht heult doch keiner. Da gibt jeder eine Schippe drauf, und gut ist. Ob so ein Friedhofsbaum
Irgendwie anders ist als andere? Ob der mehr weiß vom Leben und vom Tod?
So sieht es also aus bei mir. Vorne ein Lehrer, der Großbuchstaben an die Tafel malt, rechts ein paar bunte Bilder. Links die Bäume mit den Krähen. Und vor mir der mit den Hirnfurchen.
Bald bester Kumpel. Wir laufen immer zu dritt heim. Der Wirth, ich, und die Furchenbirne.
Vor der Weggabelung beleidige ich schnell noch den Wirth. Dann links abbiegen. Die Furchenbirne beschützt mich ja noch. Wirth geht geradeaus. Droht. Das Haus vom Kurzgeschorenen kommt als erstes. Die Mutter steht immer schon in der Tür, und wartet mit dem Mittagessen. Ich also erstmal mit dem Furchenkopf links ab, Richtung Mutter. Später dann wieder zweimal links, wo der dicke Wirth in gespielter Wut schon auf mich wartet. So eine Oliver-Hardy-Wut ist das. Eine schwer körperliche. Mich fuchtelnden Armen. Gestikulierend steht der da am Briefkasten, immer steht er am Briefkasten, obwohl er mich auch anderswo abpassen könnte. Gibt mir auf die Fresse. Schwitzkasten. Arschtritte. Aber nur zum Schein. Ganz sanft. Der weiß um seine Kraft. Wir laufen dann gemeinsam weiter. Sein Haus kommt als erstes.
Mein Haus ist hell und von Birken umsäumt. Es enthält auch eine dicke Oma mit hellblauer Küchenuhr. Die regt sich immer auf, wenn im ihrem Radio Rock läuft. Sie mag die Schreierei nicht, sagt sie. Das ist doch kein Gesang. Aber wie sollte eine Rockgruppe ihre Musik spielen, wenn dazu nicht wie blöd geschrieen wird?
Mich nerven die bescheuerten Sportreporter. Wenn mein Vater da ist, hat er immer Fußball an. Offensichtlich kann man über Fußball nur berichten, wenn immer so aufgeregt rumgebrüllt wird. Mich interessiert das nicht. Ist doch scheißegal, ob Frankfurt oder sonst wer das Tor gemacht hat. Tor und gut ist.
Im Sommer kommt eine zweite Oma aus Frankfurt. Eine dünne. Frisst sich drei Wochen bei meiner Mutter durch, fährt dick wieder heim, und wenn an einem Tag mal kein Fleisch auf dem Teller liegt, nur Nudeln mit Tomatensoße oder so was, beschwert sie sich, dass sie bei der Schwiegertochter Hunger leiden muss.
Ich wache immer früh auf. Denke ans Ohrfeigen. Kann mich aber kurz nach dem Aufwachen noch nicht bewegen, und muss mir meinen Körper, den ich noch gestern Abend beweglich ins Bett bewegt habe, ausgehend vom kleinen Zeh, nach und nach zurückerobern. Dann Frühstück, Schmierkäse mit Pilzgeschmack aus dem Glas, Käpt’n Nuss oder so was, Zähne putzen, ohrfeigen, Schule. So sieht es aus.
Weitere Werke von Christof Lais Sperl:
_________________
Lais |
|
| Nach oben |
|
 |
V.K.B.
 [Error C7: not in list] [Error C7: not in list]

Alter: 51
Beiträge: 6153
Wohnort: Nullraum
|
  20.07.2017 19:05 20.07.2017 19:05
von V.K.B.
|
 |
|
Hallo Christof Lais Sperl,
| Zitat: | | Abends gucke ich ins Spiegelbild. Aber dann doch wieder gucke ich, meine ich. |
Der Sinn dieser Sätze erschließt sich mir nicht.
| Zitat: | | Ich bin ein Arschloch. |
Als Arschloch wirkt der Prota auf mich eher nicht. Arschloch assoziere ich mit demjenigen, der Tritte austeilt, nicht mit dem, der einsteckt.
Ich habe mal reingelesen und muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Kann jetzt auch nur textimmanent kommentieren, weil ich nichts über dich weiß und auch noch nichts gelesen habe. Ich weiß auch nicht, in was für einem Kontext welcher größeren Arbeit das steht. Wahrscheinlich ist mein Kommentar daher unqualifiziert. Nimm ihn einfach als Kommentar von jemandem ohne jegliches Vorwissen.
In der Beschreibung sehe ich jemanden, der sich selbst niedermacht, ohne dass ich festmachen kann, warum eigentlich. Der dann einige Dinge kommentiert (Fussball, Famlilie (Omas), Leben und Tod, etc) aber dabei irgendwie lustlos rüberkommt. Andeutungen von Sarkasmus und Zynismus sind zu finden, aber nicht genug, um (jedenfalls für mich) wirklich unterhaltsam oder witzig zu sein. Philosophische Tiefe, wie ich sie von Nicht-Unterhaltungsliteratur erwarte, finde ich auch nicht, die Gedanken des Protas sagen mir nichts Neues und zeigen mir auch keine neue Perspektive auf, aus der größere Denkanstösse entstehen würden. Eine emotionale Verbindung zum Prota und Interesse für sein Leben entsteht bei mir nicht, sorry.
Ich frage mich daher: Was ist der Sinn dieses Textes? Da fehlt mir irgendwas, was mich mitzieht, der Text hat mich noch nicht an der Angel. Ich lese ihn genauso teilnahmslos wie der Prota von sich erzählt. Daher kann ich nur sagen: Leider nicht mein Ding. Aber das ist subjektiv, Texte wie dieser sind nicht für eine riesige Zielgruppe geschrieben, denke ich, und ich gehöre wahrscheinlich einfach nicht dazu.
Flüssig geschrieben und gut lesbar fand ichs aber trotzdem.
Grüße,
Veith
_________________
Hang the cosmic muse!
Oh changelings, thou art so very wrong. T’is not banality that brings us downe. It's fantasy that kills … |
|
| Nach oben |
|
 |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  20.07.2017 21:18 20.07.2017 21:18
Kritik
von Christof Lais Sperl
|
  |
|
Danke! Ich bedenke das!
_________________
Lais |
|
| Nach oben |
|
 |
Canyon
Leseratte

Alter: 44
Beiträge: 128
Wohnort: Nimmerland
|
  20.07.2017 22:56 20.07.2017 22:56
Re: Autobio 1
von Canyon
|
 |
|
Hey Christof 
Ich habe deinen Text heute zweimal gelesen. Beim ersten Mal kam mir die "Stimme" des Erzählers ziemlich aggressiv vor, was dazu geführt hat, dass ich den Text nicht ganz zu Ende lesen konnte. Beim zweiten Mal war es dann aber schon deutlich besser, so dass ich nun versuchen möchte meine Eindrücke zu schildern.
Grundsätzlich hat der Text von Anfang an, und auch während des ersten Lesens, mein Interesse geweckt, sonst hätte ich auch keinen zweiten Versuch gestartet. Die Person, die erzählt, wirkt auf mich wie ein klassischer Außenseiter, der sich selbst in allen Aspekten des Lebens als Verlierer sieht. Die Art und Weise wie er sich selbst, aber auch andere darstellt, macht auf mich den Eindruck, als wäre das "Maß" schon ziemlich voll. Zorn, Verzweiflung, eine gewisse Abgestumpftheit schlagen mir entgegen. Das finde ich allgemein nicht weiter schlimm, vielleicht sogar gerade anregend, um weiter zu lesen. Es gibt viele zornige und unzufriedene Menschen, die sich mit einem solchen Charakter identifizieren können. Auch ich kann das, wobei bei mir eher eine Art Mitleid aufkommt, wie mit einem typischen Mobbingopfer.
Allerdings muss ich zugeben, dass mich der Schreibstil, sofern er in diesem zornigen, verächtlichen Tonfall weiter bestehen sollte, wohl auf Dauer nicht halten könnte. Bei einer Kurzgeschichte mag das (für mich) funktionieren, aber über 200 - 300 Seiten, oder sogar mehr wäre mir das doch zu anstrengend. Würde aber der Protagonist im Laufe der Geschichte eine Entwicklung durchmachen (und damit auch der Schreibstil), wäre das womöglich hinnehmbar ... aber das kann ich ja noch nicht beurteilen.
Was mir beim Lesen auch aufgefallen ist, ist, dass du einige Themen angeschnitten, dann aber nicht weiter verfolgt hast. Zum Beispiel:
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Meine Mutter macht auf Normalleben. |
Spätestens hier würde ich mich fragen: Okay, was ist denn an seinem Leben nicht normal? Denn die Dinge, die er aus seinem Familienleben beschreibt, klingen doch eigentlich super - normal: die Oma, die keine Rockmusik mag, Fußball glotzender Vater, Mutter, die darauf besteht, dass er seinen Spinat isst ...
Und wieso sieht er sich in einem so schlechten Bild, und glaubt, dass auch andere das tun? Da wird sehr viel geschimpft, aber nicht so genau erklärt, warum eigentlich. Wobei doch gerade das für den Leser von größtem Interesse wäre.
Du hast zwar erwähnt, dass du nur das Nötigste schreiben möchtest, und Unwichtiges weglassen, aber vergiss nicht, dass du als Autor vielleicht manche Details als unwichtig betrachtest, da du ja sowieso die Gesamtheit der Geschichte kennst. Als Leser fehlt einem aber im Grunde alles - man kann letztendlich nur das zu einem Gesamtbild verarbeiten, was man zu lesen bekommt. Und um ein rundes Bild zu bekommen, sind ein paar "Schmuckdetails" manchmal ganz nett. Sozusagen als Dekoartikel für die Welt, die man betritt.

_________________
"Du bist, was du warst; und du wirst sein, was du tust."
(Buddha) |
|
| Nach oben |
|
 |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  21.07.2017 10:43 21.07.2017 10:43
Autobio 1.0
von Christof Lais Sperl
|
  |
|
Ich habe die Kritik berücksichtigt. Der Prota wird im Verlauf moderater.
1
Wenn es zu langweilig wird, drücke ich Farben. Beide Daumen auf die geschlossenen Augenlider, schon ringeln sich Schnüre bunter Jetons durchs Dunkelrot. Nehme ich den Druck, dauert es ein paar Sekunden, bis das grüngelb verstellte Bild wieder klar ist. Sonst gibt es hier nicht viel zu sehen. Links die Fensterreihe mit den dürren Bäumen und den buckligen Krähen, die herunterblicken. Und dann sitzt einer vor mir, dessen Kopfhaut durch das kurz geschorene Haar mäandert. In der Form einer flüssigen Hirnrinde drücken sich beflaumte Wülste von unten nach oben, von links nach rechts. Meistens blickt der Vordermann an die Decke, wiegt seinen in die Hände gestützten Kopf hin und her.
Ich bin eine richtig arme Sau. Eine hässliche. Damit fängt alles an. Morgens schäme ich mich vor dem eigenen Spiegelbild im Bad, ohrfeige mich, klitsch, klatsch, links und rechts. Das Selbst zu strafen. Das sich langsam rötende Sackgesicht aus der Welt zu ballern.
Die anderen sehen ohne Spiegel, wie es um mich steht. Deshalb schmerzt auch ihr Blick. Die würden zwar verstehen, warum sich einer wie ich selbst auf die Fresse gibt. Doch öffentlich wäre mir die Selbstzüchtigung dann doch zu geisteskrank. Deshalb bewahre ich das Spiegelgeheimnis nur für mich. Draußen klappt es auch ohne Selbstklatschen, wenn es jetzt mal nur ums Rotwerden gehen soll. Denn ich werd von ganz alleine rot. Schon wenn die anderen mich nur anstarren.
Einmal nur war es anders, da stand ein neues Mädchen vor der Schule rum. Die war so pott, dass es mir richtig Angst gemacht hat. Mir wurde schlecht, ohne dass ich genau bestimmen konnte, woran ich die Abneigung festgemacht hatte. Vielleicht lag es nur daran, dass sie so regungslos rumstand, ohne was zu sagen. Ich weiß das nicht.
Von manchen Farben wir mir auch immer schlecht. Erklären kann ich’s nicht. Von Silber metallic zum Beispiel. Da weiß ich auch nicht, was an der Farbe so schlimm sein soll, aber ich könnte sofort loskotzen, wenn ich einen Güterzug mit einem Tankwagen in Silber metallic sehe. Grün ist auch schlimm. Vor allem mit Gelb. Das erinnert mich an den Spinat mit Spiegelei, zu dem mich meine Mutter zwingt. Ich schließe immer die Augen und würge das eklige Zeug runter, so schnell, dass ich den widerlich erdigen Geschmack kaum spüre. Wenn man das auf der Zunge zergehen lassen würde, wüsste man, was es heißt, ins Gras zu beißen. Danach will ich mir immer ein paar Treets nehmen, aber meine Mutter verbietet das. Ich soll das Essen schätzen lernen, und an dem Spinatgeschmack im Hals leiden. Sie meint, ich gewöhne mich noch dran.
Meine Mutter macht auf Normalleben. In Bezug auf mich, meine ich. Wo ich doch weiß, dass sie ein Monster geboren hat, und die Welt nur dazu gemacht ist, mich zu bescheißen. Ein Schmierentheater von kosmischen Ausmaßen dreht sich um mich, in dem jeder seine festgelegte Rolle spielt. Um mich Arschgesicht hinters Licht zu führen. Genauso wie die Krähen mitspielen, die von da oben ständig runtergucken. Ein Schnippchen aber habe ich der Kackwelt geschlagen: Ich hab das alles durchschaut. Also, das mit den Rollen und so. Eigentlich hätte mir ja mal einer bescheid sagen können. Aber vielleicht haben die Mitleid mit mir, und denken ich kapiere nix. Irgendeiner muss ihn ja spielen, den Blöden. Und die passende Hackfresse nach außen tragen. Die mit Niveafett gebändigten Scheißlocken undefinierbarer Farbe. Die nach unten weisenden Mundwinkel, die jeden sofort depressiv machen. Abends gucke ich ins Spiegelbild. Ich gucke dann doch wieder, meine ich. Ich könnte’s ja vermeiden. Doch ich liebe den Nervenkitzel, der sich einstellt. Wohlig laufen Schauerwellen über den Rücken. Das fühlt sich fast so gut an, wie die Gänsehaut, wenn ich im letzten Moment am Güterbahnhof vor so einer herannagelnden Lok über die vielen Geleise renne, und nicht genau weiß, auf welchem das Teil nun kommt.
Wenn ich tot bin, ist sowieso egal. Dann werde ich hoffentlich ein Friedhofsbaum. Meine Asche dringt als Nährstoff in die Wurzeln. Formt ein Abbild der Pflanze. Dann würd ich richtiog gut aussehen, wie ein Baum eben. Ob alle vorher am Grab heulen werden, wenn sie von oben in die Grube glotzen? Ich glaube kaum. Wegen so einem Sackgesicht heult doch keiner. Da gibt jeder eine Schippe drauf, und gut ist. Ob so ein Friedhofsbaum
Irgendwie anders ist als andere? Ob der mehr weiß vom Leben und vom Tod? Friedhofsbäume sehen anders aus. Wie Grenzbäume. Meinetwegen solche, die direkt hinter der holländischen oder dänischen oder sonst was Grenze stehen. Die sehen dann gleich so ausländisch aus. Anders, eben.
So sieht es also aus bei mir. Vorne ein Lehrer, der Großbuchstaben an die Tafel malt, rechts ein paar bunte Bilder und Landkarten. Links die Bäume mit den Krähen. Und vor mir der mit den Hirnfurchen. Bald bester Kumpel. Wir laufen immer zu dritt heim. Der Wirth, ich, und die Furchenbirne. Vor der Weggabelung beleidige ich schnell noch den Wirth. Dann links abbiegen. Die Furchenbirne beschützt mich jetzt ja noch. Wirth geht geradeaus. Droht mit allen Gliedern. Das Haus vom Kurzgeschorenen kommt als erstes. Die Mutter steht immer schon in der Tür, und wartet mit dem Mittagessen. Ich also erstmal mit dem Furchenkopf links ab, Richtung Mutter. Später dann wieder zweimal links, wo der dicke Wirth in gespielter Wut schon breitbeinig auf mich wartet. So eine Oliver-Hardy-Wut ist das. Eine schwer körperliche. Mich fuchtelnden Armen. Gestikulierend steht der da am Briefkasten, immer steht er am Briefkasten, obwohl er mich auch anderswo abpassen könnte. Gibt mir auf die Fresse. Schwitzkasten. Arschtritte. Aber nur zum Schein. Eigentlich ganz sanft. Der weiß um seine Kraft. Trotzdem hab ich jeden Tag Schiß. Er könnte ja mal richtig zulangen. Wir laufen dann gemeinsam weiter. Sein Haus kommt immer als erstes.
Mein Haus ist hell und von Birken umsäumt. Es enthält auch eine dicke Oma mit hellblauer Küchenuhr. Die regt sich immer auf, wenn im ihrem Radio Rock läuft. Sie mag die Schreierei nicht, sagt sie. Das ist doch kein Gesang. Aber wie sollte eine Rockgruppe ihre Musik spielen, wenn dazu nicht wie blöd geschrieen wird?
Mich nerven die bescheuerten Sportreporter. Wenn mein Vater da ist, hat er immer Fußball an. Offensichtlich kann man über Fußball nur berichten, wenn immer so aufgeregt rumgebrüllt wird. Mich interessiert das nicht. Ist doch scheißegal, ob Frankfurt oder sonst wer das Tor gemacht hat. Tor und gut ist.
Im Sommer kommt eine zweite Oma aus Frankfurt. Eine dünne. Frisst sich drei Wochen bei meiner Mutter durch, fährt dick wieder heim, und wenn an einem Tag mal kein Fleisch auf dem Teller liegt, nur Nudeln mit Tomatensoße oder so was, beschwert sie sich, dass sie bei der Schwiegertochter Hunger leiden muss und frisst im Gasthaus. Bei ihr selbst gib’s aber nie was, wenn wir mal auf Besuch kommen. Heizung auf null, und eine Scheibe Braten für fünf Leute auf dem Tisch.
Ich wache immer früh auf. Denke ans Ohrfeigen. Kann mich aber kurz nach dem Aufwachen noch nicht bewegen, und muss mir meinen Körper, den ich noch gestern Abend beweglich ins Bett bewegt habe, ausgehend vom kleinen Zeh, nach und nach zurückerobern. Vom Schwanz weiß ich noch nichts. Außer pinkeln halt. Dann immer Frühstück, Schmierkäse mit Pilzgeschmack aus dem Glas, Käpt’n Nuss oder so was, Zähne putzen, schiffen, ohrfeigen, Schule. So sieht es aus bei mir.
Nachmittags könnt ich mit dem Gernot spielen. Der darf sich aber nur mit Akademikerkindern treffen, weil seine Eltern ja so hervorragende Akademiker sind. Ich würde den vielleicht verderben. Mein Vater ist ja kein Studierter. Aber immerhin Beamter. Das trägt meine Mutter immer vor sich her. Ein Beamter. Das wäre viel besser als Arbeiter oder Angestellter, meint die immer. Eine Nachbarin hatte mal zu ihr gesagt, ihr eigener Mann sei schließlich bei der Krankenkasse. Also Angestellter im Beamtensinne. Darüber musste meine Mutter immer lauthals überheblich lachen, zu Hause meine ich. So diskret war sie ja schon. Ja, die Akademiker, die waren schon was. Die Frau vom Grundschullehrer flötete deren Namen immer so übertrieben ausgesprochen. Da gab es so eine Sippe Schluhe. Akademiker eben, die nannte die bei den Ansagen zum Flötenkonzert immer Schluwé. Mit ganz langem e. Na ja, die bekamen auch immer die besseren Noten. Ein Schluhe mit Rechnen drei, das gab es nicht. Bei Beamten und so was schon. Na ja, gut war ich ja nie im Rechnen. Schon beim schriftlichen Teilen wurde es eng. Aber ich brauchte das auch nie. Teilen und Brüche und so. Ich zähle jetzt noch die Stunden an den Fingern, wenn was von neun bis siebzehn Uhr dauert. Ich kann zwar siebzehn minus neun rechnen, aber entweder komm ich da immer nicht drauf, oder es ist mit den Fingern bequemer.
_________________
Lais |
|
| Nach oben |
|
 |
V.K.B.
 [Error C7: not in list] [Error C7: not in list]

Alter: 51
Beiträge: 6153
Wohnort: Nullraum
|
  21.07.2017 11:19 21.07.2017 11:19
von V.K.B.
|
 |
|
Schöne Überarbeitung, liest sich viel besser jetzt.
_________________
Hang the cosmic muse!
Oh changelings, thou art so very wrong. T’is not banality that brings us downe. It's fantasy that kills … |
|
| Nach oben |
|
 |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  23.07.2017 10:29 23.07.2017 10:29
Autobio Fortsetzung
von Christof Lais Sperl
|
  |
|
2
Beim Frisör stehen immer Zigaretten auf dem Tisch. Camel. In einer großen Dose. Ich schätze, in so eine Dose gehen mindestens hundert Kippen rein. Ich nehme immer welche vom Frisör mit. Oder aber der Furchenkopf klaut zu Hause welche. Kratzige Gitanes ohne. Oder blaue Gauloises. Meine Alten rauchen ja nicht. Oder nur dann, wenn sie mal besoffen sind, was selten vorkommt. Wenn dann, mit Martini oder Cinzano.
Der Furchenkopf und ich gehen unter die Brücke. Da guckt keiner. Weil da nie jemand lang geht. Also jedenfalls keiner von den Erwachsenen. Da sind ja immer so ein paar alte Nazis drunter. Die dann gleich wieder den Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz feststellen. Obwohl sie selber vielleicht hundert Unschuldige ans Messer geliefert haben. Aber das war ja eine andere Zeit, sagen die immer. Also wir sitzen da immer rum und rauchen, wenn wie nicht den Wettbewerb im Weitpissen machen. Ich gewinne immer. Mein Schwanz ist beschnitten, und die Eichel flutscht nicht so rum, wie die von denen mit Vorhaut. Meine ist schön trocken und unempfindlich. Und so kann ich die ganz vorne, an der Pissöffnung, richtig zusammenquetschen. Dadurch baut sich massig Druck auf, den ich auf den Vortrieb geben kann. Ich komme damit über den Bach, bis zur gegenüberliegenden Brückenmauer. Wie gesagt, außer mir kriegt so was keiner hin. Die anderen haben entweder einen schlappen, dicken Strahl. Oder auch mal zwei dünne. Wie das geht, kapier ich nicht. Aber wenigstens hier bin ich mal die Nummer eins.
Beim Rauchen sieht es gut aus, wenn man die Mundhöhle voll Qualm saugt, dann den Rauch rausdrückt und ihn mit der Nase aufzieht. Wenn es gut klappt, entstehen da zwei Rauchstränge, die parallel nach oben ziehen. Ich rauche immer mit, obwohl meine Mutter das trotz Kaugummi fast immer riecht. Jeden Tag ist an der Haustür Riechkontrolle, und wehe, die merkt was. Dann setzt es ein paar zusätzliche Ohrfeigen. Oder Arrest. Mein Vater hält sich aus allem raus. Nicht, weil es ihm egal wäre. Sondern, weil er mit sich selbst schon so viel zu kämpfen hat. Innerlich. Ihm fehlt die Kraft zum Gefecht mit der Umwelt. Da hört er lieber Fußballgebrüll.
Manchmal kommt die Mia mit. Also, unter die Brücke. Die lässt gern an sich fummeln. Bisschen Brüste kneten und so was. Sie ist schließlich die einzige, die schon am Ende der Vierten so was wie Titten hat. Manchmal stehen wir das zu fünft rum. Ein Fummelpulk. Vier Jungs grabbeln unter dem weiten Pulli, den sie extra für den Grabschauflauf angezogen hat. Von Schwanz und so hat noch keiner Ahnung. Außer zum Pinkeln, wie gesagt. Der wird zwar manchmal hart, aber was das zu bedeuten hat, weiß keiner so genau. Aber die Mia weiß da was, will auch schon immer mal selbst von außen fühlen, wie die ganzen Pimmel in der Hose hart werden. Manchmal holt einer seinen raus. Aber nur zum Rumzeigen. Trotzdem packt Mia ihn dann manchmal an. Pinkeln geht in diesem Zustand nicht.
Ansonsten gibt’s nicht viel zu berichten. Ein paar Kloppereinen dann und wann. Ich halte mich immer an die Kleinen, weil ich ein feiges, grinsendes Arschloch bin. Kapitalverbrecher. Schwächere. Denen kann mal so richtig eine schallern. Gründe gib’s immer: Anderer Stadtteil, Vorort, blond, irgendwas passt schon. Da baut sich eine Freudenwelle auf, die kribbelt durch den ganzen Oberkörper. Patsch, knall ich denen lächelnd eine rein. Und da rennen sie schon, es ihren Müttern zu erzählen. Die Freudenwelle hält ziemlich lange an. Ich hab schon einen Ruf weg, und auf meinen Spielplatz kommen nur noch solche, die neu sind, und keine Ahnung haben. Die kriegen dann auch gleich eine rein. Ist ja schließlich mein Spielplatz. Da hat außer den Kumpeln keiner was zu suchen. Mädchen zählen nicht. Die lasse ich in Ruhe. Wenn die Kumpels da so rumstehen, zugucken, und ich dresche den Kleinen was aufs Maul, sind die immer ganz erstaunt, dass ich so brutal sein kann. Irgendwie finden sie’s lustig. Wir da so einer steht, und gibt denen völlig unverhofft eine auf die Fresse, das muss irgendwie witzig aussehen.
Aber wenn die Feuermelder kommen, haue ich lieber gleich ab. Wo die hintreten, da wächst kein Gras mehr. Drei sehnige Brüder. Sommersprossig, dürre. Die haben fast immer ein paar Bier in der Birne. Auch vormittags. Wenn sie nicht irgendwo rumlaufen, oder zu Hause ihre Mutter beleidigen, stehen sie am Kiosk. Immer mit einer Röhre und einer Malle in der Hand. Gucken böse rum. Runzeln die Augenbrauen runter. Ein Blick aus Beobachtung und Drohung. Unbeweglich wie Schlangen stehen die da an der Bierbude rum und rauchen Malle rotweiß. Bis es mal drauf ankommt, und sie sich wegbewegen müssen. Schlägerei anzetteln, oder im Jugendzentrum die Einrichtung zu Klump hauen, da werden sie ganz schnell beweglich. Da kriegt sogar der Pfarrer eine ab. Der Mittlere von denen, der redet manchmal. Aber nur, wenn es die zwei anderen Rothaarigen nicht mitkriegen. Sonst kriegt der von den eigenen Brüdern aufs Maul. Eigentlich kann der Mittlere ganz in Ordnung sein. Aber im Bruderbund hält er sich dann doch lieber an die Familienregeln. Erst ist er nett. Aber wenn einer der Brüder unverhofft auftaucht, lässt seine Seele die Gesichtsmuskeln wieder auf Angriffsstellung zusammenschnurren. Einmal war ich mit dem Mittleren bei denen im Haus. Eine richtige Bruchbude. In die Esstischplatte hatten sie ihre Namen und Grabkreuze und so was geschnitzt. Wie in der Schule. Der Mittlere nennt seine Mutter immer beim Nachnamen: Frau Boll. Frau Boll hol mal ne Pulle Martini, und so. Die Mutter hat richtig Bammel vor dem. Was der Alte Boll tagsüber genau trieb, wusste keiner. Jedenfalls kam er jeden Abend granatenmäßig aus der Kneipe. Ist dann auch schnell gestorben, der Mann.
3
Irgendwann war Mia weg. Die hatte während der großen Pause im Klassenzimmer aus den Ranzen Geld geklaut. Jetzt, nach den Sommerferien, geht’s aufs Gymnasium. Ich kann zwar immer noch nicht gut rechnen, aber egal, meine Mutter hat mich verdonnert. Ich muss schließlich Akademiker werden und erreichen, was dem Vater verwehrt geblieben war. Der Opa hatte gemeint, in seiner Familie mache man eben kein Abitur. Das hätte noch niemand gemacht. Da wäre die Realschule mehr als ausreichend.
Der Furchenkopf soll auch aufs Gymnasium gehen. Da können wir immer zusammen mit dem Bus fahren, und ich kenne wenigstens schon mal mindestens einen. Im Gymnasium gibt es einen Raucherhof. Der ist zwar der Oberstufe vorbehalten, aber in der Masse der langhaarige und hochgewachsenen Raucher kann man sich ganz gut verstecken. Die Lehrer sind entweder Nazi oder Alternative. Dazwischen gibt es kaum was.
Mancher Alternative ist in Wirklichkeit ein Nazi. Ich sehe das immer in der Sportumkleide. In meiner Klasse ist nämlich der Sohn vom Kunstlehrer: Ein Möchtegern-Dalí, mit langer Mähne und Schnurrbart, der sich seine Schuhe farbig lackiert. Er macht auf verkanntes Genie. In der Sportumkleide kann man den grün und blau geprügelten Körper des Jungen sehen. Der schämt sich gar nicht. Der zeigt das alles her. Als Beweis für die Arschlochnatur des Vaters. Falls noch irgendjemand daran gezweifelt hätte. Vielleicht ist auch die Kinderprügelei in Wahrheit bloß Performance.
Nazis aber, die in Wirklichkeit Alternative sind, gibt es nicht. Die Nazilehrer ziehen die Kinder an den Koteletten bis zur Tafel. Beleidigen sie. Halten Vorlesungen zu Politik und Weltgeschehen. Verteilen Ohrfeigen, wie der kleine schwule Porsche-Giftzwerg in der Sporthalle. Oder die fette Lateinsau K, die sich mit ihrer Marx’schen Gesichtsfotze nach den Pausen immer verschwitzt mitten in den Haupteingang stellt, und die Kinder zwingt, sich an dem fetten Wanst vorbeizudrängeln. Seht, hier steht die Macht, ihr kleinen Pisser, soll das heißen.
Spätestens ab Klasse sieben sind wir darauf gekommen, dass sich der Mann gerne über die Linken aufregt, also alle, die nicht CDUCSU sind. Deshalb besorgen wir Flugblätter von den Kommunisten. Legen sie aufs Pult. Dann steigert sich der Fettsack in Tiraden. Brüllt durch den Rauschebart, gibt für diese Stunde weder Latein noch Deutsch, und wir sind ganz fein raus. Schließlich macht es doch mehr Spaß, den Irren vor der Tafel beim Herumzucken zu beobachten, als irgendwelche Flexionen zu lernen. Aber irgendwann kommen dann doch wieder Zeugnisse und Klassenarbeiten. Manch Begabten verdächtigt er, seine Aufsätze abgeschrieben zu haben, wo auch immer, und verteilt Sechsen wegen Betrugs. Von Mädchen hält er gar nichts. Er meint, die sollten besser ihr Leben in der Küche verbringen und dort die Kämpfer des heiligen Deutschlands bekochen.
Weil man gegen den Verbrecher nichts unternehmen kann, wird sein eigener Sohn von ein paar Leuten aus der Oberstufe entführt. Mitten im Winter muss er, der arme unschuldige Nachkomme, in einer eiskalten Pfütze sitzend dafür büßen, nicht nur Mitschüler, sonder auch Sohn des K zu sein.
_________________
Lais |
|
| Nach oben |
|
 |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  24.07.2017 10:34 24.07.2017 10:34
Autobio Fortzetzung
von Christof Lais Sperl
|
  |
|
4
Ich habe Freunde. Viele Freunde. Es fühlt sich an, als wäre ich ein beliebtes Kind. Aber das kann auch Strategie von den Jungs sein. Vielleicht fühlen die sich größer, wenn sie mit einem Monster durch die Gegend ziehen. Das bringt massig Glanz. Oder ich bin ein Maskottchen, das man sich hält, um wichtig damit tun zu können. Wie ein Liliputaner im Zirkus. Ein Cliquenclown, über den man hinter der Hand überlegen schmunzeln kann, und der als Reserve dient, wenn mal kein anderer Spielkamerad verfügbar ist.
Meine Mutter macht weiter auf Normalleben und sagt, ich sei ein hübscher Junge. Ich nehme ihr das nicht ab. Es gibt ja noch das Spiegelbild. Sagt, dass ich in der Zukunft all das bringen soll, was der Vater nicht leisten kann. Bei den Eltern geht es ständig um Beförderungen. Nur Beamter, also besser als Angestellter, aber trotzdem weniger als Akademiker, das reicht ja nicht. Es muss ja ein hoher Beamter werden. Ein Höherer oder Gehobener. Schicksal des Beamten scheint zu sein, ständig irgendwelchen Beförderungen hinterherzulaufen. Amtmann, Inspektor, sonst was. Wer das nicht bringt, ist Versager. In den ewigen Trauerreden meine Mutter geht es fast immer um nicht erfolgte Beförderungen, Prüfungen und Krankheiten. Jeden Tag kommt das aufs Tapet. Es geht um einen Chef, der sagt, egal welche Note Sie in der Prüfung kriegen, die Beförderung können Sie sowieso vergessen. Es geht um das Zerreiben von Menschen, um Medikamente, die den Menschen, der oft wochenlang im Bett liegt, aufhelfen sollen. Die ihn aber auch zum Pfeifen bringen. Was ihn wieder mütterlicher Lächerlichkeit aussetzt. Weil er vorn morgens bis abends stumpfsinnig herumpfeift. Keine Melodien, sondern tschiup, tschiup, tschiupup. Wie eine Meise im Frühling. Nur traurig. Die Geschichte von Einem, der sich die Welt zurecht- pfeift und schonpfeift, und doch immer wieder scheitern muss. Der alle bösen Gedanken an den öden Job wegträllert. Manchmal im Sommer auf dem Liegestuhl liegt, die Mundwinkel zeigen dabei tieftraurig nach unten. Schon spitzt sich der Mund zum ewigen Tschiup, doch nach ein paar Sekunden fällt das Gesicht wieder ab ins Dunkle. Bis zum nächsten Tschiup. Ich beobachte das eher zufällig als verstohlen, und verstehe nicht, dass Mutter mir heimlich einen Vogel zeigt. Soll wohl heißen, dass der Vater nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Aber das könnte man über sie selbst genau so gut sagen. Ich sag’s ihr aber nicht, sonst krieg ich gleich wieder eine geschossen. Mit ihren ewigen, mit vaginalem Auflachen gewürzten Esstischgeschichten von irgendwelchen Geistlichen und Ärzten, die ihr offenbar zufällig über den Weg laufen, doch deren Nähe sie auch sucht. Der Kleriker fasziniert, weil er nicht darf, aber sicherlich gern wollte. Vor allem bei so einer Hübschen wie Mutter. Und der Mediziner, der fasziniert als Akademiker, Machtträger, Playboy und Porschefahrer. Willst du mich heiraten, soll er die Mutter einmal gefragt haben, lange bevor sie Vater kennen gelernt, und er die Frieda genommen hat. Vater muss sich diese Scheiße täglich anhören. Bald wirken die Medikamente schon nicht mehr. Er versinkt wieder im Bett. Der Doktor verordnet Anderes. Der Vater pfeift nun nicht mehr. Jetzt brummt er wie eine Tuba.
_________________
Lais |
|
| Nach oben |
|
 |
Canyon
Leseratte

Alter: 44
Beiträge: 128
Wohnort: Nimmerland
|
  24.07.2017 12:11 24.07.2017 12:11
Re: Autobio Fortzetzung
von Canyon
|
 |
|
Hey CLS 
Ich leg einfach mal los, mit meinen ersten Eindrücken:
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe Freunde. Viele Freunde. Es fühlt sich an, als wäre ich ein beliebtes Kind. Aber das kann auch Strategie von den Jungs sein. Vielleicht fühlen die sich größer, wenn sie mit einem Monster durch die Gegend ziehen. Das bringt massig Glanz. Oder ich bin ein Maskottchen, das man sich hält, um wichtig damit tun zu können. Wie ein Liliputaner im Zirkus. Ein Cliquenclown, über den man hinter der Hand überlegen schmunzeln kann, und der als Reserve dient, wenn mal kein anderer Spielkamerad verfügbar ist. |
Den Absatz finde ich richtig schön geschrieben. 
Allerdings, auch durch die weiter folgenden Sätze:
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Meine Mutter macht weiter auf Normalleben und sagt, ich sei ein hübscher Junge. Ich nehme ihr das nicht ab. Es gibt ja noch das Spiegelbild. |
... möchte man doch langsam wissen, wo die immer wieder erwähnte Hässlichkeit herrührt? Hat er eine Krankheit, die dazu führt? Ist er von Geburt an oder durch einen Unfall entstellt? Ist er vielleicht gar nicht hässlich, sondern empfindet sich nur so?
Man müsste ja nicht gleich das ganze Geheimnis lüften (denn als solches erscheint es einem irgendwie), aber ein paar Hinweise wären schon toll.

| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Sagt, dass ich in der Zukunft all das bringen soll, was der Vater nicht leisten kann. Bei den Eltern geht es ständig um Beförderungen. Nur Beamter, also besser als Angestellter, aber trotzdem weniger als Akademiker, das reicht ja nicht. Es muss ja ein hoher Beamter werden. Ein Höherer oder Gehobener.
|
Das Problem mit dem Erfolgsdruck, ausgelöst durch die Erwartungshaltung der Mutter, wurde auch in den anderen Textauszügen schon erwähnt, ich denke nicht, dass man das immer wieder wiederholen muss.
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Jeden Tag kommt das aufs Tapet.
|
Aufs Tablett?
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Es geht um das Zerreiben von Menschen, um Medikamente, die den Menschen, der oft wochenlang im Bett liegt, aufhelfen sollen.
|
Eine schöne Formulierung.
| Christof Lais Sperl hat Folgendes geschrieben: |
Keine Melodien, sondern tschiup, tschiup, tschiupup. Wie eine Meise im Frühling. Nur traurig. Die Geschichte von Einem, der sich die Welt zurecht- pfeift und schonpfeift, und doch immer wieder scheitern muss. Der alle bösen Gedanken an den öden Job wegträllert. Manchmal im Sommer auf dem Liegestuhl liegt, die Mundwinkel zeigen dabei tieftraurig nach unten. Schon spitzt sich der Mund zum ewigen Tschiup, doch nach ein paar Sekunden fällt das Gesicht wieder ab ins Dunkle. Bis zum nächsten Tschiup.
|
Der Absatz gefällt mir besonders gut, weil man hier zum ersten Mal, anstelle von Zorn und Abneigung, auch das Gefühl von Mitleid beim Erzähler wahrnimmt.
Mir sind auch noch ein paar ganz allgemeine Sachen aufgefallen:
Du schreibst sehr viele kurze Sätze. Dadurch klingt der Text zuweilen sehr abgehakt, als müsste der Erzähler nach jedem Satz erstmal überlegen, was er als nächstes sagt. Das überträgt sich natürlich auch auf den Leser, was dazu führt, dass - zumindest bei mir - kein "entspannter" Lesefluss aufkommen kann.
Ein weiterer Punkt, der das Lesen ein wenig schwierig gestaltet, ist, dass du keine wörtlich Rede benutzt. Wörtliche Rede kann einen Erzähltext auflockern, so dass die Geschichte nicht so monoton wirkt. Ich weiß nun nicht, ob es bereits ganze Bücher gibt, die tatsächlich nur im Erzählmodus geschrieben sind, vollkommen ohne wörtliche Rede (vielleicht hat jemand Beispiele zur Hand?). Womöglich funktioniert das für manche Leser sogar. Ich persönlich könnte aber kein Buch von mehreren hundert Seiten in diesem Stil lesen.
Auch die Geschichte selbst kommt für meinen Geschmack noch nicht in Gang. Ich rätsele immer noch, wo eigentlich das Problem liegt.
Okay, er ist hässlich - aber ob das auch stimmt, kann der Leser gar nicht beurteilen, weil ihm, wie oben schon erwähnt, dazu die nötigen Informationen fehlen. Er bekommt von zu Hause Druck erfolgreich im Leben zu werden. Ja, okay ... das geht aber vermutlich vielen so. Eventuell ist es für ihn besonders schlimm, weil er glaubt, aufgrund seiner Hässlichkeit, ohnehin nie Erfolg zu haben? Wenn ja, könnte man das noch in den Text mit einbringen.
Er hat offenbar einen kranken Vater, der von der Mutter verspottet wird, und von dem er selber, als Sohn, dadurch auch keine Unterstützung erhält.
Das wäre jetzt für mich tatsächlich der erste Punkt, der sein Leben interessant macht!
Was für eine Krankheit ist das? Vielleicht eine Erbkrankheit? Vielleicht sogar die Krankheit, die ihn (angeblich) so hässlich macht? Wie ist sein Verhältnis zum Vater, oder wie war es vor der Krankheit? Wird er irgendwann Partei für ihn ergreifen und sich gegen die herrische Mutter behaupten?
Bisher wurde viel an der Oberfläche gekratzt, und zwar an etlichen Stellen. Aber tiefer geht die Reise bislang nicht, was schade ist, denn dadurch würden sich bestimmt einige Stellen auftun, die beim Leser mehr Spannung erzeugen. Ansonsten sieht es bisher nämlich nach einer recht normalen Kindheit aus: Zur Schule gehen, rauchen, fummeln, er hat Freunde - wenn auch vielleicht keine echten - aber zumindest ist er nicht alleine, sondern wird von anderen scheinbar in der Gruppe akzeptiert. Ob die Gründe tatsächlich sensationslustiger Natur sind, kann man nicht beurteilen, es gab noch keinen "Beweis" dafür.
Was ich damit sagen will: Mir fehlt ein bisschen der Konflikt und mehr Tiefe in den Charakteren. 
_________________
"Du bist, was du warst; und du wirst sein, was du tust."
(Buddha) |
|
| Nach oben |
|
 |
Christof Lais Sperl
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 62
Beiträge: 941
Wohnort: Hangover
|
  25.07.2017 09:55 25.07.2017 09:55
Autobio. Fortsetzung 5.2
von Christof Lais Sperl
|
  |
|
Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was die Jungs eigentlich von mir wollen. Normalerweise müsste denen doch schlecht werden, wenn sie mich sehen. Genauso, wie mir übel geworden war, als diese Neue an der Schule gewartet hatte. Sie schleppen mich überall mit hin, sogar zu Mia, unter die Brücke. Ob ich bei Mia eine Chance hätte, wenn ich nicht im Pulk mitginge, ganz allein am Wasser stünde? Wäre die Abfuhr so schlimm wie die vom Traummädchen, das ich beim Flaschendrehen für ein paar Sekunden gewonnen hatte, das aber mit spitzem Schrei vorher weggelaufen war? Die anderen hatten dann mit ihr geschimpft, das kannst du nicht tun, der Flaschenhals hat doch auf euch gezeigt, ihr seid beide eingeladen. Und sie hatte mir einen Hauch von Kuss gegeben, nicht mal auf den Mund, extra knapp daneben platziert, leicht und flüchtig wie der Flügel eines Schmetterlings. Eigentlich hatte ich verzichten wollen, und das hübsche Wesen schonen, um es mit meinem heldenhaften Verzicht doch noch zu beeindrucken. Aber die anderen hatten auf Gerechtigkeit bestanden, für alle gälten die gleichen Regeln. Und so war es dann zum Kuss gekommen.
Ich will das Spiegelbild genauer betrachten und ihm eine Weile geben, seine Schrecken zu zeigen, ohne noch kurz zuvor rot geschlagen worden zu sein. Ich will es als etwas Fremdes in aller Ruhe von oben bis unten besehen, wie ein unbekanntes Gemälde an der Wand. Dann will ich es beschreiben und beherrschen, wie einer, der an Höhenangst leidet, und durch das Besteigen hoher Türme seine Krankheit unter Kontrolle bringt.
Meine Mutter hat eine Kommode mit drei Spiegeln. In der Mitte kann man sich von vorn, an den seitlichen von links und rechts betrachten. Man kann die Spiegel sogar fast parallel anordnen, um ein ins dunkle Grün der Unendlichkeit versinkendes Bild mit tausend Gesichtern zu erzeugen. Nun also die Kommode. Unten brüllt der Fußballreporter, und meine Mutter klappert mit Küchengeschirr. Ich bin mit mir ganz allein.
Alles fängt mit vielen ärgerlichen Locken an, die die alten Tanten immer mit der Hand durchfahren: „Wie ein Mädchen! Wie die Mutter!“ Das macht mich so wütend, und immer will ich heulend wegrennen, lasse es dann aber doch bleiben. Ich lese jährlich immer wieder den Tom Sawyer, in dem Locken als „weibisch“ bezeichnet werden. Genau so wie die Szenen mit dem Bretterzaun und der Butter unterm Hut, ist dieses Wort genau neben dem muffigen Geruch der alten Tanten in meinem Hirn fest eingebrannt.
Locken wären ja noch ganz in Ordnung, wenn sie nicht eine undefinierbare Farbe hätten. Weder dunkelblond noch braun, eine, in egal welchem Licht betrachtet, unbestimmbare Farbe.
Ebenso verhält es sich mit den viel zu kleinen Augen, die an ein müdes Ferkel erinnern. Die liegen unter einer übertrieben hohen Stirn, die bestenfalls zu einem sechzigjährigen Ägyptologieprofessor gepasst hätten, nicht aber zu einem Jugendlichen. Der Mund ist einfach nur traurig. Etwas, das man als Kinn bezeichnen könnte, gibt es nicht. Eine bescheuerte Kassenbrille quetscht das Bild zusammen, Armmuskeln sieht man nicht viele, wenn welche da sind, treten sie wegen des überdimensionierten Brustkorbes in den Hintergrund. Ansonsten geht der Rest halsabwärts gerade noch. Von der Seite betrachtet fallen die abfallenden Mundwinkel noch mehr auf. Ihr trübes Profil wird von der krummen Nase untermauert. Die Wangen sind zu großflächig, und nach hinten gezogen, weshalb die Ohren viel zu weit vorn angebracht sind. Auf dem schlecht gewachsenen Kopf sieht es aus, als wäre das Haar wie eine schlecht sitzende Perücke nach hinten gerutscht. Deshalb kann mich wohl kein Lehrer leiden. Nur Marty Feldmann sieht noch schlimmer aus.
Da ich extra einen Zettel und einen Stift mitgenommen habe, beginne ich zu notieren. Den Zettel habe ich vorher in zwei Spalten aufgeteilt. Schlecht, gut. Ich beginne aus der Ablage der Kommode zu notieren.
Schlecht Gut
Locken viele, kräftig
Augen sehr klein eher freundlicher Blick
Apollo-Brille (Augen sehen aber ohne noch bescheuerter aus)
blöde Stirn | | |