  |
|
| Autor |
Nachricht |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  18.05.2016 00:17 18.05.2016 00:17
von Federfarbenfee
|
 |
|
Liebe Pia,
bitte entschuldige meine späte Antwort! <3
Ja, Du hast richtig getippt: Wir waren am Chiemsee. Zumindest ein Hauch von Meer. 
Ich hoffe, inzwischen hast du die Arbeit wieder unter der Kontrolle und nicht umgekehrt. So dass du es auch wagen mögest, hin und wieder das Näschen aus der Kemenate hinaus in den Frühling strecken. 
Herzliche Grüße
Mary 
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  18.05.2016 00:24 18.05.2016 00:24
von Federfarbenfee
|
 |
|
Heute möchte ich Euch mit Kapitel 2 und 3 meines Romanprojektes quälen.
MoL, glaube ich, hatte angesprochen, dass ich zwischen verschiedenen Stilen hin und her hüpfe und wo sie recht hat, hat sie recht.
Gerade im Vergleich der beiden Folgekapitel wird das deutlich. Ursprünglich wollte ich mit den unterschiedlichen Schreibstilen eine Abgrenzung der Epochen erreichen. Der Leser sollte deutlich merken: Aha, jetzt bin ich mal wieder im 18. Jahrhundert. Ich bin mir allerdings selbst unschlüssig, ob das wirklich so funktioniert und nicht eher kontraproduktiv ist. Der Großteil des Romans spielt übrigens in der Gegenwart.
......................................................................
2. Kapitel: Das Geschenk
Es war der Morgen nach Martini. Die güldenen Strahlen der aufgehenden Sonne tauchten die bleichen Bergspitzen in ein rötliches, verheißungsvolles Licht und erweckten König Laurins Rosengarten für kurze Zeit zum Leben. Johann war am Fuße dieses sagenumwobenen Felsmassivs aufgewachsen. Doch auch nach so vielen Jahren hatte der Anblick der glühenden Zacken nichts von seiner Magie verloren. Verzaubert hielt er den Atem an. Als die warme Luft schließlich aus Johanns Mund entwich, bildete sich eine weiße Dampfwolke. Es roch nach Schnee. Der Winter kam früh und ging spät in dieser vorletzten Dekade des ausklingenden 18. Jahrhunderts. Ein wenig willkommener Gast mit unzähligen Nöten im Gepäck. Von einer »kleinen Eiszeit« würde dereinst in den Geschichtsbüchern zu lesen sein.
Selbst durch die geschlossenen Stubenfenster drangen gedämpft Evas Wehschreie. Johann tastete mit klammen Fingern nach der Schnupftabakdose in seiner rechten Jankertasche. Zum Vorschein kam eine ovale, aus Horn gearbeitete Tabatiere. Er gab sich eine ordentliche Prise des schwarzbraunen Pulvers auf den rauen Handrücken und sog den Tabak geräuschvoll durch die Nase. Drinnen folgten derweilen die Schmerzensschreie in immer kürzeren Abständen aufeinander. Sollte dieses Kind tatsächlich überleben, wäre es von noch größerer Bedeutung, dass das Vieh ausreichend Nahrung und damit auch sie selbst zu essen hätten. Seine geröteten Augen wanderten weg von den wilden Felstürmen, hin zu den schroffen Abhängen und den sanfteren Ausläufern der inzwischen kargen Weideflächen. Als Kleinbauer konnte Johann nur wenig Grund sein Eigen nennen. Die schwierigen klimatischen Bedingungen taten ihr Übriges. Ohne Wildheuen wäre es ihm diesen Sommer nicht möglich gewesen, auch nur annähernd genug Grünfutter zu beschaffen. Unbehaglich trat er von einem Fuß auf den anderen. Mehr als einmal war er, um an die kostbaren, entlegenen Grashalme zu gelangen, mit dem Seil über dem Abgrund gehangen, hatte sich in engen Felsspalten unglücklich das Bein eingeklemmt oder war von einem plötzlichen Schneesturm überrascht worden. Johanns treuester Begleiter war die Angst, die sich in seinen Nacken krallte und ihm stets erbarmungslos vor Augen hielt, dass er am Ende eines Tages womöglich nicht mehr nach Hause zurückkehren würde. An jenem Abend im Oktober des vergangenen Jahres war es so weit. Da hätte er fast das Zeitliche gesegnet. Wäre SIE nicht gewesen. Johann schluckte. Nur wenig Speichel benetzte dabei seine ausgedorrte Gurgel. Ob es sich irgendwann rächen würde, dass er dem Gevatter damals ein Schnippchen geschlagen hatte? Verglichen mit den Repressalien, die SIE zu ergreifen in der Lage war, erschien der Tod gar gütig. Johann kratzte sich über die borstigen Bartstoppeln, welche sein hohlwangiges Gesicht noch eingefallener wirken ließen.
In diesem Augenblick durchschnitten die schrillen Schreie des Neugeborenen die morgendliche Stille und Johanns düstere Gedanken. Sein Kind war es, das der Welt lauthals die eigene Ankunft verkündete und ihn in die Gegenwart zurückholte. Das inbrünstige Krakeelen allein erfüllte Johanns Herz bereits mit tiefer Dankbarkeit. Ungeachtet dessen, dass er den Preis kannte – für dieses Geschenk, das er als solches erachtete, trotz der Gegenleistung, die es verlangte. Nach drei Fehl- und zwei Todgeburten war es das erste von Evas und Johanns Kindern, welches diese Erde nicht bereits verlassen musste, ehe es sie überhaupt erblicken durfte. Und dem kräftigen Gebrüll nach zu urteilen würde es auch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dafür kämpfen, am Leben zu bleiben. Ein kleines Lächeln stahl sich über Johanns wettergegerbtes Gesicht.
Gerade, als er seine Rechte auf den abgenutzten, rostigen Griff gelegt hatte, wurde die Tür schwungvoll von innen geöffnet und Anna, die Dorfhebamme, stand ihm gegenüber. Ihre sonst trüben Augen leuchteten. »Johann, kimm gschwing. Das Kind ist da. A Madl isch.« Sie packte ihn unsanft am Arm und zerrte ihn ungeduldig in die warme Stube, dem einzigen beheizten Raum im Haus. »Beide san wohlauf. Dem Herrgott sei Dank.« Johanns Blick fiel zuerst auf seine Frau, die sichtlich erschöpft, aber glückstrahlend inmitten ihres provisorischen Bettenlagers kauerte. Im Arm ein kleines, in Tücher gehülltes Bündel. Während sie das Baby wiegte, formte ihr Mund unbekannte, einem säuselnden Singsang gleichende Worte. Die schweißnassen, aschblonden Haarsträhnen fielen sich lockend über ihre geröteten Wangen. Johann überlegte, ob er Eva jemals derart verzückt und selig erlebt hatte. Außer dem Kind schien sie nichts um sich herum wahrzunehmen. Eine unsichtbare Kuppel wölbte sich schützend über die Beiden.
Johann räusperte sich. Er fühlte sich seltsam unsicher und fehl am Platze. Als Eva ihn endlich bemerkte, verdunkelten sich ihre braunen Augen und die Freude auf ihrem Gesicht wirkte ein wenig gedämpfter. Dann aber straffte sie, soweit es ihr möglich war in Anbetracht der Umstände, ihre Schultern und streckte die freie Hand nach ihm aus. Johann ergriff sie erleichtert. Sein Atem stockte, als Eva das mit dunklem Haarflaum bedeckte Köpfchen aus dem wärmenden Überwurf schälte. Das Baby hatte die Augen geschlossen. Ungläubig betrachtete Johann die rosigen Backen. Vor seinem inneren Auge erschien kurz ein kleines, lebloses Geschöpf. Die Haut fahl und bläulich schimmernd. Da waren sie sie wieder. Die eisernen Klauen, die sein Herz umfassten und es erbarmungslos quetschten. Hastig verdrängte er diese schmerzvolle Erinnerung an sein letztes Kind und wandte seinen Blick wieder dem von unverbrauchtem Leben erfüllten Neugeborenen in Evas Armen zu. So klein und zugleich so vollkommen. Die winzigen, runzligen Finger hatte es in Evas Hemd gekrallt. Der Atem ging ruhig und gleichmäßig. Jetzt schürzte es im Schlaf die herzförmigenLippen und schmatzte. »Sie wird bolamol Hunger kriagn.« Annas Stimme meldet sich aus dem Hintergrund. Eva studierte aufmerksam Johanns Gesichtszüge. Ihr war offensichtlich nicht entgangen, dass sein Gemüt soeben von einem dunklen Schatten gestreift worden war. »Jetzt wird alles gut.« Sie streichelte sanft ihres Mannes Hand, konnte aber ihre innere Zurückhaltung ihm gegenüber nicht verbergen. Die innige Liebe, mit welcher sie ihr Kind überschüttete, würde ihm nie wieder zuteil werden. Und schuld daran war er selbst. Ehe er es verhindern konnte, entwich ein tiefer Seufzer seiner trockenen Kehle. Er gab Eva einen Kuss auf die erhitzte Stirn. Dann strich er vorsichtig mit den Fingerkuppen über die weiche Babyhaut. Die innige Zuneigung, die er für dieses Menschenkind empfand, erschreckte ihn. Sie machte ihn noch verletzlicher, als er sich ohnehin schon fühlte.Und er schämte sich dafür, wenige Augenblicke zuvor den eigenen Tod als vernünftige Alternative in Betracht gezogen zu haben. Seine Tochter zu beschützen, würde von nun an sein größtes Ansinnen sein.
Eva schien das Gleiche zu denken. Obgleich sie wusste, dass sie diesen gesunden Säugling nicht einfach einem glücklichen Zufall zu verdanken hatten und beizeiten ein ungeheurer Tribut zu erbringen wäre, erschien ihre Freude rein und ungetrübt. Er gönnte Eva ihr Glück von Herzen. Zu viele Jahre musste sie ihr Dasein in einer Vorhölle fristen – umgeben von kinderreichen Familien, die ihr jeden Tag aufs Neue das vor Augen führten, was sie so schmerzlich vermisste. Nein, er dachte nicht im Traum daran, Fortunas Bedingungen gerade jetzt zur Sprache zu bringen. Eher würde er sich die Zunge abbeißen. In Johanns eigenem Fleisch saß der ihn langsam, aber stetig vergiftende Stachel jedoch zu tief, um ihn ignorieren zu können.
In diesem Moment schlug das kleine Wesen seine dicht bewimperten Augen auf. Johann erstarrte. Das Neugeborenenblau wurde von einem intensiven Violettton überlagert. Solch eine lila Iris hatte er bisher nur einmal in seinem Leben gesehen. Mit klopfendem Herzen bemerkte er, dass das Mädchen ihn ebenfalls eingehend musterte. Evas Mund hatte währenddessen einen harten Zug angenommen. Das Baby runzelte die zuvor so glatte Stirn und eine kleine steile Falte bildete sich zwischen seinen eigenartigen Äuglein. »Die Farb bleibt net a so.« Anna war nicht entgangen, dass die Stimmung sich verändert hatte. »Wia soll des Madl überhaupt hoassn?« Offensichtlich wollte die Hebamme die Anspannung etwas abmildern. »Dora.« Eva und Johann sagten es gleichzeitig. »Geschenk Gottes«. Denn das war sie. Gleichgültig, welche anderen Mächte da noch ihre Finger im Spiel hatten. Anna nickte wohlgefällig und murmelte einige unverständliche Worte, mit denen sie offensichtlich ihre Zustimmung bekunden wollte.
Doras eindringliches Hungergeschrei riss die Drei schließlich aus ihren Gedanken. Die Hebamme geleitete Johann zum Kachelofen am Eingang der Stube, während Eva sich anschickte, dem Kind die Brust zu geben. Johann ließ sich mit einem ergebenen Seufzer auf der schmalen Ofenbank nieder und lehnte seinen Rücken an die aufgeheizten Kacheln. »Iatz brauchst erstamal an Schnaps.« Anna reichte ihm ein Stamperl Selbstgebrannten. Nun, da er von innen und von außen gleichermaßen gewärmt wurde, war ihm sogleich behaglicher zumute. Anna war eine gute und erfahrene Hebamme, aber was Doras Augen anging, täuschte sie sich. Wenn sie dachte, dass das durchdringende Violett irgendwann dem vertrauten Blau weichen würde. Trotz der ihn umgebenden Hitze fröstelte er wieder.
Als Dora gesättigt war, fasste sich Johann ein Herz und bat darum, sein Kind selbst hochnehmen zu dürfen. Eva legte ihm das Kind vorsichtig in die Arme. Die Wärme dieses kleinen Körpers reichte im Gegensatz zu Ofen und Schnaps bis in die entlegensten Ecken seiner Seele. »Ich liebe Dich,« bekannte er schlicht. Dora hatte die Augen inzwischen wieder geschlossen. Ihre rosigen Lippen waren leicht geöffnet. Im Mundwinkel hing noch ein cremefarbener Tropfen Muttermilch. Johann beugte sich über sie, um diesen einzigartigen Duft, den nur Babys zu verströmen in der Lage sind, einzuatmen. Ihre spärliche Haarpracht kitzelte dabei seine Nase. Er musste lachen und niesen zur gleichen Zeit. Seine Tochter schien dies nicht zu stören. Sie schlief entspannt weiter.
Ein fragiles Idyll, das schon wenige Minuten später die ersten Risse bekam. Als nämlich plötzlich der Türklopfer draußen Besuch ankündigte. Wer mochte das wohl sein zu dieser frühen Stunde? »I geh scho.« Anna erhob sich von ihrem Stuhl und eilte zum Hauseingang. Johann hörte, wie sie die Türe öffnete und sich mit jemanden unterhielt. Die andere Stimme war allerdings so leise, dass er nicht ausmachen konnte, zu wem sie gehörte. Aber er spürte, wie sich die feinen Härchen an seinen Armen aufstellten. Das Kind in seinen Armen wurde nun auch unruhig und fing an zu zappeln. Wahrscheinlich hatte sich Johanns Nervosität auf den Säugling übertragen.
Kurze Zeit später kehrte die Hebamme in die Stuben zurück. Sichtlich verwirrt überreichte sie Johann wortlos einen in Tücher gewickelten Gegenstand. Die Assoziation mit dem gleichfalls in Decken gehülltem Baby lag nahe. Er gab Dora wieder in die schützenden Arme ihrer Mutter. Dann entfernte er widerstrebend den Stoff. »Das ist ja eine ganz ordinäre Enzianwurzel«, rief seine Frau. »Wozu soll die gut sein? Weder ich noch das Kind haben Magenbeschwerden.« Nein, diese Wurzel war nicht dafür vorgesehen, Bauchschmerzen zu kurieren. Johann strich vorsichtig über die raue, knorrige Oberfläche und die menschlichen Extremitäten ähnelnden Auswüchse. Er wusste sehr gut, wofür dieses Gebilde stand und was er damit zu tun hatte. Hastig bedeckte er die Wurzel abermals – verbarg sie vor Evas und Annas fragenden Blicken, die er deutlich im Rücken spürte.
Dann ging er, einem unvermittelten Impuls folgend, zum Fenster. Seine Augen wanderten suchend über den holprigen Weg, der in Serpentinen zu ihrem kleinen Gehöft hinaufführte. Dort unten schritt sie dahin. Eine hochgewachsene Gestalt in einem dunklen Umhang. Bereits so weit entfernt, dass SIE kaum mehr war als ein schwarzer, beweglicher Fleck am Rande seines Gesichtsfeldes. Aus dieser Distanz und vor der gewaltigen Bergkulisse wirkte selbst dieses Weib klein und unscheinbar. Des Morgennebels letzte Schwaden umwaberten die zerklüfteten Felsen und warteten darauf, SIE mitzunehmen. Eine ziehende, von der Urangst ein wenig gebremste Sehnsucht keimte in Johann auf. Fast schien es so, als hätten sich ihr seine Gefühle mitgeteilt: Sie verweilte kurz und drehte dabei den Kopf in Johanns Richtung. Dann war sie hinter der nächsten Biegung verschwunden. «SIE hat Dir die Wurzel gebracht, oder?« Eva stand wohl schon geraume Zeit neben ihm, die noch immer unruhige Dora unermüdlich hin und her wiegend. Als sie ihm diese Frage stellte, wusste er, dass er keinem Trugbild aufgesessen war.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  18.05.2016 00:27 18.05.2016 00:27
von Federfarbenfee
|
 |
|
3. Kapitel: Das alte Haus
Ranieri ist am Leben. Lachend kämpfen sie sich fernab des ausgetretenen Wanderweges durch das dichte Geäst und können die nahe Lichtung bereits erahnen. Der Endorphinrausch verleiht Priska ungeahnte Kräfte. Geschmeidig wie ein Panther erklimmt sie die teils mannshohen Felsbrocken, die von Riesenhand auf dem weichen, von Fichtennadeln übersäten Waldboden versprengt worden zu sein scheinen. Ranieri ist ihr dicht auf den Fersen. Sie spürt seinen warmen Atem in ihrem Nacken. Priska befindet sich in jenem prickelnden Schwebezustand sehnsüchtiger und bangender Vorfreude, den sie so lange wie möglich auszukosten beabsichtigt. Sobald der Zauber der ersten Nacht vorüber wäre, würden flüchtige Berührungen nur mehr eine angenehme und geborgene Wärme erzeugen, sich treffende Fingerspitzen keine explosiven Funken mehr schlagen, heiß-kalte Wechselbäder bei verstohlenen Blicken ausbleiben. Ein uraltes Spiel, dessen Ausgang zwar vorgezeichnet ist, das aber in diesem Stadium noch vom Hauch des Ungewissen umweht wird. Ein rares Lebenselixier, das nicht verschwendet werden darf.
Ranieri steht nun neben ihr. Dicht an dicht verharren sie. Ergötzen sich schweigend an dem Panorama, welches sich ihnen bietet, nachdem auch die letzten Bäume den Blick frei gegeben haben auf die üppige, farbenfrohe Pracht der spätsommerlichen Blumenwiese. Vis-a-vis, auf der anderen Seite des Eisacktals, erhebt sich sanft und grün der Ritten. Dahinter lugen die schneebedeckten Gipfel der Sarntaler Alpen hervor. Die wilden Berge, wie Priska die Dolomiten seit ihrer Kindheit nennt, befinden sich in ihrem Rücken. Ebenso wie das alte Haus, welches sich am oberen Rand des idyllischen Wiesenhangs an eine Felswand kauert. Versteckt hinter einer Handvoll Fichten, wäre es ein Leichtes, dieses baufällige, unscheinbare Gebäude zu ignorieren. Dennoch spürt sie dessen unheimliche Präsenz und ein leiser Schauer schweift über sie hinweg. Nur kurz, dann umfangen sie wieder die warmen Strahlen der Vormittagssonne. Die Blüten locken die Honigbienen mit ihrem verführerischen Duft. Verwundert stellt Priska fest, dass sie das betörende Bouquet in seiner vollen Bandbreite wahrzunehmen in der Lage ist – nicht nur den Anflug eines süßen Aromas wie zumeist.
Ranieris trockene, warme Finger schließen sich um ihre. Hand in Hand wandern sie durch die Blumen und Gräser, dem Abhang entgegen. Von Weitem scheint es so, als würde das bunte Blütenmeer unvermittelt enden und an der Kante der dunkle Abgrund lauern. Tatsächlich spielen hier die eigenen Augen dem Beobachter einen Streich. Der Hang fällt eher allmählich ab. Die Gefahr darf jedoch nicht unterschätzt werden. Auch auf solch paradiesisch anmutenden Bergwiesen haben Menschen – vielleicht vom Glück beschwipst, aber wer weiß das schon – den Halt verloren und sind verunglückt. Ein leichter Wind streicht über die Lichtung. Kein Vergleich zu den Böen weiter oben. Inmitten von Heerscharen unsichtbarer Grillen, die inbrünstig und beinahe ohrenbetäubend um die Gunst der Weibchen zirpen, lassen sich Priska und Ranieri nieder. Der Boden hat ausreichend Sonne gespeichert, deren Wärme er nun großzügig an die beiden jungen Menschen weitergibt.
Eine Weile sitzen sie still da und genießen es, dem Trubel im Tal entflohen zu sein. Es ist menschenleer hier oben. Die meisten Wanderer folgen dem bekannten Weg hinauf zur Trostburg, die oberhalb des Örtchens Waidbruck erhaben auf einem weithin gut sichtbaren Felssporn thront und mit ihrer geheimnisvollen Schönheit die Besucher anzieht. Eine Burg wie aus dem Märchen. Mit einer beeindruckenden Geschichte. Es gibt ein paar Stellen auf dem gegenüberliegenden Ritten, von denen der Wiesenhang mit dem alten Haus gut zu erkennen ist. Schon manch einer hat versucht, dieses magisch anmutende Fleckchen aufzusuchen und dabei die Trostburg als Orientierungspunkt gewählt. Und ist trotz größter Bemühungen gescheitert. So offen sich dieses verwunschene Stückchen Erde aus gebührlicher Entfernung präsentiert, so verborgen scheint es, sobald man sich in unmittelbarer Nähe befindet. Priska und Ranieri haben es vor langer Zeit zufällig entdeckt. Auf einem ihrer endlosen Streifzüge durch die Wälder rund um die Mauern der Trostburg.
»Ich habe meinen Eltern jetzt erzählt, dass ich studieren will,« unterbricht Ranieri nun das Schweigen. Er nimmt ein Spitzwegerichblatt in den Mund und kaut nervös darauf herum. »Wie haben sie es aufgenommen?« Priska weiß, dass vor allem Ranieris Vater andere Pläne hat für seinen Sohn, der zugleich sein einziges Kind ist. Den Hof soll er übernehmen, welcher sich seit vielen Generationen in den Händen der Familie Moroder befindet. Ranieri schenkt ihr einen vielsagenden Blick, dessen Unmut nicht ihr, sondern seinen Eltern gilt. Wie immer, wenn sie in seine unverwechselbaren Augen sieht, muss sie unwillkürlich an den Karersee denken. Eine unendliche Palette berückender Blautöne, je nach Stimmung variierend von freundlich-hell bis bedrohlich-dunkel. Wenn schon ertrinken, dann in diesen tiefen Wassern. Priskas Herz macht einen Satz. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als Ranieris Gesicht in ihre Hände zu nehmen und die verbitterten Züge weich zu küssen. Doch der von ihr Angebetete scheint gerade wenig empfänglich für solcherlei Liebesbezeugungen. »Er sagt, dann muss ich das Geld selbst aufbringen. Und gleich nach Bozen ziehen soll ich, falls ich wirklich auf das Studium bestehe. Er hat keine Lust, mich weiter durchzufüttern, wenn ich die Familie im Stich lasse.« »Hm.« Priska hört seine Worte zwar, aber sie muss sich dazu zwingen, ihnen folgen zu können. Sie ist abgelenkt. Von Ranieris angezogenem Knie, welches das ihre berührt, von seinem dezent-herben Odeur, das den Duft der sie umgebenden Blumen bei Weitem übertrifft. Ein eigens auf mich abgestimmter Blütennektar, der mich dummes Insekt zugleich ins Paradies und ins Verderben zieht, denkt sie und seufzt kurz auf. Jetzt werd nur nicht melodramatisch, Priska, ermahnt sie sich im nächsten Augenblick selbst. Die Pheromone leisten wirklich ganze Arbeit. Sie versucht, ihre wild durcheinander galoppierenden Gefühle und Gedanken zu zügeln und wenigstens einen sinnvollen Satz zu diesem bisher sehr einseitigen Gespräch beizutragen. »Hast Du Dich erkundigt, ob vielleicht ein Stipendium in Frage kommt?« Sie bemüht sich um einen souveränen Eindruck, doch ihre Stimme zittert. Ranieri scheint es nicht bemerkt zu haben. Er hat sich wieder abgewandt. Sein Blick schweift ziellos in die Ferne. Priska studiert verstohlen sein schmales und dennoch markantes Profil. Viel hat er nicht mehr von einem Jugendlichen an sich, obwohl er nächsten Monat erst sein 20. Lebensjahr vollendet. Auf seiner Stirn zeigt sich die altbekannte steile Sorgenfalte. Die sinnlich geschwungenen Lippen sind zu einem dünnen Strich zusammengepresst. Allein der wilde, blonde Haarschopf, auf den die Sonne ständig wechselnde Muster malt, zeugt von dem unbeschwerten, lebenshungrigen Schelm hinter diesem ernsten Antlitz. Sein Mund formt eine Antwort. Doch Priska hört sie nicht mehr. Ranieri und die Wiese verschwimmen vor ihren Augen.
Im nächsten Moment findet sich Priska in der Stube eines heruntergekommenen Gebäudes wieder. Die blinden, schmutzigen Fensterscheiben lassen nur spärliches Licht in den Raum. Dort drüben steht ein wurmstichiger Schaukelstuhl. Ein verschlissenes Kissen liegt auf der Sitzfläche. In den Ecken türmen sich Berge von zerfledderten Büchern und Zeitschriften. Und auf dem alten Kohleherd steht vergessen ein schwerer schwarzer Topf aus Gusseisen. Hier wohnt niemand mehr. Alles, was nicht niet- und nagelfest und von auch nur geringem Wert ist, wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit geplündert. Priska ist äußerst unbehaglich zumute. Ein modriger Geruch liegt in der Luft. Sie muss Ranieri finden. Zögerlich macht sie einen Schritt Richtung Tür. Die morschen Dielen geben knarzend nach und Priska zuckt zusammen. Wie bei einem Tier, das Gefahr wittert, meldet sich nun auch bei ihr der Fluchtreflex. Es besteht kein Zweifel. Sie ist im alten Haus. Ihr Herz klopft hart und schnell gegen die Brust. Mit bis zum Zerreisen angespannten Nerven tappt sie vorwärts. In panikgeschwängerten Situationen wie dieser scheint für Priska die Zeit beinahe still zu stehen. Sekunden werden zu Ewigkeiten, Bewegungen erfolgen in Zeitlupe und jedes einzelne Bild, das sich auf ihre Netzhaut brennt, bleibt dort für immer. Irgendwann ist sie an der Tür angelangt und betritt den schummrigen Hausflur. Sie sehnt sich danach, dieses Haus auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Aber sie will um keinen Preis Ranieri im Stich lassen. Unschlüssig und zitternd verweilt sie an der Schwelle. Über ihr ertönen plötzlich Schritte. Die Decke knarrt und ächzt unter der Erschütterung, als würde sie im nächsten Moment durchbrechen. Priska möchte rufen, aber ihre Kehle fühlt sich an, als wäre sie mit einem dicken Strick umwickelt. Auch das Atmen fällt ihr schwer. »Priska?« Das ist Ranieris Stimme. Er klingt ein wenig dumpf und weiter entfernt, als er ist, aber Priska wird augenblicklich von einer Welle der Erleichterung überflutet. Sie eilt zum Treppenaufgang.
Dann verändert sich alles. Es scheint, als hätte jemand das Loch in der Sanduhr gewaltsam erweitert. Wo sich die Sekunden zuvor zäh hindurchquetschten, rieselt der Sand nun in einem irrsinnigen Tempo nach unten. Zwei schwarze Augen starren Priska unverwandt an. Das hagere Gesicht ist gezeichnet von Verlust, Bitterkeit und dem unterschwelligen Bedürfnis nach Vergeltung. Priska spürt förmlich, wie die Freude über Ranieris Lebenszeichen schlagartig ausgelöscht wird von einer bösartigen Kälte, die ihr bis unter die Haarwurzeln kriecht. Die dunklen Augen gehören einer Frau mittleren Alters, die oberhalb des Treppenabsatzes von einem vergilbten Schwarz-Weiß-Foto auf sie herabschaut. Diese Erkenntnis hilft Priskas aufgewühlter Seele jedoch nicht, denn über ihrem Kopf hört sie Ranieris schmerzerfüllte Schreie und im gleichen Moment hinter sich das Rascheln eines langen Rockes. Als sie die letzten Stufen der baufälligen Treppe erreicht hat, wirft sie im Laufen hastig einen Blick nach unten. Sie vermeint eine Bewegung wahrzunehmen. Eine Art Nachbild von einer schwarz gewandeten Gestalt, die gerade um die Ecke in die Stube entschwindet. Noch vor wenigen Minuten hatte Priska eben dort innegehalten. »Das ist wie in einem furchtbaren Alptraum,« denkt sie verzweifelt, während sie fast besinnungslos in die Richtung stolpert, aus welcher sie Ranieris Rufe vernommen hat. Die Kammer rechter Hand befindet sich genau über der Stube. Hier muss er sein. Rasch tritt sie ein, um der Angst zuvorzukommen, die sie in Kürze endgültig lähmen würde. Jemand schiebt sich bedächtig in ihr Sichtfeld. Doch es ist nicht Ranieri. Noch bevor ihre Augen an ihr Gehirn weitergeben, was sie da vor sich sieht, spürt sie es. Die Härchen auf ihren Unterarmen stellen sich auf und die Kälte in ihr wird zu Eis.
Sie ist groß. Priska registriert zuerst die reich verzierte Brosche, welche am Kragen der Spitzenbluse befestigt ist. Sie will es nicht und schaut dennoch nach oben. Zwei schwarze Augen fixieren sie lauernd. Der lange Rock raschelt, als sie auf Priska zugeht.
Schweißgebadet und panisch röchelnd fährt sie hoch. Ihre Finger sind in der Bettdecke verkrallt. Sie hat also tatsächlich geträumt. Krampfhaft versucht Priska, ihre Lungen so schnell wie möglich wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Die Atemnot und das völlig aus dem Takt geratene Herz lassen ihre Brust fast bersten. Als sie wieder Luft bekommt, hangelt sie sofort nach dem Schalter ihrer Nachttischlampe. Die grässlichen Augen, die sie noch immer aus der Dunkelheit heraus zu verfolgen scheinen, verblassen im hellen Schein der beinahe grellen LED-Glühbirne. Priska spürt, wie ihr Schlafanzugoberteil klamm an ihrem Rücken und auf ihrer Brust klebt. Fröstelnd zieht sie sich die Bettdecke bis ans Kinn. In ihr toben widersprüchliche Gefühle. Die Angst vor der schwarzen Frau wird überlagert von der intensiven, alles verzehrenden Glut ihrer ersten Liebe. Sie flackert noch etwas nach und verebbt schließlich zu einem sanften Glimmen, während sich die letzten Schwaden der Traumnebel auflösen. Was bleibt, ist eine qualvolle Sehnsucht. Sie schluckt schwer. Es ist lange her, dass sie von Ranieri geträumt hat. Ein schmerzhafter Stich durchfährt ihr Herz, das noch immer nicht in seinen normalen Rhythmus zurückgefunden hat.
Auch die schwarz gekleidete, verhärmte Frau, welche sie tatsächlich nur von der gespenstischen Schwarz-Weiss-Aufnahme im alten Haus kennt, ist ihr schon viele Jahre nicht mehr in ihren Träumen begegnet. Jenes Foto hatte sich allerdings derart in ihr Hirn gefressen, dass sie seitdem keine Porträtaufnahmen aus dem 19. Jahrhundert betrachten kann, ohne in Angstzustände zu verfallen. Bereits als kleines Mädchen war ihr unheimlich zumute, wenn Personen auf den Gemälden der alten Meister sie mit ihren Augen verfolgten. Sie positionierte sich in jeden nur erdenklichen Winkel zu den Bildern und dennoch: Diese Gesichter starrten sie an, egal, wo sie stand. Ein bekanntes Phänomen, das sie noch immer verstört. Im Vergleich zu der Fotografie im alten Haus sind die Augen auf den Kunstwerken in den Pinakotheken jedoch leere, tote Glasmurmeln. Priska merkt, wie sich das Bild der schwarzen Frau von Minute zu Minute unauslöschbarer in ihrem Kopf manifestiert. Nein, diese, sie in ihren Grundfesten erschütternden Ängste würde sie nicht mehr mit sich spazieren tragen. Nie mehr.
Verzweifelt und zugleich verbissen versucht sie, an etwas anderes zu denken.
Sie wirft einen Blick auf ihren Wecker. Es ist zwei Uhr. Noch ausreichend Zeit, um eine halbe Schlaftablette einzunehmen, die ihr helfen würde, den morgigen Tag zu überleben, ohne gleichzeitig gegen den bleischweren Überhang ankämpfen zu müssen, den diese sogenannten Z-Drugs gerne hervorrufen. Priska schlägt die warme Decke zur Seite und stemmt sich aus dem Bett. Bevor sie sich auf den Weg nach unten zum Arzneimittelschrank macht, schleicht sie so leise wie möglich zum Elternschlafzimmer hinüber. Der Anblick des friedlich schnarchenden Luis und ihrer Tochter, die sich eng an des Vaters Rücken gekuschelt hat, normalisiert ihren Puls endlich.
Unten angekommen, teilt sie eine der kleinen, weißen Tabletten und spült sie mit einem großen Schluck Sprudel hinunter. Um den Rest des Glases zu leeren, braucht sie etwas länger. Wasser mit Gas, wie die Südtiroler sagen, kann sie nie auf Ex trinken. Beinahe versonnen betrachtet sie die zischenden Kohlensäurebläschen, wie sie an die Oberfläche treiben, sich vereinigen, wieder voneinander lösen und schließlich zerplatzen. »Alles wird gut,« beschwichtigt sie sich und ihre Gedanken, die sich ungeachtet ihrer Bemühungen nicht bändigen lassen.
Es fühlt sich an wie eine Bestätigung, als ihr in diesem Moment jemand sanft über den Kopf streicht. Nur ein Hauch von einer Berührung, aber sie ist echt. Priska dreht sich reflexartig um, obwohl sie weiß, dass es unnötig ist. Denn hinter ihr steht niemand. Die unsichtbare Geisterhand ist längst verschwunden.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
purpur
Klammeraffe

Beiträge: 964
|
  18.05.2016 01:30 18.05.2016 01:30
von purpur
|
 |
|
Hallo  liebe Federfarbenfee, liebe Federfarbenfee,
Herzlichen Dank, ich habe mich sehr gefreut wieder von Dir zu hören  ! !
Gerade hab ich Deinen Text komplett:lol: verschlungen,
konnte gar nicht aufhören zu lesen. So spannend war's.
Nun ist's aber schon so spät, zu spät, für eine
ausgiebigere Schilderung meiner Eindrücke, so dass ich Dir,
vorerst, nur ein kurzes  hier war ich hier war ich 
sende - ausgeschlafen ist doch besser:-)

Eine Gute Nacht
wünscht Dir
PurpurPia
_________________
.fallen,aufstehen.
TagfürTag
FarbTöneWort
sammeln
nolimetangere
© auf alle Werke |
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  19.05.2016 23:28 19.05.2016 23:28
von Federfarbenfee
|
 |
|
Es folgen nun noch die Kapitel 4,5 und 6.
Damit ist die Lücke zum 7. Kapitel, das ich als ersten Text hier einstellte, geschlossen. 
--------
Kapitel 4: Zeichen
»Heute Nacht hat er mich nicht besucht.« Elena stellt diesen Satz betont beiläufig in den Raum, während sie naserümpfend und scheinbar hochkonzentriert die Rosinen aus der bis zum Rand gefüllten Müslischale klaubt. Sie kann jedoch die in ihrer Stimme unterschwellig mitschwingende Enttäuschung nicht verbergen. Priska überlegt, ob sie diese Situation als so surreal empfindet, weil ihre graue Zellen noch in der flaumigen Zuckerwatte festkleben, mit der sie die Schlaftablette vor einigen Stunden fürsorglich umhüllt hat. Oder liegt es daran, dass ihre Tochter beim Frühstück im Plauderton von einer Geistererscheinung erzählt, als handle es sich hierbei um einen neuen Kindergartenfreund? Während Elena unter dem Tisch die buntbestrumpften Beine schlenkern lässt, schützt sie ihre Augen mit einer Hand vor dem gleißenden Sonnenlicht, das kraftvoll und ungebremst die gegenüberliegende Fensterfront durchdringt. Im Gegensatz zu Priska selbst wirkt das Kind alles andere als ängstlich. Fakt ist, dass es sich bei dem unheimlichen Besucher ganz offensichtlich um keine Eintagsfliege handelt und dass Priska noch etwas Anlaufzeit benötigt, bevor sie sich imstande sieht, adäquat auf ihre Tochter einzugehen. Zumindest, was dieses Thema anbelangt. Da Elena den geheimnisvollen Gast gestern mit keiner Silbe mehr erwähnt hatte, wollten Priska und Luis zunächst versuchen, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Ein Fehler, wie sich nun herausstellt.
»Du glaubst mir doch, Mama, oder?« Priska räuspert sich unentschlossen. Wie Luis Antwort ausfiele, weiß sie. Er hat nicht viel übrig für übersinnliche Phänomene. Sie überlegt, aber die Watte in ihrem Schädel drückt jeden vernünftigen Denkansatz mit sanfter Gewalt in die hinterletzten Winkel ihrer lahmgelegten Gehirnwindungen. Schließlich entscheidet sie sich für die Wahrheit – für das, was ihr Bauchgefühl dem Verstand schon länger eindringlich zu vermitteln versucht. »Ja, ich glaube Dir, mein Schatz.« In Gedanken macht Luis sie gerade genüsslich einen Kopf kürzer. Elena hat derweilen alle Rosinen eliminiert und spielt nun Schiffeversenken mit den Cornflakes.
»Hat der Mann Dir gesagt, wer er ist? Kennst Du seinen Namen?« Elena schüttelt den Kopf. Eine vorwitzige Haarsträhne löst sich aus ihrem Pferdeschwanz und legt sich über ihre violetten Augen. Das Kind streicht sie mit einer routinierten Geste hinter ihr rechtes Ohr, bevor sie antwortet. Ihre Worte wählt sie mit Bedacht: »Nein, ich weiß nicht, wie er heißt. Aber er kennt Dich. Und er will wirklich ganz dringend mit Dir reden.« »Was hindert ihn daran?« Elena sieht sie verständnislos an. Priska formuliert ihren Satz anders: »Warum kommt er dann zu Dir? Wenn er doch mit mir sprechen möchte?« Elena seufzt ein wenig ungeduldig. Sie blickt ihrer Mutter nun direkt in die Augen. »Er ist am Anfang immer zu Dir gegangen. Aber Du hast es nicht einmal gemerkt. Erinnerst Du Dich an vorletzte Nacht? Als er bei mir im Zimmer war? Du hast ihn nicht gesehen. Und hören kannst Du ihn auch nicht. « Priska fühlt sich seltsam hilflos. »Was soll ich denn tun?« Es erscheint ihr etwas unangemessen, dass sie ihrer kleinen Tochter eine solche Frage stellen muss, aber andernfalls drehen sie sich beide so lange weiter im Kreis, bis es ihnen der Schwindel unmöglich macht, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen.
»Du musst mit den Schlaftabletten aufhören!« Elenas Stimme klingt ungewohnt erwachsen. Priska zuckt zusammen. Mit solch einem Ratschlag hat sie nun wirklich nicht gerechnet. Stammt diese Empfehlung aus dem Mund des Geistermannes oder entspringt sie eher Elenas Kinderlogik, die bisweilen seltsame Blüten treibt? Ist die Vierjährige gar schon in der Lage, die Tragweite ihres Medikamentenkonsums zu ermessen? Bitte nicht! Priska schickt ein stummes Stoßgebet Richtung Firmament. Sie ist noch dabei, den Ausgang ihres verworrenen Gedankengeflechts zu finden und sich wieder auf die Unterhaltung zu fokussieren, da fährt Elena bereits fort: »Er sagt, dass Du mit den Tabletten nicht richtig träumst. Er kann aber nur in echten Träumen mit Dir reden.« Priska ist bekannt, dass einige Mittel die Schlafarchitektur empfindlich beeinflussen und insbesondere den für die Träume notwendigen REM-Schlaf unterdrücken können. Die von ihr präferierten Wirkstoffe sollen diese Eigenschaft aber gerade nicht aufweisen. Sie muss sich jedoch eingestehen, dass der in seiner Zusammensetzung variable Medikamentencocktail, den sie sich seit einigen Jahren regelmäßig einverleibt, so einige Ingredienzien enthält, die ihrem Schlaf, beziehungsweise dem, was davon übrig ist, über die Zeit hinweg irreversibel geschadet haben könnten. Tatsächlich erinnert sie sich nur mehr vage daran, wie sich Schlafen ohne Hilfsmittel anfühlt. »Das wird dann aber schwierig. Schließlich kann ich nicht träumen, wenn ich nicht schlafe,« gibt sie zu bedenken. Und das Tagträumen habe ich inzwischen verlernt, fügt sie im Geiste wehmütig hinzu. Zugleich fragt sie sich, wo dieses Gespräch wohl enden wird und es ist ihr ganz und gar nicht wohl dabei, das Kind mit ihren Schlaf- und Kommunikationsproblemen mit Spukgestalten zu belasten. »Meine Süße, zerbrich Dir bitte nicht den Kopf wegen Deiner alten Mama. Und dem – ähm – Besucher sagst Du einfach, er soll Dir nicht mehr auf den Wecker gehen.« Gerade noch rechtzeitig entsinnt sie sich, dass ihre Tochter nie von einem Geist gesprochen hat.
Sie steht auf und küsst Elena zärtlich auf den seidenweichen, nach Pfirsichschampoo duftenden Haarschopf. »Warum nimmst Du mich nicht ernst, Mama!« entgegnet das Kind entrüstet. »Aber das tu ich doch, meine Elena! Ich will nur nicht, dass Du Dir wegen mir Sorgen machst. Es ist meine Aufgabe, auf Dich aufzupassen und nicht umgekehrt.« Doch Elena lässt nicht locker. »Bitte Mama, versprich mir, dass Du es versuchst! Der Mann sagt, dass Träume gut sind. Und dass sie Dich beschützen. Es wird sonst sehr gefährlich für Dich. Das soll ich Dir ausrichten.« Nun regt sich in Priska der Groll. Wie kann sich jener ungebetene Gast nur erdreisten, ihre Tochter mit solch bedrohlichen Szenarien zu konfrontieren? Ist es ihm gleichgültig, was dieses Gefasel von Gefahr mit einer unbedarften Kinderseele anrichten kann? Die aufkeimende Wut vergegenwärtigt ihr aber auch deutlich, dass sie inzwischen tatsächlich von der Existenz des Geistermannes überzeugt ist.
Elena ist fertig damit, ihr Müsli in etwas zu verwandeln, das der Molekulargastronomie alle Ehre zu machen in der Lage ist. Sie rutscht vom Stuhl und direkt in die Arme ihrer Mutter. Priska zieht die Kleine fest an ihre Brust und flüstert ihr ins Ohr: »Ja, ich verspreche es. Und Du versprichst mir, dass Du jetzt an etwas Schönes denkst.« Elena runzelt die Stirn. Priska müsste es eigentlich besser wissen. Krampfhafte Ablenkungsversuche misslingen immer. «Nein, pass auf. Du darfst Dir auf keinen Fall einen bunten Elefanten mit rosa Ohren und grün lackierten Fußnägeln vorstellen.« Elena muss unwillkürlich laut auflachen. »Wieso nicht? Ich kann ihn schon sehen.« Priska schaut besorgt drein. »Ohje, der trampelt Dir nun den ganzen Tag im Kopf herum. Und bringt bestimmt noch seine riesengroße Familie mit.« »Das macht nichts,« kräht Elena vergnügt. »Ich werde Dir im Kindergarten ein Bild von dem Elefanten malen. Und von seinen Kindern. Das schenke ich Dir dann.« »Ui, da freue ich mich schon,« erwidert Priska erleichtert. Sie ist sich durchaus bewusst, dass im Laufe des Tages der farbenfrohe Elefant nebst Herde verblassen und der ominöse, unsichtbare Geselle wieder seinen Platz einnehmen wird. Doch sie hofft, zumindest ein paar unbeschwerte Stunden für Elena herausgeschlagen zu haben.
Wie immer, wenn Elena im Kindergarten ist, wirkt das Haus seltsam leer und unbelebt. Mit der Milchtüte in der einen und der Kaffeetasse in der anderen Hand balanciert Priska durch den Hindernisparcours an Spielsachen, die den Weg vom Wohnzimmer in die Küche säumen. Sie hat es längst aufgegeben, diverse Stofftiere, Bausteine, Figuren, Bälle, Puzzleteile und Autos jedes Mal unverzüglich in den zugehörigen Körben und Kisten zu verstauen. Das ist vergebene Liebesmüh. Die wenige Zeit, die ihr bleibt, sollte sie eigentlich für ihre Arbeit nutzen. Nur noch ein mickriger Monat, dann müssen die Illustrationen für das zauberhafte Märchenbuch, dessen Manuskript verwaist und mahnend auf ihrem Schreibtisch liegt, fertiggestellt sein. Ein Auftrag, um den sie gekämpft hatte wie eine Löwin um ihr Baby. Und nun fehlt Priska jegliche Inspiration. Diese Geschichte ist so gut und herzlich. Das Böse zeigt sich nur selten, ist zu keinem Zeitpunkt übermächtig und wird zum Ende hin mit Leichtigkeit besiegt. In Priskas Kopf dagegen hält eine bedrückende Düsternis das Zepter fest umklammert. Die Schlaflosigkeit und die nächtlichen Panikattacken lassen auch die Tage zu einem steten Kampf gegen die bleierne Müdigkeit, Kraft- und Hoffnungslosigkeit werden. Wären Elena und Luis nicht, Priska wüsste nicht, ob sie diese Schlacht nicht bereits längst verloren hätte. Sie gibt sich redlich Mühe, ihre depressiven Verstimmungen vor ihrer Tochter zu verbergen. Es ist nicht rechtens, das Kind mit diesem grauen Schleier in Berührung zu bringen, der sich erbarmungslos und penetrant über sämtliche Farben im einst so bunten Malkasten ihres Lebens legt.
Als sie an dem großen Spiegel im Gang vorbeikommt, hebt sie versehentlich den Blick und sieht sich selbst in die Augen, deren Violettfärbung im Vergleich zu den leuchtenden Sternen ihrer Tochter abgestumpft erscheint. Ihr Gesicht ist blass und schmal. Von sich mehrenden silbernen Haarsträhnen durchzogene, schwarze Locken umrahmen das ehemals betörend strahlende, inzwischen jedoch fast erloschene Antlitz. » Was ist nur aus Dir geworden, Priska?« Sie kramt in den Hosentaschen ihrer Jeans nach einem zerfledderten Haargummi und zwingt den wilden Haarschopf in einen biederen Dutt. »Wenn ich mich schon wie eine Oma fühle, kann ich auch wie eine aussehen.« Die Mundwinkel ihres Spiegelbildes zucken und verziehen sich zu einem sarkastischen Lächeln.
Ein leichter Luftzug wandert an ihrem Rücken vorbei und bringt das Windspiel an der Eingangstüre sanft zum Klingen. Mit einem Mal fühlt sich Priska gar nicht mehr so allein. Es ist ihr unbehaglich zumute, wie sie da vor dem Spiegel steht. Die tanzenden und singenden Stäbe des Windspiels und den rustikalen, überdimensionalen Bauernschrank, in dem sie ihre Jacken und Mäntel aufbewahren, hinter sich wissend. Jetzt fehlte es nur noch, dass aus dem Schatten dieses monströsen Möbelstücks plötzlich der Gespenstermann hervortritt, denkt sie. War es wirklich so eine gute Idee gewesen, Elenas Glauben an den Geist zu nähren? Und wie soll sie selbst nun mit der irren Vorstellung umgehen, dass dieser ominöse Geselle tatsächlich existiert? Nach drei Nächten ohne Schlaftabletten wird sie die Spukgestalt mit Sicherheit sehen können. Dafür würden ihre überdrehten, ins Paranoide abdriftenden Gedanken schon sorgen. Bitter lacht sie auf. Die Liebe zu ihrem Kind und ihr sehnlicher Wunsch, Elena nicht allein zu lassen mit dieser gespenstischen Parallelwelt, haben sie dazu gebracht, sich dieses wahnwitzige Versprechen abringen zu lassen. »Keine Schlaftabletten mehr. Du lieber Gott. Ich bin noch verrückter, als ich dachte.«
Als sie mit einer frischen Tasse Kaffee von der Küche ins Arbeitszimmer schlurft, sieht sie unter einer, achtlos auf die oberste Stufe der Kellertreppe geworfenen Kuscheldecke, ein Ohr von Professor Schrumpel hervorspitzen. Elena und sie haben den heiß geliebten Teddybären schon für endgültig verschollen gehalten. Priska eilt zum Teppenabgang, um den treuen Gefährten zu befreien. Prompt tritt sie auf eine Hängebrücke aus dem Sortiment von Elenas Holzeisenbahn. Ein stechender Schmerz durchfährt ihren Fuß. Fast hätte sie sich den heißen Kaffee über die Hand gegossen. Fluchend beugt sie sich zu Professor Schrumpel hinunter und stellt den Keramikbecher neben sich auf den Boden. In dem Augenblick, als sie den Bären aus seiner Deckengruft zieht, hört sie hinter sich ein Schnaufen. Es klingt nach Luis, aber er kann es nicht sein. Mit einem Ruck fährt sie herum und stößt dabei doch noch die Kaffeetasse um. Die dunkle Brühe ergießt sich über den Fliesenboden und tropft die Stufen hinunter. Wie erwartet, steht niemand hinter ihr. Aber das Atemgeräusch war echt. Viel zu laut und eindeutig, um es einer überschäumenden Einbildungskraft in die Schuhe schieben zu können. Priska hält verwirrt inne. Ist ein Gespenst – als ätherisches, immaterielles Wesen – wirklich in der Lage, zu keuchen wie ein aus der Übung gekommener Langstreckenläufer? Sie weiß nicht, ob sie sich ängstigen oder amüsieren soll. Da ertönt das angestrengte Schnaufen erneut. Diesmal direkt an ihrem Ohr. Priskas Anflug von Heiterkeit ist dahin. Das Blut rauscht in ihren Ohren und ihr Herz klopft bis zum Hals. Sie wagt es nicht einmal, den Kopf zu drehen. Jemand atmet schwer. Nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Und doch kann sie ihn nicht sehen. Sie fühlt sich wie in einem Alptraum. Die Knopfaugen des Teddys starren sie wissend an. Das eine braun, das andere blau. Nach einem Unfall in der Waschmaschine musste Priska improvisieren.
Lautes Klopfen an der Haustüre zerreißt das mit unsichtbaren Fäden gewebte Netz, welches sich in den vergangenen Minuten – oder waren es nur Sekunden – über Priska gelegt und sie aus ihrer vertrauten Welt gezogen hat. Von einem Moment auf den nächsten ist auch das Schnaufen verstummt. Der Paketbote mustert sie neugierig, während sie ihm den Erhalt der neuen Zeichenutensilien schriftlich bestätigt. »Haben Sie gerade einen Geist gesehen? Sie wirken so verstört?« Wenn der gute Mann wüsste, wie nah er mit seiner leichthin geäußerten Redewendung an der Wahrheit entlangschrammt. »Nein, mir geht`s gut,« murmelt Priska und ergänzt in Gedanken: »Gesehen habe ich ihn nicht, nur gehört, aber das reicht mir schon.«
Sie trägt das leichte, aber etwas sperrige Paket ins Arbeitszimmer und macht sich direkt daran, es zu öffnen. Auf der Suche nach der spitzen Schere, mit welcher sie üblicherweise das hartnäckige Klebeband durchtrennt, bleibt ihr Blick an der Terrassentür hängen. Jemand hat mit den Fingern ein filigranes Herz auf die beschlagene Scheibe gemalt. Elena kann es nicht gewesen sein. Die Zeichnung befindet sich zu weit oben. Hätte sich nicht eben jender gespenstische Vorfall ereignet, dann würde Priska sofort an Luis denken. Solche kleinen, liebevollen Gesten passen durchaus zu seiner Vorstellung von Romantik. Doch hätte er wohl eher die Duschwand oder den Badezimmerspiegel als Malgrund gewählt. Wenn das Herz vom Geistermann stammt, dann hat er einen seltsamen Sinn für Humor. In ihr regt sich eine leise Ahnung. «Nein, das kann nicht sein« verwirft sie den Gedanken sofort, ehe er sich weiter ausformen und wahrhaft Gestalt annehmen kann.
Endlich hat Priska die Schere gefunden. Sie befreit den Kasten mit den 120 Buntstiften aus seinem Gefängnis und auch diesmal verfehlt die nach dem Vorbild des Regenbogens sortierte Farbenpracht ihre Wirkung nicht. Es ist, als läge Magie in der Luft. Die Stifte sind ein lebensbejahendes und noch immer verheissungsvolles Sinnbild all dessen, was möglich ist, sich aber noch entfalten will und muss. Priska spürt das altbekannte Kribbeln in Kopf und Fingerspitzen. »Märchenbuch, das Warten ist vorbei!« Sie streicht über das nüchtern anmutende Manuskript, welches die ihm innewohnenden, fantastischen Schöpfungen erst demjenigen offenbart, der es aufschlägt und mit seinen Augen, Gedanken und Emotionen die Worte zum Leben erweckt.
Priska ist selbst kein Freund der digitalen Zeichenkunst, obgleich sie die entsprechenden Arbeiten ihrer Kollegen schätzt. Sie bevorzugt die altmodische Variante und fertigt ihre Illustrationen mit Pinsel und Farbstiften. Zarte Aquarelle und detailverliebte Buntstiftzeichnungen sind ihr Markenzeichen. Wie wäre es als Aufwärmübung mit dem lustigen Elefanten, den sie Elena in den Kopf gepflanzt hat? Sie nimmt einen rosafarbenen Buntstift zur Hand. Im selben Moment erinnert sie sich daran, dass sie das Kaffeemalheur an der Kellertreppe noch nicht beseitigt hat. Schnell legt sie den Stift beiseite. Doch sie hat ihn zu nah an der Kante platziert. Er fällt vom Schreibtisch hinunter und rollt unter das Canapé, welches an der gegenüberliegenden Zimmerwand zu einem Nickerchen einlädt. Ein verlockendes Angebot, das Priska bisher jedoch ausgeschlagen hat. Es gelingt ihr so gut wie nie, tagsüber zu schlafen, sei die Müdigkeit auch noch so groß. Als sie vor dem kleinen Sofa widerstrebend in die Knie geht, ereignet sich vor ihrem inneren Auge der Klassiker aller Horrorszenarien: Eine hagere Leichenhand an einem dürren, langen Arm schießt aus dem undurchdringlichen Dunkel unter der Liege hervor und umklammert ihren Fußknöchel wie ein Schraubstock. Glühende Augen, aus denen ihr das Böse förmlich entgegenspringt, beobachten sie lauernd. Priska schüttelt diese klischeehaften und dennoch beängstigenden Gedankenbilder brüsk ab. Es war klar, dass ihr über kurz oder lang die Sicherungen durchbrennen. Abermals schlägt ihr Herz Kapriolen, als sie endlich unter das Canapé lugt. Mit zitternden Fingern tastet sie nach dem verschwundenen Zeichengerät und rechnet fest damit, dass gleich die bleiche Klaue nach ihr greift. Sie ist tatsächlich erleichtert, als ihr statt dessen der Stift entgegenkullert. Wer ihm den nötigen Schubs verpasst hat, interessiert sie nicht.
Nachdem sie eine halbe Küchenpapierrolle geopfert hat, um sämtliche Kaffespuren von Boden und Treppenstufen zu tilgen, setzt sie sich endlich an den Schreibtisch. Den rosafarbenen Stift hat sie wieder zu seinen ähnlich getönten Kumpanen im Metalletui verfrachtet. Ihr ist bewusst, das sie sich albern verhält, aber sie scheut sich nun, ausgerechnet damit zu zeichnen. Noch schwebt ein Hauch von Inspiration in diesem Raum. Priska versucht, sich in die Märchengeschichte hineinzudenken, ehe die Muse endgültig beleidigt abrauscht. Sie lässt sich in das sonnige Reich der Feen und Elfen entführen, zeichnet Blumen- , Baum- und Waldelfen und muss dabei an ihren Traum von vorletzter Nacht denken, der ebenso beschwingt und fröhlich begonnen hat. Sie verliert beim Zeichnen jegliches Zeitgefühl und die Freude, die sie dabei empfindet, all diese heiteren Wesen auf ihren Skizzenblock zu bannen, besänftigt ihr aufgewühltes Gemüt. Fast fühlt sie sich ausgeglichen. Ein Zustand, der Priska nur selten vergönnt ist.
Schließlich muss sie jedoch innehalten, um die verkrampften Finger zu lockern. Langsam strömt das Blut in ihre rechte Hand zurück. Priska betrachtet indess ihre letzte Zeichnung. Eine blonde Fee mit transparenten, irisierenden Flügeln blickt sie freundlich und ein wenig nachdenklich an. Blaue, von kindlicher Naivität geprägte Kulleraugen sollten es werden. Blau sind sie tatsächlich. Nicht so hell wie ein mit Schäfchenwolken besiedelter Himmel an einem Sommertag, aber auch nicht ganz so dunkel wie eine sternenlose Nacht. Es sind schöne Augen, jedoch bar jeglicher unverfangener Leichtigkeit. Statt dessen spiegelt sich eine Weisheit in ihnen, die Priska nicht einmal im Ansatz erahnen kann. »Jetzt werde nur nicht wieder melodramatisch«, ermahnt sie sich. An dem Gewand muss sie noch etwas feilen. Das grüne, bauschige Kleid wirkt zu viktorianisch für eine Fee. Es muss etwas luftiger werden. Zuvor jedoch versieht Priska die bemerkenswerten Augen, von denen sie gar nicht glauben kann, dass sie diese selbst gezeichnet hat, mit einzelnen, goldenen Sprenkeln. Das Setzen der kleinen, leuchtenden Punkte hat etwas Meditatives an sich. Hin und wieder entweicht Priska ein herzhaftes Gähnen. Ihre Lider werden schwer und irgendwann verschwimmt das Antlitz der Fee vor ihren Augen.
Vielleicht sollte sie die Gelegenheit wirklich nutzen und versuchen, ein wenig zu schlafen. Um 14.00Uhr wird sie Elena aus dem Kindergarten abholen. Bis dahin sind es noch anderthalb Stunden. Sie schlurft zum Canapé hinüber und sinkt in die weichen Polster. Ihre Füße schwingt sie hurtig über den Rand. Noch ist es ihr nicht gelungen, die gruselige Kreatur aus ihrer Vorstellung zu löschen. Während sie darauf wartet, dass sich ein Schlaffenster öffnet, lässt sie den heutigen Vormittag Revue passieren. Sie kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass die vergangenen Stunden einen tiefen Krater in das Konstrukt gesprengt haben, das Priska bisher für ihr Leben gehalten hat. Doch ist diese Vorstellung nicht bedrohlich genug, um sie wach zu halten. »Wenn ich jetzt einschlafe, grenzt das an ein Wunder«, denkt sie noch. Dann ist sie in den Schlaf hinübergeglitten.
Elena liegt in ihrem Bett. Wie immer hat sie sich in der für sie typischen Embryonenhaltung eingekuschelt. Ihr Gesichtszüge sind weich und entspannt. Offensichtlich befindet sie sich im Tiefschlaf. Sie atmet so flach, dass Priska es nicht hören kann. Sie steht still an der Türschwelle und genießt dieses Bild des Friedens. Im Hintergrund erklingt leise die Gute-Nacht-Musik. Um sich herum hat Elena den geliebten Professor Schrumpel und noch eine ganze Schar weiterer Kuscheltiere drapiert, die Priska nicht im Einzelnen ausmachen kann. Dazu ist es zu schummrig. Das dort muss die Puppe Lotta sein mit ihren geflochtenen Zöpfen und etwas weiter unten scheint es sich Elenas Plüschhase bequem gemacht zu haben. Doch zu welchem Kuscheltier gehört dieser lange Schatten direkt neben ihrer Tochter? Priska überlegt noch, ob es sich dabei um das Stillkissen handeln könnte, ein Relikt aus Elenas Babyzeit, als sich der Schatten langsam erhebt. Priska stockt der Atem. Was ist das? Aus dem unförmigen Schemen wird ein Mädchenkörper. Das Kind scheint in Elenas Alter zu sein. Doch wirkt es seltsam durchscheinend und ohne klare Kontur. Allein ihr kurzes Kleid und die Schleife in ihrem Haar heben sich deutlich von der wabernden Gestalt ab. Sowohl Gewand als auch Haarschmuck sind von einem leuchtenden Rot, das sich weigert, von der Dunkelheit verschluckt zu werden. Priska muss unwillkürlich an den aus den Siebzigern stammenden Film »Wenn die Gondeln Trauer tragen« denken und ihr schaudert.
In ihr schreit alles danach, ihre Tochter aus dem Dunstkreis dieses Wesens herauszulösen und sie macht ein paar rasche Schritte auf das Geistermädchen zu, welches nun seinerseits den Kopf in ihre Richtung wendet. Priska wird flau im Magen und die mittlerweile vertraute Kälte ergreift erneut Besitz von ihr. Sie kann dem Kind nicht in die Augen sehen. Zu groß ist die Angst, dass sie sich dann nicht mehr von der Stelle würde rühren können. Obwohl sie davon ausgeht, dass das Antlitz dieses Wesens wahrscheinlich eher einem gesichtslosen Fleck denn einer grauenvollen Fratze gleichkommt. Sie hat Elena fast erreicht. In dem Moment ergreift das Mädchen mit dem roten Kleid plötzlich die Flucht. Was hat sie da in ihrer Hand? Das muss eine ebenfalls in roten Stoff gehüllte Puppe sein.
Das Gespensterkind bewegt sich zur Balkontüre hin. Erst jetzt wird sich Priska der dunklen Männergestalt gewahr, die dort wartet. Mit einer fließenden Bewegung zieht sie die noch schlafende Elena in ihre zitternden Arme. Ihr Blick ist jedoch nach wie vor auf die beiden nebulösen Geschöpfe gerichtet. Der Schemen an der Balkontüre tritt nun etwas hervor. Fast wirkt es so, als lege er es absichtlich darauf an, dass das schwache Licht aus dem Flur ihn erfasst. Priskas Herz vergisst für einen Moment zu schlagen. Ihre Ahnung war richtig. Es ist Ranieri, in dessen Arme sich das Geistermädchen flüchtet.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  19.05.2016 23:30 19.05.2016 23:30
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 5: Im Anfang das Ende
»Seit wann weißt Du es?«
Ihre Stimme bebte und sie spürte, wie der Schmerz ihr Herz bereits flutete und jeden noch so kleinen Hoffnungsschimmer augenblicklich ertränkte.
Er wirkte unversehrt. Nichts an Ranieris attraktiver Erscheinung deutete auf das Monster hin, das sich durch seinen Kopf fraß. Doch die Hand, mit der er sich zerstreut über das dichte Blondhaar strich, zitterte.
»Die Diagnose steht seit einer Woche.«
Beinahe zwanzig Jahre ist jenes Gespräch nun her. Und doch hat Priska das Gefühl, es habe erst gestern stattgefunden. Sie kann sich an jedes einzelne Wort erinnern.
Es war ein sonniger Maientag, der sich mit verheißungsvollen Frühlingsdüften und dem bunten, pulsierenden Leben selbst tarnte, dabei jedoch in Wirklichkeit den Tod mit sich trug. Das Grauen erscheint noch unerträglicher, wenn es in schöner Gestalt daherkommt. Am Himmel tummelten sich luftige Wattewolken, die Bienen summten, die Kinder machten Hüpfspiele auf dem warmen Asphalt, die Amseln sangen ihre fröhlichsten Melodien, die kleinen Schaumkronen auf dem Eisack glitzerten.
Und Ranieri würde sterben.
»Sie nennen es Schmetterlingsgliom. Ein solch schöner Name für etwas derart Furchtbares. Kannst Du Dir das vorstellen?« Ranieris Kehle entwich ein gequältes Lachen. Seine Augen folgten den Zitronenfaltern und Pfauenaugen, die ringsum von Blüte zu Blüte tanzten und sich am Nektar labten. Priska sehnte sich danach, ihn zu umarmen und ihre Liebe wie einen Schleier über ihn zu werfen, damit er vor dem Tod verborgen bleiben möge. Doch Ranieris steife Körperhaltung ließ sie davon Abstand nehmen. Stattdessen berührte sie sacht die Finger seiner linken Hand, die sich in den Fugen des aus losen Steinen errichteten Mauerwerks verkrallt hatten, auf dem sie saßen. Seine Haut war warm.
Priska schluckte die Tränen hinunter, die mit aller Macht in ihre Augen drängten. All die Jahre hatte sie gehofft, dass sie eines Tages zusammenfänden. Nun, da es endlich so gekommen war, hatte sie für ein paar kostbare Wochen geglaubt, dass dies erst der Anfang vom Glück wäre. Tatsächlich aber war es das Ende. Sie verurteilte sich für ihre egoistischen Gefühlsregungen, doch der Gedanke, ihn zu verlieren, nahm ihr die Luft zum Atmen.
»Können die Ärzte denn gar nichts machen?« Es wollte ihr einfach nicht in den Kopf, dass es keine Möglichkeit geben sollte, ihn zu retten. Sein Lebenslicht leuchtete noch viel zu kräftig und hell, als dass es sich so leicht ausblasen ließe.
Ranieris Miene wirkte undurchdringlich. Augenscheinlich beobachtete er noch immer das rege Treiben der Insekten auf der Wiese vor ihnen, doch der starre Blick verriet, dass die innere Linse andere, weit weniger ästhetische Bilder in den Fokus rückte. Auf seiner Stirn hatte sich wieder die vertraute Falte gebildet.
»Sie möchten operieren. Und anschließend werden sie mir Bestrahlungen und Chemotherapie verordnen. Aber das alles verschafft mir höchstens etwas mehr Zeit. Sie können den Tumor nicht vollständig entfernen.«
»Wie viel Zeit?« Priska konnte nur noch flüstern.
Ranieri hatte sie trotzdem gehört. »Insgesamt vielleicht ein Jahr. Eventuell auch ein paar Monate mehr. Aber solche Langzeit-Prognosen sind etwas für Optimisten.« Seine Stimme klang wie die eines Roboters. Die Ratio hatte die Kommandozentrale übernommen und die Emotionen schlafen geschickt.
Ein Jahr nur. Zwölf kurze Monate. Von denen er einige im Krankenhaus verbringen würde. Es tat jetzt schon so weh. Wie würde es sich erst anfühlen, wenn er nicht mehr da wäre? Und warum konnte sie nur an den Tod denken und nicht daran, dass er gerade neben ihr saß – an diesem sonnigen Frühlingstag. Sollten sie die verbleibende Zeit nicht in vollen Zügen genießen, statt sich zu fragen, was danach käme?
Als hätte Ranieri ihre Gedanken gelesen, sagte er nun: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich all diese Therapien mitmache. Sterben muss ich sowieso. Was bringt mir mehr Zeit, wenn ich sie nicht nutzen kann? Ich möchte nicht dahinsiechend auf den Tod warten. Außerdem hasse ich Krankenhäuser.«
Er ließ zu, dass Priska seine Hand sanft streichelte und endlich löste er seine verkrampften Finger von der Mauer und umschlang die ihren. Priska bemerkte erst jetzt, dass sie noch ein Stück Schüttelbrot in der Linken hielt, die sie unbewusst zur Faust geballt hatte. Die harte Kruste stach in ihr Fleisch. Sie stopfte die Brotkante rasch zurück in den Rucksack. Nach Essen war ihr nicht mehr zumute. Fast schämte sie sich dafür, dass sie sich noch vor wenigen Minuten genüsslich und nichtsahnend einer solch profanen Tätigkeit hatte widmen können.
»Aber wenigstens hat es meinem Vater mal richtig die Sprache verschlagen.« Für einen kurzen Moment stahl sich der Schalk zurück in Ranieris blaue Augen. »Immer, wenn ich Kopfschmerzen hatte, beschimpfte er mich als Memme. Tja, jetzt weiß er, warum mir der Schädel weh tut. Und ich hab Ruhe vor ihm und seinem eigenem, ewigem Geseier. Den Hof werde ich nun sicher nicht mehr übernehmen.« Sein Blick wurde wieder trüb. «Und studieren auch nicht.«
Priska suchte krampfhaft nach passenden Worten. Doch es gab keine. »Helfen Dir Medikamente gegen die Kopfschmerzen?« Fragte sie lahm.
Ranieri musterte sie nachdenklich. »Ja, mal mehr, mal weniger. Aber es wird noch andere Symptome geben, je mehr die Krankheit fortschreitet. Halluzinationen zum Beispiel. Dann werde ich Dinge sehen, die nicht existieren und endlich nachfühlen können, wie es Dir geht.«
Priskas Hand zuckte reflexartig. Am liebsten hätte sie ihm für diesen Spruch eine saftige Ohrfeige verpasst. Hirntumor hin oder her. Stattdessen beugte sie sich zu ihm hinüber und küsste ihn. Seine Lippen, die eben noch von einem spitzbübischen Lächeln umspielt wurden, waren weich. Er grub seine Finger in ihre Locken und erwiderte die sanfte Liebkosung. Es war kein stürmischer, dafür ein überaus zärtlicher Kuss. Für einen Moment verharrten sie dicht an dicht. »Willkommen in meiner Welt«, wisperte sie ihm ins Ohr, als sich ihre Münder schließlich voneinander lösten.
Versonnen strich Ranieri mit seinen Fingerkuppen über ihre Wangen. »Ich wollte mich der Bergrettung anschließen«, informierte er sie.
»Wie bist Du denn auf die Idee gekommen?« Priska war ein wenig verblüfft angesichts dieses abrupten Themenwechsels.
»Sie suchen immer händeringend nach Leuten und guten Kletterern.« Er machte eine kurze Pause und wickelte sich eine ihrer Haarsträhnen um den Zeigefinger.
»Aber sie erklärten mir, dass die Ausbildung mindestens zwei Jahre dauert. Doppelt so lange, wie ich voraussichtlich noch leben werde.« Er lachte bitter auf. »Außerdem ist es fraglich, ob sie mich mit meinem … Handicap …überhaupt aufgenommen hätten. Doch es wäre eine Möglichkeit gewesen, die Zeit, die mir noch bleibt, sinnvoll zu nutzen. Und mich hätten sie gerne zu den riskantesten Einsätzen beordern dürfen. Wäre ich dabei drauf gegangen, hätte ich nicht auf den Tod warten müssen. Das ist nämlich ein echt ätzendes Gefühl und es wird noch schlimmer werden. Oft denke ich, es wäre besser, ich würde gleich abkratzen. Dann hätte ich es wenigstens hinter mir.«
Ranieris lapidar und nüchtern dahingesagte Worte glichen dumpfen Hieben direkt in Priskas Magengrube. Wie konnte er nur so denken und sich bereit erklären, sein Leben einfach so wegzuwerfen? War es ihm völlig egal, dass er sie zurücklassen würde? Da war er wieder. Ihr vermaledeiter Egoismus. Dennoch musste sie sich zum wiederholten Male fragen, warum sie ihn – und – ob er sie überhaupt liebte.
Andererseits war er es, der am Abgrund stand und dem Tod ins Auge sah. Konnte sie auch nur den Hauch einer Ahnung haben, wie sie sich an seiner Stelle fühlen würde?
Trotz seiner Liebkosungen schien es ihr gerade so, als würde sie neben einem Eisklotz sitzen. Es war daher nicht weiter verwunderlich, dass sie just in diesem Moment von einem Schüttelfrost ergriffen wurde. Zitternd schlug sie sich die Hände vors Gesicht.
»Ach, Priska, es tut mir leid.« Ranieri seufzte bedauernd. »Aber Du bist siebzehn. Und gesund. Du hast noch Dein ganzes Leben vor Dir. Irgendwann wirst Du Dein Glück mit einem Anderen finden.« Diese abgedroschenen Worte stimmten sie nicht versöhnlich. Im Gegenteil, sie entfachten ihre Wut. Ranieri klang plötzlich wie ein alter Mann. Und sein abgeklärter Tonfall bar jeglicher Emotion.
Hastig stand sie auf. »Gib mir Bescheid, wenn ich Dir helfen kann. Ich bin immer für Dich da, das weißt Du.« Hölzern antworte sie auf seine Phrasen mit ebensolchen Worthülsen. Was nicht bedeuten sollte, dass sie nicht meinte, was sie sagte. So gerne hätte sie noch ein »Ich liebe Dich« hinzugefügt, aber es kam ihr nicht über die Lippen.
Ranieri erhob sich gleichfalls. Seine Mundwinkel zuckten und Priska wusste nicht, ob er gleich lachen oder weinen würde. Er tat nichts von Beidem. Zögerlich trat er auf sie zu und zog sie in seine Arme. Für heute war alles gesagt. Zwar erschien es Priska falsch, dass der zu Tröstende selbst zum Tröster wurde, aber lieber schmiegte sie sich an ihn, als dass er weiterhin munter auf ihrer Seele herumtrampelte. Der Frieden währte jedoch noch kurz. Ranieri wirkte plötzlich angespannt und drehte seinen Kopf ruckartig nach rechts. »Was ist los«, erkundigte sich Priska alarmiert. »Es geht früher los, als ich dachte«, erwiderte er gepresst. »Ich werde verrückt.«
Priska fuhr herum. Ihre Augen folgten Ranieris Blick, aber sie konnte nichts Auffälliges entdecken. Die Frühlingsidylle schien ungetrübt. Fragend sah sie ihn an, doch er schüttelte nur leicht den Kopf. Hand in Hand machten sie sich an den kurzen Anstieg zum Gasser-Hof, auf dem Priska und ihre Eltern seit vielen Jahren jeden Urlaub und unzählige Wochenenden verbrachten. Für Priska war Südtirol eine zweite Heimat, der sie sich sogar enger verbunden fühlte als München, was natürlich nicht zuletzt an Ranieri lag. Würde sie jemals wieder einen Fuß in das Eisacktal setzen, wenn er nicht mehr wäre? Sie schluckte und umfasste Ranieris Hand ein wenig fester. Er drückte seinerseits sanft ihre Finger.
Auf halber Strecke passierten sie ein altes Mütterlein, das mit gesenktem Haupt am Wegesrand auf einer Rastbank saß und in der abgenutzten, schweren Schürze wühlte. Ranieri beschleunigte seine Schritte und sie hatte Mühe, mitzuhalten. Die Frau würdigte er keines Blickes. »Schau nicht zurück,« flüsterte eine beschwörende Stimme in ihrem Kopf. Und doch tat sie genau das. Wie ferngesteuert wandte sie sich um und ihr Blick heftete sie sich auf die Greisin, welche im selben Moment ihr unter einem weiten Tuch verborgenes Haupt hob. Doch statt in ein Gesicht blickte Priska in eine verschwommene graue Fratze, deren einzige Fixpunkte die grässlichen Augen waren. Glühenden Kohlen gleich prangten sie in der grotesken Imitation eines menschlichen Antlitzes. So konturlos dieses schaurige Zerrbild, so greifbar das Böse, das seine dunklen Tentakeln tastend nach ihr ausstreckte. Im selben Augenblick änderte sich die Stimme in ihrem Kopf: »Du kannst nicht davonlaufen,« höhnte sie.
Gewaltsam reißt Priska sich aus dieser traumatischen Erinnerung, die sie tief in ihrem Inneren begraben glaubte. Sie zittert wie Espenlaub. Nebenan hört sie Luis und Elena miteinander scherzen. Das Gemüse in der Pfanne ist zwischenzeitlich zu einem undefinierbaren, schwarzem Etwas zusammengeschrumpft, der eben aufgegossene Pfefferminztee erkaltet. In Priskas Kopf mischen sich reale Begebenheiten mit Träumen, die Gegenwart mit der Vergangenheit. Ihre Gedanken fügen sich kurz wie Puzzleteile zu einem löchrigen Bild zusammen, um im nächsten Moment wieder auseinanderzustieben.
Priska weiß nicht mehr, was echt ist. Handelt es sich bei dem Gespenstermann tatsächlich um Ranieri? Geister sind doch ortsgebunden? »Nicht alle,« wispert eine sanfte Stimme. »Du musst noch viel lernen.« Priskas Teetasse zerspringt klirrend auf dem Fliesenboden.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  19.05.2016 23:32 19.05.2016 23:32
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 6: In der Schwebe
Das kleine Volksfest ist gut besucht. Obgleich die Sonne sich rar macht an diesem nebeligen Spätherbsttag. Die blinkenden Lichter der Fahrgeschäfte und Jahrmarktsbuden bilden bunte Tupfer im Novembergrau. Immerhin hat der Wind inzwischen nachgelassen. Mit seinen kalten Fingern, die einem unvermittelt und erbarmungslos unter die wärmenden Kleidungsschichten fahren, ist er ein noch unangenehmerer Geselle als die feuchte Kühle, die weiterhin passiv und träge aus dem trüben Dunst tropft.
Priska zieht den Wollschal ein wenig fester um den Hals und stopft die Enden in ihren Jackenkragen. Reflexartig kontrolliert sie, ob Elenas Stirnband noch sitzt und ihre Ohren ausreichend bedeckt sind.
Luis reicht ihnen in Bitterschokolade getauchte Erdbeeren am Spieß. Den Kontrast von herber, knackiger Kuvertüre und süßer, saftig-weicher Frucht hat Priska schon als Kind geliebt. Ein Seitenblick auf ihre Tochter verrät ihr, dass Elena in dieser Hinsicht ganz nach ihr schlägt. Luis dagegen begnügt sich mit einem einzelnen Bissen von Priskas Spieß. Ein paar widerspenstige Schokoladensplitter verfangen sich in seinem Dreitagebart. »Papa, Du hast gekleckert«, kräht Elena prompt, während Priska ihm lächelnd die süßen Überreste aus den Mundwinkeln küsst.
»Und was ist mit Dir, Du kleines Schokomonster?« Luis grüne Augen funkeln. Im gleichen Augenblick hebt er seine kichernde Tochter schwungvoll empor. »Wie ist die Luft da oben«, neckt er das Mädchen. Elena kreischt vor Vergnügen und wenig später aus Protest, als Luis seine stachelige Wange an ihre Pfirsichhaut schmiegt. »Iih, Du stoppelst,« widersetzt sie sich entrüstet. »Deine Mama mag meinen Bart«, erwidert er schmunzelnd und zieht nun auch Priska in seine Arme.
Geborgen in der Körperwärme dieser beiden geliebten Menschen, sieht sie sich für einen kurzen Moment mit den Augen eines neutralen Beobachters. Ein Bild wie aus einer kitschigen Frühstücksflockenwerbung, sinniert sie, während ihr Bauch die trockenen Gedankenworte Lügen straft. Das ist das Glück, gibt er ihrem verschrobenen Hirn zu verstehen. Halt ihn gut fest, diesen Moment, denn er wird nicht wiederkehren. Es sind romantisch verklärte Schmetterlinge, die da in ihren Eingeweiden rumoren, doch sie tanzen zu einem melancholischen Lied. Die dunkle Wolke im Hintergrund wartet nur darauf, sie zu verschlucken.
»Ich will Dosen werfen. Bitte, bitte!« Elenas bettelnde Stimme und ihre kleine Hand, die ungeduldig an Priskas Jackenärmel zerrt, reißen sie aus ihrer Schwermut. »Na, dann los!« Luis hievt das Mädchen auf seine Schultern und die Kleine krallt sich sogleich in seinen schwarzen Haarschopf. Scheinbar gemächlich schreitet Luis durch die Menge. Doch der Eindruck täuscht. Priska hat Mühe, den weit ausholenden Schritten ihres Mannes zu folgen. Zum Glück ist er aufgrund seiner imposanten Erscheinung und hochgewachsenen Gestalt kaum zu übersehen. Und für Elena, die stolz wie eine Königin und mit wippendem Pferdeschwanz auf ihm thront, machen die meisten Leute gerne Platz.
Nach einigen Minuten sind sie an einer adäquaten Wurfbude angelangt, welche mit ihren verlockenden Gewinnen kleine Mädchenherzen augenblicklich höher schlagen lässt. Lächelnd tauscht der Budenbesitzer mit dem verknitterten Gesicht und dem Zigarettenstummel im Mund, Münzen gegen Bälle.
Elena positioniert sich auf der eigens für Kinder angebrachten Holzstufe vor der Theke. Sie runzelt ihre glatte Stirn und holt konzentriert zum ersten Wurf aus. Doch der Ball verfehlt sein Ziel. Ebenso das zweite Geschoss, welches die Vierjährige nicht minder leidenschaftlich in Richtung Büchsenstapel donnert. Entmutigt dreht Elena den dritten und letzten Ball in ihrer Rechten. Priskas und Luis Anfeuerungsrufe scheinen ungehört zu verhallen. Das Kind steht da wie ein Häuflein Elend in bunt geringelten Thermostrumpfhosen und knöchelhohen, pinken Stiefelchen. Priskas Mutterherz wird schwer und sie will ihrer Tochter zu Hilfe eilen.
Doch in diesem Moment verändert sich Elenas Gesichtsausdruck. Sie strafft ihre schmalen Schultern, sieht auf und nickt dann entschlossen. Ihr Blick geht dabei ins Leere. Fast scheint es so, als antworte sie auf die eindringliche Aufforderung eines für die Umstehenden unsichtbaren Gesprächspartners. Ein kurzer Windstoß fegt durch die Gasse und bläht für einen Augenblick die seitlich angebrachten Vorhänge, welche der kargen Bude einen nostalgischen Touch verleihen. Doch die kleine Böe ist es nicht, die Priska frösteln lässt. Sie wirft Luis einen schnellen Blick zu. Ihm scheint Elenas ominöser Mimikwandel nicht aufgefallen zu sein. »Komm Elena. Diesmal schaffst Du es! Aller guten Dinge sind drei,« ruft er seiner Tochter zu.
Elena wirft und wieder scheint die Flugbahn des Balles an der Dosenpyramide vorbei zu führen. Doch kurz bevor er an den Blechbüchsen vorbeischießt, bleibt er in der Luft stehen. Als hätte ihn jemand abgefangen und würde nun, den Ball in der Hand, abwartend verharren. Priska traut ihren Augen nicht. Dann aber begegnet sie dem ungläubigen Blick des Budenbesitzers. Er steht direkt neben dem schwebenden Ball und verfolgt das seltsame Schauspiel aus unmittelbarer Nähe. Gerade, als Priska sich Luis zuwenden will, um sich zu vergewissern, dass er sieht, was sie sieht, nimmt das Geschoss wieder Fahrt auf und landet im Herzen des Dosenstapels, der scheppernd in sich zusammenfällt.
Elena klatscht jubilierend in die Hände. Ausgelassen springt sie auf dem Holzpodest auf und ab. Der Schausteller greift hastig nach einem rosa Plüscheinhorn mit Regenbogenmähne und drückt es dem Kind in die Arme. »Herzlichen Glückwunsch«, murmelt er wenig enthusiastisch. Dann kehrt er ihr den Rücken zu und begrüßt eine andere, wartende Familie. Es scheint, als wolle er Elena und ihre Eltern schnellstmöglich loswerden. Um sie herum erhebt sich aufgeregtes Gemurmel. Das widernatürliche Phänomen hat nur wenige Sekunden gedauert. Dennoch hat es offensichtlich sein Publikum gefunden. Rasch nimmt Luis seine Tochter samt Kuscheltier auf den Arm. Zusammen verlassen sie den Stand. Priska ist unbehaglich zumute. Sie spürt, wie verstohlene Blicke das Trio streifen und andere sich Pfeilen gleich in ihren Rücken bohren.
Kaum sind sie außer Hörweite, stellt Luis das Kind auf den Boden und fragt atemlos: »Was war das denn?« Elena mustert ihn verständnislos. »Warum ist der Ball in der Luft stehen geblieben«, führt Luis seine Frage weiter aus.
»Ach das.« Seine Tochter winkt nonchalant ab. »Eleonore hat mir geholfen. Aber ich hab` es schon fast alleine geschafft.«
»Wer, zum Kuckuck, ist Eleonore?« Luis klingt gereizt. Priska legt ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Zugleich versucht sie, ihre Gedanken zu ordnen, die wie überdrehte Flöhe in ihrem Kopf wild durcheinander hüpfen. Elena und Eleonore? Die Ähnlichkeit der Namen ist frappant. Aber ein Kind würde sich doch nie jemanden ausdenken, der Eleonore heißt?
»Über die Theorie mit den imaginären Freunden sind wir doch längst hinweg, Priska«, flüstert plötzlich eine leise Stimme direkt neben ihrem Ohr. Der Unterton ist ungeduldig und mahnend. Sie zuckt zusammen.
Elena schiebt schmollend ihre Unterlippe nach vorne. »Sie kommt oft mit Ranieri.« Während Luis mit einem deutlich vernehmbaren Zischen die kalte Luft durch seine zusammengebissenen Zähne zieht, sieht Elena ihre Mutter an und ergänzt kleinlaut: »So heißt der Mann, Mama.«
Priska klopft das Herz bis zum Halse. Die Worte sterben noch auf der Zunge, bevor sie ihren Mund verlassen können. Sie schluckt sie ungesagt hinunter.
Luis blickt seine Frau unverwandt an. Er kann seinen Groll kaum verbergen. Die Farbe seiner Augen gleicht nun nicht länger leuchtenden Smaragden, sondern vielmehr dunklen Tannen. »Was, um alles in der Welt, hast Du ihr erzählt«, fährt er Priska ungehalten an. «Kannst Du unsere Tochter nicht aus Deiner Vergangenheit raushalten? Nun siehst Du, was Du davon hast!« Nach Fassung ringend rauft er sich die Haare.
»Jetzt komm mal wieder runter, Luis. Hast Du immer noch nicht verstanden, dass Elena sich das alles nicht ausdenkt? Du hast doch gerade mit eigenen Augen gesehen, was passiert ist.« Priska wird nun ihrerseits wütend, aber auf keinen Fall möchte sie, dass Elena, die ein wenig verloren zwischen ihren Eltern steht, einem Ehekrach beiwohnen muss.
»Mama hat mir gar nichts erzählt,« schaltet sich das Kind nun wieder in die unerquickliche Diskussion ein. Luis mustert sie unschlüssig. «Lasst uns später in Ruhe darüber reden.« Priska versucht mit betont gelassener Stimme die Wogen zu glätten, doch in ihr tobt das stürmische Meer weiter.
»Ranieri«, flüstert Luis heiser. Dann sammelt er sich und fragt mit gezwungen wirkender Heiterkeit: »Und, was machen wir jetzt?«
Elena zögert kurz, dann ruft sie: »Kettenkarussell, Kettenkarusell!« Ihrem Wunsch verleiht sie den nötigen Nachdruck, indem sie wie ein kleiner Irrwisch im Kreis herumrennt, in dessen Zentrum wie angewachsen ihre Eltern stehen, die nun zaghaft lächelnd versöhnliche Blicke tauschen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denkt Priska. Doch wie soll sie Stellung zu etwas beziehen, für das sie selbst keine Erklärung parat hat?
Priska und Elena nehmen nebeneinander Platz. Ein Mitarbeiter kontrolliert gewissenhaft, ob die Sicherheitsbügel ordnungsgemäß eingerastet sind. Das Mädchen lässt die Beine baumeln und kann es kaum erwarten, dass die Fahrt beginnt. Endlich setzt sich das Karussell in Bewegung und Mutter und Tochter schweben jauchzend Hand in Hand dem Himmel entgegen. Sie schrauben sich immer höher in die Lüfte und die Menschen am Boden werden zu Figuren aus einem Wimmelbuch. Noch vor wenigen Sekunden ist Luis lächelndes Gesicht an ihnen vorbeigezogen. Doch inzwischen sind sie so schnell, dass die Umgebung zunehmend vor ihren Augen verschwimmt. Der Nebel tut sein Übriges. Nur hin und wieder durchsetzt ein bunter Fetzen die wabernde, graue Masse. In jeder Runde begegnen ihnen die Fangarme des »Kraken«, der unweit von ihnen seine in wild schaukelnden Gondeln untergebrachten Fahrgäste zum Kreischen bringt. Und da drüben haben sich ein paar leuchtende Heliumballons aus klammen Kinderhänden befreit und streben nun ebenfalls gen Himmel.
Priska schließt kurz ihre Lider und genießt das Gefühl der Schwerelosigkeit. Doch plötzlich merkt sie, wie Elena ihre Finger fester umklammert und Priskas Arm nach unten gezogen wird, als würde das komplette Gewicht des Mädchenkörpers daran hängen. Rasch schlägt sie die Augen auf. »Mama, hilf mir!« Ihre Tochter klingt zu Tode verängstigt. Der Metallbügel, welcher kurz zuvor Elenas Hüften noch sicher umschlossen hatte, scheint sich gelöst zu haben und ihr Kind droht, hindurchzurutschen. Priska hält die Hand ihrer Tochter so fest, dass es weh tun muss. Ihre Knöchel sind ebenso weiß wie Elenas Gesichtchen. Sie versucht, auch mit ihrer anderen Hand, den Arm ihres Kindes zu ergreifen, doch es gelingt ihr nicht. »Halt Dich fest«, brüllt sie gegen den Fahrtwind an. Sie fühlt sich in einen Alptraum versetzt, aus dem sie nicht erwachen kann. Ihre schlimmsten Ängste scheinen wahr zu werden. »Nein, bitte, nein! Das darf nicht passieren!« Inständig betet sie darum, dass die Fahrt endlich zu Ende sein möge und sie heil unten ankommen. Sie merkt, wie die Panik ihre Hände feucht werden lässt und Elenas Griff an Kraft verliert. »Mein Spatz, Du musst Dich auch mit der anderen Hand richtig festhalten. An der Kette! Schnell!« Wie paralysiert und am ganzen Leib zitternd umfasst Elena mit der Linken, die sie um den lockeren Bügel gelegt hatte, die Aufhängung. Ihre schreckgeweiteten Augen suchen einen Anker in denen ihrer Mutter. Sie öffnet den Mund, doch Priska kann sie nicht hören. Wie ein Schraubstock umklammert sie die kleine Kinderhand. »Ich lass Dich nicht los! Wir schaffen das!« Elena nickt wie ferngesteuert, doch ihr Blick schweift nun ab und geht an Priska vorbei.
Erst jetzt wird sich Priska gewahr, dass der graue Schleier, der sie eben noch umhüllt hat, einer schwarzen Wand gewichen ist, die sich undurchdringlich um sie herum auftürmt. Wie gelähmt erkennt sie, dass das Gebilde nicht etwa aus lebloser Materie, sondern aus unzähligen Schatten besteht, die mit einer bedrohlichen Langsamkeit auf sie zugekrochen kommen. Die düstere Wolke, welche eben noch Priskas Bauch besetzte, hat sich nun ihren Weg nach draußen gebahnt und ist zu einem grauenvollen Ungetüm angeschwollen.
Obwohl sie nicht das erste Mal dem Tod so nahe ist, hat Priska noch niemals solche Angst verspürt. Wenn ihr einziges Kind fiele, würde sie sich, ohne zu zögern, hinterherstürzen. Es ist, als wüssten die Schatten das. Geisterhafte, schlangenförmige Auswüchse lösen sich tastend aus dem schwarzen Dunst. Sie sind weitaus furchteinflößender als die Tentakeln des benachbarten Fahrgeschäfts, denn sie haben nur ein Ziel: Mutter und Tochter mit sich in die Dunkelheit zu reißen.
Der Sog wird stärker und Elenas Hand rutscht unaufhaltsam durch Priskas schweißnasse Finger. »Warum merkt denn keiner, was hier los ist«, denkt sie verzweifelt und schreit so laut, sie kann, um Hilfe. Der Fahrtwind verschluckt ihre Worte und peitscht höhnend die Haarsträhnen, die sich aus ihrem Zopf gelöst haben, in ihr Gesicht. Die anderen Fahrgäste sind im Nebel nicht einmal schemenhaft auszumachen. Priska und Elena sind allein im Zwielicht gefangen.
Einige der Schatten verschmelzen und formieren sich neu. Entsetzt blicken Priska und Elena in ein vom unstillbaren Rachedurst entstelltes Gesicht. Die bitteren Züge sind verschwommen, die Bösartigkeit jedoch ist körperlich greifbar. Die schwarzen Augen glühen und die schmalen Lippen verziehen sich zu einer widerwärtigen, verschlagenen Parodie eines Lächelns. »Sieh nicht hin«, fleht Priska ihr Kind an. Doch ihre Aufforderung kommt zu spät. Elena ist wie hypnotisiert von der maskenhaften Erscheinung und ihre Hand, die Priska kaum noch fassen kann, fühlt sich so schlaff an wie die einer Stoffpuppe.
»Nein! Du wirst uns nicht bekommen!« Als Priska diese Worte in das nebelige Konterfei der schwarzen Frau speit, spürt sie, wie die Wut ihre Angst verdrängt und ihr eine ungekannte Energie verleiht, welche explosionsartig all die Dämme sprengt, welche ihr Bewusstsein in den letzten Jahren mühevoll errichtet hat. »Hinfort mit Dir, Du Scheusal!«
In diesem Moment berühren Priskas Fußspitzen den Boden und das Karussell hält an. Das grauenhafte Antlitz löst sich auf und durch die auseinanderdriftenden Nebelschwaden sehen sie einen kreidebleichen Luis heraneilen. Direkt hinter ihm der Mann vom Sicherheitspersonal, der zuvor die Metallbügel kontrolliert hat. Luis zieht Elena aus ihrem Sitz und sinkt mit dem zitternden Mädchen im Arm auf seine Knie. Priskas taube Finger gleiten kraftlos von Elenas kalter, kleiner Hand.
»Sie muss den Bügel selbst hochgeschoben haben«, dringt die Stimme des Schaustellers an ihre Ohren. »So etwas ist noch nie passiert.«
Müßig, ihm erklären zu wollen, was wirklich geschehen ist. Die pelzigen Gliedmaßen wollen kaum gehorchen, aber irgendwie schafft Priska es, sich ebenfalls aus ihrem Sitz zu schälen. Sie stolpert zu Mann und Kind und streichelt beide unbeholfen, während ihr heiße Tränen über die Wangen laufen.
Ein Tag, der einer der schönsten und fröhlichsten in Elenas Kindheit hätte werden sollen, endet nun in einem unauslöschlichen Trauma. Wie würde sie das nur jemals wieder gut machen können? Sie leben und doch hat Priska das Gefühl, dass dies erst ein kleiner Vorgeschmack dessen war, was sie noch erwartet.
Als sie sich zusammen schweigend in Richtung Ausgang kämpfen, erscheint es ihr so, als ob jemand das lustige, kunterbunte Treiben um sie herum wie eine tarnende Schablone auf das eigentliche Bild gelegt hat. Lediglich einzelne Löcher lassen erahnen, welches Grauen in den darunter liegenden Schichten lauert. Düstere Gestalten hocken in den Ecken und schieben sich unbemerkt an lärmenden Besuchern vorbei. Der ein oder andere mag einen beklemmend kalten Hauch verspüren und schaudernd den Mantelkragen nach oben schlagen. Die dunklen Wesen beobachten jeden ihrer Schritte und sind bereit, genau dann zuzuschlagen, wenn ihre arglosen Opfer es am wenigsten erwarten.
In dieser Nacht findet Priska keinen Schlaf. Tapfer widersteht sie dem unbändigen Drang nach einer Tablette. Sie liegt heute im Elternbett und hat ihre Arme fest um Elena geschlungen. In bösen Träumen gefangen, wimmert das Kind kläglich. Alle paar Minuten zuckt es zusammen und wirft seinen Kopf unruhig hin und her. Luis schläft dicht an seine Frau geschmiegt. Gegen fünf Uhr morgens schließlich scheinen sich Elenas Alpträume zu verziehen. Priska merkt, wie die Anspannung aus dem kleinen Körper weicht und ihr Atem einen gleichmäßigen Rhythmus annimmt. Nun werden ihr auch endlich die eigenen Augenlider schwer und sie gleitet hinüber – auf die andere Seite.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  20.05.2016 00:06 20.05.2016 00:06
von Federfarbenfee
|
 |
|
Liebe Pia,
bitte entschuldige. Ich wollte Deinen Kommentar keineswegs unter den Tisch fallen lassen!
Es freut mich sehr, dass Du die Geschichte als spannend empfindest!
Sei auch an dieser Stelle nochmal von Herzen lieb gegrüßt!
Mary 
|
|
| Nach oben |
|
 |
bamba
 Eselsohr Eselsohr

Beiträge: 201
|
  20.05.2016 11:56 20.05.2016 11:56
von bamba
|
 |
|
Wie angekündigt, will ich mich versuchen als Testleser. Danach willst du mich vielleicht tatsächlich an die Wand klatschen. Hehe.
Wie von anderen auch schon geschrieben, finde ich es nicht geschickt, mit der fortgeschrittenen Geschichte anzufangen. Es raubt einem ja als Leser etwas die Spannung.
Positiv sehe ich, du hast eine Geschichte, mit einem Kern. Den Kern sehe ich in der unglücklichen Beziehungsgeschichte, die in der Vergangenheit spielte und durch den Tod Ranieris beendet wurde. Find ich auch den eindrücklichsten Teil, die Rückblende, als er Priska erzählt von seinem nahenden Tod. Ich bekomme den Eindruck, sie hat diesen nie überwunden. Ja, diese Liebe und Trauer sind nie erloschen. Also geht es eigentlich um diesen Abschied?? So wird Ranieri ja dann auch zum Bindeglied zur mystischen Welt, in die sie mit ihm eintaucht um dort ihre "Probleme" zu bereinigen. Ich hoffe ich habe dies soweit, in Etwa, richtig verstanden.
Nun zum für mich problematischen Teil. Was ja überhaupt die Schwierigkeit ist beim Schreiben einer Geschichte, und womit wir uns hier wohl alle rumzuschlagen haben, ist es einen Fluss zu erzeugen, der einen Aussenstehenden hineinzieht. Dies funktioniert für mich nur stellenweise. Ich kann dir aber auch nicht sagen woran dies liegt. Meine individuelle Erklärung, vielleicht ist mir die Geschichte zu "brav" erzählt. Ist aber etwas wage wahrgenommen. Also wenn man beim lesen eines Satzes, den nächsten schon voraussieht, wenn du weißt was ich meine, zieht es einem vielleicht weniger hinein, als wenn es Brüche gibt. Ist aber eine gewagte Aussage. Denn gerade ich bediene mich so vieler Brüche, dass es dann eher zur Bruchlandung kommt, anstatt zum Fluss. 
Tja, ein Versuch mich als Kritiker zu betätigen, mit der Hoffnung nicht demotivierend zu wirken, sondern im Gegenteil. Deine Geschichte befindet sich ja schon in einem reifen Zustand.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  21.05.2016 08:31 21.05.2016 08:31
von Federfarbenfee
|
 |
|
Hallo Bamba,
da bin ich also wieder. 
Vielen Dank, dass Du Dir tatsächlich die Mühe gemacht hast, die 46 Buchseiten komplett durchzulesen und sie zu rezensieren.
Wegen dieser konstruktiven und zutreffenden Kritik klatsche ich Dich bestimmt nicht an die Wand. Eher kratze ich Dich dafür wieder runter. 
Ja, mittlerweile habe ich eingesehen, dass es kein kluger Schachzug war, das siebte Kapitel einzustellen. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht damit gerechnet, dass der ein oder andere an der kompletten Geschichte interessiert sein könnte. Hatte eigentlich lediglich Feedback zur Idee und Schreibe erwartet. Das siebte Kapitel vereint ad dato die meisten derjenigen Elemente, die zusammen den roten Faden ergeben. Daher hatte ich mich für diesen Auszug entschieden. Aber wie MoL in einer Antwort schrieb: Die Geschichte muss einen von Anfang an packen. Ich denke, das ist bei mir noch nicht der Fall. Mit dem Prolog bin ich wie gesagt unzufrieden. Da muss ich nochmal in mich gehen.
Ja, die Beziehung zwischen Priska und Ranieri spielt eine zentrale Rolle. Ebenso wie die Beziehung zu ihrem Mann und die zu ihrer Tochter. Der Abschied ist jedoch nicht das Kernthema. Vielmehr begleitet der Leser Priska auf der Suche nach den Ursachen für ihre Insomnie und bei der Jagd nach ihren Dämonen. Ob letztere nur ihrer Phantasie entspringen, ist unklar. Die Grenzen zwischen Traum, Wahn und Realität verschwimmen dabei ständig. Dass die Geschichte in der Vergangenheit von einer anderen Person erzählt wird und ein Ereignis aus dieser Zeit noch in die Gegenwart nachzuwirken scheint, spricht dafür, dass nicht nur Priskas Kopfkino für ihr Dilemma verantwortlich ist.
"So wird Ranieri ja dann auch zum Bindeglied zur mystischen Welt, in die sie mit ihm eintaucht, um dort ihre "Probleme" zu bereinigen." Bingo!  Das hast Du wunderbar ausgedrückt. Diesen Satz muss ich mir merken. Der ist glatt klappentexttauglich. (Komma vor "um" habe ich mir zu ergänzen erlaubt. Das hast Du wunderbar ausgedrückt. Diesen Satz muss ich mir merken. Der ist glatt klappentexttauglich. (Komma vor "um" habe ich mir zu ergänzen erlaubt.  ) )
Die Probleme, die Du erwähnt hast, sehe ich auch. Der Lesefluss gerät immer wieder ins Stocken. Und Du liegst auch mit der Begründung völlig richtig: Mein Mann sagt immer, ich würde die Geschichte mit angezogener Handbremse schreiben. In der Tat zu "brav". In diese Zwickmühle habe ich mich selbst katapultiert: Ich veröffentliche die Story derzeit als Fortsetzungsroman auf meiner Website, die zugleich als eine Art Familienblog fungiert. Und ich denke, dass ich wahrscheinlich mehr oder weniger unterbewusst die Nerven der Eltern schonen will, die dort lesen. Dieser Kompromiss funktioniert aber nur bedingt. Das merke ich mittlerweile deutlich. Ganz oder gar nicht. Ich glaube, auf die Dauer muss ich Roman und Blog doch irgendwie voneinander entkoppeln. Im aktuellen, neunten Kapitel stirbt zum Beispiel ein Kind. Nicht unbedingt das, was eine Mutter beim gemeinsamen Sonntagsfrühstück mit den Kindern gerne lesen möchte.
Um wirklich die Sau rauslasen zu können, müsste ich wahrscheinlich sogar unter Pseudonym schreiben.
Eigentlich war geplant, den ersten Teil der Geschichte auf dem Blog zu veröffentlichen und für den zweiten "Band" einen anderen Veröffentlichungsweg zu beschreiten. Mal sehen.
Ein zweiter Punkt für das teils holprige Lesegefühl sind wahrscheinlich die vielen Pausen, die ich zwischen dem Schreiben einlegen muss. Es würde besser fließen, wenn ich jeden Tag an der Geschichte arbeite. Ich bin schon dabei, mir entsprechende Zeitfenster zu schaffen, aber ist nicht so einfach mit zwei Kleinkindern, die das Wenigschläfergen von mir geerbt haben. 
Zwecks der Brüche hast Du ebenfalls recht. Ich lese Geschichten mit unerwarteten Wendungen auch sehr gerne. Die sind auch in meinem Roman vorgesehen, doch folgen sie erst später. Allerdings hatte ich gehofft, dass meine bisherigen Kapitel trotzdem nicht komplett vorhersehbar sind. Das gibt mir Stoff zum Nachdenken. 
Du solltest häufiger in die Rolle des Kritikers schlüpfen. Du machst das nämlich wirklich gut. Dein Feedback hat mich absolut nicht demotiviert. Ganz im Gegenteil. 
Es grüßt Dich
Mary
|
|
| Nach oben |
|
 |
purpur
Klammeraffe

Beiträge: 964
|
  21.05.2016 12:46 21.05.2016 12:46
von purpur
|
 |
|
Hallo  liebe Federfarbenfee, liebe Federfarbenfee,
Ich würde auch sehr gern den kompletten Text lesen wollen, ist das möglich?! Ich
halte die  Folter nicht aus! Folter nicht aus!
Dann lege ich halt mal ne Nachtschicht ein-werd aber nicht
sogleich antworten können, weil ich Zeit zum Nachfühlen brauche.

Einerholsames Wochenende,
Purpurgrüßt Dich
Pia
_________________
.fallen,aufstehen.
TagfürTag
FarbTöneWort
sammeln
nolimetangere
© auf alle Werke |
|
| Nach oben |
|
 |
bamba
 Eselsohr Eselsohr

Beiträge: 201
|
  22.05.2016 17:24 22.05.2016 17:24
von bamba
|
 |
|
| Federfarbenfee hat Folgendes geschrieben: |
Ja, die Beziehung zwischen Priska und Ranieri spielt eine zentrale Rolle. Ebenso wie die Beziehung zu ihrem Mann und die zu ihrer Tochter. Der Abschied ist jedoch nicht das Kernthema. Vielmehr begleitet der Leser Priska auf der Suche nach den Ursachen für ihre Insomnie und bei der Jagd nach ihren Dämonen. Ob letztere nur ihrer Phantasie entspringen, ist unklar. Die Grenzen zwischen Traum, Wahn und Realität verschwimmen dabei ständig. Dass die Geschichte in der Vergangenheit von einer anderen Person erzählt wird und ein Ereignis aus dieser Zeit noch in die Gegenwart nachzuwirken scheint, spricht dafür, dass nicht nur Priskas Kopfkino für ihr Dilemma verantwortlich ist.
|
Ich will Mal, nur inhaltlich, was dazu schreiben.
Eine Liebe die nicht ausgelebt werden konnte, deren Potential nicht ausgeschöpft werden konnte, lebt vielleicht manchmal länger fort, als eine, die ausgelebt wurde und dann sich ev. verloren hat.
Hier ist es der Tod, der zwei auseinander bringt.
Ich verstand da schon eine Verbindung zu den Problemen von Priska, mit dieser Geschichte. Vielleicht konnte sie Ranieri nicht vergessen/loslassen, weil sie ihn noch braucht, ist diese "Gefangenschaft" in der mystischen Welt, eben auch ein Symbol für etwas, im realen Leben. Sie braucht ihn noch, weil sie etwas mit ihm teilt, nur mit ihm. Ein Geheimnis vielleicht, welches eben der Ursprung ist, zu dieser Verbindung zu den dunklen Kräften .
Nur so Gedankenspiele und Interpretationen.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  22.05.2016 23:42 22.05.2016 23:42
von Federfarbenfee
|
 |
|
Liebe Pia,
gerne kann ich bei Gelegenheit diesen Strang um die Folgekapitel 8 und 9 ergänzen. Weiter ist die Geschichte noch nicht gediehen. Das leidige Zeitproblem, Du weißt. 
Und bitte fühle Dich niemals genötigt, zeitnah antworten zu müssen! Dieser Anforderung (?) kann ich selbst auch nicht genügen.
Einen guten Start in die neue Woche und herzliche Gute-Nacht-Grüße!
Mary
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  23.05.2016 00:24 23.05.2016 00:24
von Federfarbenfee
|
 |
|
Hallo bamba,
mit Deiner Interpretation triffst Du mitten ins Schwarze! Jetzt bin ich platt. 
Sowohl die Magie dieser besonderen Beziehung als auch das Geheimnis betreffend, welches beide verbindet. Wobei sie Letzteres selbst noch lüften müssen.
Du hast recht: Eine Liebe, die in ihrer Blüte auseinandergerissen wurde, um es einmal schwülstig auszudrücken  , kann bisweilen länger fortbestehen oder nachhallen, als eine Liebe, die sich aus- und gegebenenfalls auseinanderleben durfte. Zudem war Priska damals 17. Die Beziehung zu Ranieri hat sie und ihr Leben entscheidend geprägt. In ihrer Erinnerung hat sie jene Liebe vielleicht auch ein wenig mystifiziert. Ja, Ranieri hat Zugang zu Priskas Welt. Etwas, das Luis verwehrt ist. , kann bisweilen länger fortbestehen oder nachhallen, als eine Liebe, die sich aus- und gegebenenfalls auseinanderleben durfte. Zudem war Priska damals 17. Die Beziehung zu Ranieri hat sie und ihr Leben entscheidend geprägt. In ihrer Erinnerung hat sie jene Liebe vielleicht auch ein wenig mystifiziert. Ja, Ranieri hat Zugang zu Priskas Welt. Etwas, das Luis verwehrt ist.
Ich finde es toll, dass Du Dich so intensiv mit meiner Geschichte auseinandersetzt! Sehr inspirierend und motivierend, dieser Dialog - ich danke Dir dafür!
Viele Grüße
Mary
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  05.06.2016 00:44 05.06.2016 00:44
von Federfarbenfee
|
 |
|
Hallo, liebe Leute,
wie angekündigt folgen heute noch Kapitel 8 und 9. Dabei werde ich es aber vorerst belassen. Schließlich wollte ich Euch ursprünglich nur mit einem halben Kapitel 7 bombardieren. Aktuell schreibe ich an Kapitel 10 und habe dabei Eure Tipps im Hinterkopf. 
----------------------------------------------------------------------
Kapitel 8: Das Mädchen
Vorsichtig stellt Luis die bis zum Rand mit dampfendem Milchkaffee gefüllte Tasse neben Priskas Notebook ab. Sein Blick heftet sich auf den Monitor. »Du denkst also tatsächlich, dass das die Erklärung für deine nächtlichen Panikattacken ist?« Der Ausdruck in seinen Augen ist schwer zu deuten. Vermutlich ist er spätestens jetzt davon überzeugt, dass seine Frau nicht mehr alle Latten am Zaun hat.
Priska seufzt und nippt am heißen Milchschaum. Luis hat es nicht versäumt, den Kaffee mit etwas Karamellsirup zu verfeinern. Ein Hauch von Behaglichkeit legt sich über ihre ungemütlichen Gedanken. »Wir haben doch ausgiebig über meinen Traum von letzter Nacht gesprochen?«
Luis Miene verfinstert sich. »Dass Träume Beweischarakter haben, ist mir neu. Wenn dem so wäre, könnten wir diese Unterhaltung gar nicht führen. Denn dann hätten mich schon vor langer Zeit die schrumpeligen, grauen Männchen, die mir nachts hin und wieder begegnen, auf einen Planeten namens Numidos entführt und Hackfleisch aus mir gemacht.«
Obwohl ihr gar nicht danach zumute ist, muss Priska unwillkürlich auflachen. Sie verschluckt sich an ihrem Kaffee. »Ach Luis,« krächzt sie hustend. »Du machst mich noch wahnsinnig.«
»Ich befürchte, das erledigst du schon selbst,« entgegnet ihr Mann kühl. Seine Worte treffen sie unvermittelt wie ein Peitschenhieb und lassen sie zusammenzucken.
Solche spitzen Äußerungen sind untypisch für Luis. Ihre langjährige Liebe basiert auf nahezu vollendetem Gleichklang. Disharmonien gab es bisher kaum. Doch der gemeinsame Jahrmarktsbesuch und die darauffolgende Nacht scheinen die perfekt austarierten Waagschalen ihrer Beziehung aus der Balance gebracht zu haben. Bereits in dem Augenblick, da Elena ihren nächtlichen Besucher zum ersten Mal erwähnte und Priska sie in ihrem Glauben offensichtlich bestärkte, war Luis Toleranzschwelle eindeutig überschritten gewesen. Dass der Geisterfreund nun seine Identität aufgedeckt und sich noch dazu erdreistet hat, auch in Priskas Kopf herumzuspuken, verbessert die Situation, wie sie sich aus Luis Blickwinkel darstellt, nicht wirklich. Priska kann ihm seinen Unmut noch nicht einmal verübeln. Dennoch ärgert sie sich über seine Bemerkung. Sie fühlt sich von ihm im Stich gelassen. Luis macht es sich zu einfach, wenn er die seltsamen Ereignisse ausschließlich als Symptome ihrer Überspanntheit abtut. Elenas Telekinesedarbietung hat er sogar mit eigenen Augen gesehen. Trotzdem weigert er sich strikt, übersinnliche Phänomene auch nur in Betracht zu ziehen. Vielmehr macht er seine Frau dafür verantwortlich, dass Elena sich derzeit lieber mit imaginären Geisterfreunden als mit solchen aus Fleisch und Blut umgibt. Die Szene im Kettenkarussell hat er ebenfalls auf die augenscheinlichen Tatsachen zurechtgestutzt. Der Bügel war defekt. Ebenso wie die Wahrnehmung von Frau und Tochter. Die dunklen Schatten seien Auswüchse ihrer beider blühender Phantasie. Eine Art Massenhysterie im Kleinen, so Luis. Die Vorwürfe, die in jedem seiner Sätze mitschwingen, sind inzwischen nicht mehr latent zu nennen, sondern springen Priska direkt ins Gesicht. Je mehr sie miteinander reden, desto unverstandener fühlt sie sich.
Der Milchschaum ist in sich zusammengefallen und der Kaffee erkaltet. Priska leert die Tasse hastig. Um Luis bohrenden Blicken auszuweichen, starrt sie dabei weiter auf den Bildschirm. Die flimmernden Worte ergeben keinen Sinn mehr. Nur Buchstabensalat. Dafür wirkt die alte Bleistiftzeichnung in dem Onlineartikel umso plastischer. Priska spürt förmlich, wie die Last der unheimlichen Kreatur, die da über dem schlafenden menschlichen Körper kauert, ihr selbst die Luft abdrückt und den Lebensodem raubt. Ein Schauer läuft ihr über den Rücken. Zu präsent das unheimliche Wesen, welches letzte Nacht von ihrer Zimmerdecke hing.
Als Luis seine warme Hand auf Priskas steifen Finger legt, erschrickt sie. Doch sie entzieht sich seiner Berührung nicht.
»Priska, es tut mir leid, dass ich eben so schroff war. Aber Aufhocker? Ich bitte dich. Das klingt doch eher nach einem verstaubten Ammenmärchen als nach einer plausiblen Theorie.«
»Findest du? Nach dem, was in den letzten Tagen alles passiert ist, erscheint mir diese Erklärung gar nicht so abwegig.« Endlich stellt sie sich seinem skeptischen Blick und kontert ihn mit trotziger Herausforderung. »Versuch doch einfach mal, außerhalb deiner unzähligen Schubladen zu denken. In meinem Hirn herrscht Anarchie. Vielleicht macht mich das verrückt, aber es erweitert auch den Horizont.«
Luis schüttelt den Kopf. »Nein, so einen Unfug kann ich beim besten Willen nicht glauben. Überleg dir das bitte nochmal mit der Verhaltenstherapie. Ich bin mir sicher, dass dir die Insomnie diese … .Wahnvorstellungen … in den Kopf pflanzt. Und ich halte es für unverantwortlich, dass du Elena mit hineinreißt in deine Paranoia.«
»Luis, wenn du mir auf die Tour kommst, hat es echt keinen Sinn mehr, wenn wir uns darüber unterhalten.« Brüsk schüttelt Priska seine Hand ab und steht so ruckartig auf, dass sie dabei ihren Stuhl umwirft. Krachend knallt die Lehne aufs Parkett. «Manchmal wünsche ich mir, dass du nur eine Nacht das durchlebst, was mir seit Ewigkeiten widerfährt.«
»Was würde das bringen? Dass wir beide handlungsunfähig und irrlichternd durch die Gegend stolpern?«
»So siehst du mich also? Als durchgeknalltes Wrack?« Die Wut lässt Priska zittern. Es fehlt nicht viel und sie spuckt Luis in seine Souveränität heuchelnde Visage. »Es gibt Momente, da hasse ich dich. Jetzt gerade ist so einer.«
Sie hat die Worte leise ausgesprochen. Dennoch treffen sie Luis im Innersten. Priska kann beinahe sehen, wie etwas in ihm zerbricht. »Und ich liebe dich«, entgegnet er schlicht. »Aber ich mache mir Sorgen.«
Sie hat ihn verletzt. Und er sie. Priska kämpft mit widerstreitenden Emotionen. Einerseits möchte sie ihm gerne den Schmerz vom Gesicht küssen. Andererseits würde sie ihn am liebsten eigenhändig auf den Mond oder seinen Alptraumplaneten Numidos schießen.
Stattdessen sagt sie nur: »Wir müssen gleich los.«
Die Leiterin von Elenas Kindergartengruppe hat die Eltern um ein Gespräch gebeten. Weder Priska noch Luis wissen, um was es geht. Doch Priska schwant nichts Gutes. Luis hat den Tag freigenommen. Und eigentlich wollten sie die Stunden bis zu dem Termin auskosten und in idyllischer Zweisamkeit verbringen. Nun sind sie beide froh, dass sie vorerst aus dieser verfahrenen, wenig romantischen Situation flüchten können.
»Wie ihr wisst, sind wir von Elenas Kreativität und ihrer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit sehr angetan.« Elenas Kindergärtnerin, Katja Averbeck, bemüht sich sichtlich darum, eine angenehme Atmosphäre und Grundlage für ihre Unterredung zu schaffen. Doch ihre Finger, die sie in fliegendem Wechsel ver- und entknotet, strafen das vorgegaukelte Wohlfühlambiente Lügen. Priska rutscht unruhig auf dem bunten Kinderhocker hin und her und versucht, eine halbwegs entspannte Sitzposition einzunehmen. Sie befinden sich im Werkraum. Auf dem Tisch, dessen Originalton unter der Vielzahl von Farbklecksen kaum noch zu erahnen ist, stehen bunte Dosen mit noch bunteren Papierblumen. In so einer Umgebung ist es nahezu unmöglich, dunklen Gedanken anheimzufallen. Oder?
Nach einem kurzen Räuspern fährt Katja fort: »Häufig ist der Übergang zwischen Elenas üppig ausgestatteter Phantasiewelt und der Realität allerdings schwimmend. Was aber durchaus normal sein kann in dem Alter. Hat sie eine neue Freundin, die bei euch quasi ein- und ausgeht?«
Die Eltern wechseln einen kurzen Blick. »Nein«, antwortet Luis. »Nicht, dass wir wüssten. Und keines der Kinder, die sie kennt, besucht sie häufiger als ein- bis zweimal die Woche.«
Priska schluckt. Sie kann sich denken, worauf diese einleitenden Worte hinauslaufen. Trotzdem möchte sie zunächst abwarten und einen Blick auf Katjas Sicht der Dinge erhaschen.
»Könnt Ihr euch vorstellen, dass sie eine imaginäre Freundin hat? Eine unsichtbare Begleiterin, mit der sie allerhand unternimmt und von der sie oft spricht?«
»Der Begriff ist uns durchaus geläufig,« erwidert Luis scharf. Seine Frau weiß, dass der schneidende Tonfall ein reiner Abwehrmechanismus ist. Doch Katja zieht irritiert die Augenbrauen hoch.
Da Priska befürchtet, das Gespräch könne eine wenig zielführende Wende nehmen, schaltet sie sich früher ein als ursprünglich beabsichtigt: »Vor Kurzem waren wir auf dem Volksfest und da hat sie ein Mädchen erwähnt, das ihr angeblich beim Dosenwerfen geholfen hat. Wir haben aber niemanden gesehen.« Den Umstand, dass ihr selbst das Geisterkind schon im Traum erschienen ist, lässt sie lieber unter den bunten Holztisch fallen.
»Hat sie das Mädchen beim Namen genannt?« Katja wirkt nicht überrascht und setzt ihr Verhör unbeirrt fort.
»Eleonore«, antwortet Priska und beobachtet dabei ihren Mann. Luis Mund ist nurmehr ein dünner Strich. Er starrt an Katja vorbei, durch das große Fenster in den Garten hinaus, wo Elena gerade unbeschwert mit ihren Kindergartenfreunden umhertollt..
»Ja, dann reden wir von dem gleichen Mädchen,« stellt Katja fest.
»Von dem gleichen, nichtexistenten Mädchen,« ergänzt Luis.
Katja ignoriert seinen Einwand und legt stattdessen ein DIN-A3-großes Blatt Papier auf den Tisch. Es handelt sich um eine Kinderzeichnung. Zweifellos stammt sie von Elena. Priska braucht einen Moment, um das Bild in seiner Ganzheit zu erfassen. Auf den ersten Blick scheint es das perfekte Familienidyll widerzuspiegeln. Groß und Klein unter einem kunterbunten Regenbogen und einem blauen Himmel, von dem eine freundliche Sonne auf glückliche Menschen herunterlacht. Nur zählt diese Familie vier Mitglieder statt drei. Eines der Kinder trägt ein rotes Kleid und eine Haarschleife im gleichen Farbton. Im Arm hält es etwas, das aussieht wie eine Puppe. Ebenfalls in roten Stoff gewandet. Priskas Pulsfrequenz verdoppelt sich augenblicklich und ihr stockt der Atem. In Elenas Zeichnung steht das Geistermädchen lachend zwischen Mutter und Tochter und hält beide an der Hand. Sie ist die Einzige mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck. Die Münder von Elena und ihren Eltern sind lediglich waagrechte Linien. Elenas andere Hand geht direkt in Luis rechten Arm über. Er wird damit zu einem weiteren Glied dieser kleinen Menschenkette. Links neben Priska türmen sich schwarze, mit Schwung aufs Papier gebrachte Wolken zu einem seltsamen Ungetüm. Angesichts dieses verstörenden Gebildes verblasst sogar der leuchtende Regenbogen.
»Was ist das?« Priska deutet auf einen gelbgrünen, länglichen Klecks, der sich zwischen dem Kopf ihres gemalten Abbilds und dem unheilvollen, schwarzen Wolkenturm befindet. Für Letzteren benötigt sie keine Interpretationsversuche von Dritten. Die monströsen Schemen sind ihr wohlvertraut.
»Das habe ich Eure Tochter auch gefragt.« Katja wirft nun ebenfalls einen Blick aus dem Fenster. Dieser heftet sich auf Elena, welche inzwischen unter einem Baum kniet und mit beiden Händen im Laub wühlt. »Sie meinte, das sei die Waldfee Esmeralda. Elena verfügt über eine sehr konkrete Vorstellung von ihrem Aussehen. Die Fee hat goldenes, langes Haar und blaue Augen und sie trägt immer ein grünes Kleid.«
Priska muss an ihre Illustration für das Märchenbuch denken. Hat Elena den Skizzenblock entdeckt und die blonde Fee mit den geheimnisvollen, weisen Augen in ihrer eigenen Phantasie zum Leben erweckt? Oder sind die vielen Parallelen nur das Ergebnis eines seltsamen Zufalls?
»Wie gesagt ist es nicht unüblich, dass Kinder in Elenas Alter Fiktion und Realität vermengen. Auch imaginäre Freunde sind ein klassisches Phänomen dieser Phase. Dies alles steht für eine gesunde Entwicklung und ein interessiertes Kind mit einem wachen und phantasiebegabten Geist.«
»Aber?« Luis, der die letzten Minuten schweigend das Treiben im Garten beobachtet und Elenas Zeichnung nur eines kurzen Blickes gewürdigt hatte, lehnt sich, offensichtlich alarmiert durch Katjas sonderbaren Unterton, ein wenig nach vorne. In dieser Position wirkt seine lange Gestalt noch deplatzierter auf dem niedlichen Zwergenstuhl.
»Was mich beunruhigt, ist die Verbissenheit, mit der Elena das Ganze angeht. Sie ist davon überzeugt, dass sie die Fee um jeden Preis herbeirufen muss, um großes Unglück von Euch allen abzuwenden. Wann immer sich ihr die Gelegenheit bietet, versucht sie, Esmeralda mit Arrangements von Zweigen, Fichtenzapfen, Kastanien und Schneckenhäusern anzulocken. Am liebsten drapiert sie ihre Requisiten an den Rändern von Wasserstellen und Pfützen. Ihre Kunstwerke beschützt und verteidigt sie, als seien sie der heilige Gral. Ein schiefer Blick und sie fährt ihre Krallen aus. Sie ist nahezu besessen davon, Esmeralda beschwören zu müssen. Und sie setzt sich dabei extrem unter Druck. Dauernd plappert sie davon, dass sie nicht genügend Zeit hat. Im Frühling sei es viel einfacher, Esmeralda aufzuspüren, da sie alle Arten von Blumen liebe, aber so lange könne sie nicht warten.«
Priska und Luis hängen gebannt und zugleich fassungslos an Katjas Lippen.
»Wie lange spricht sie schon von Esmeralda? Uns gegenüber hat sie dieses Wesen bisher noch nicht erwähnt.« Noch während Priska die Frage stellt, versichert sie sich mittels eines kurzen Blicks auf Luis, dass auch er heute zum ersten Mal von der ominösen Fee hört. Er hebt abwehrend und kopfschüttelnd beide Hände. Priska kann ihm deutlich ansehen, dass er inzwischen eindeutig genug hat von dem ganzen Hokuspokus.
»Erst seit ein paar Tagen.« Katja seufzt. »Ich weiß, dass das alles starker Tobak ist. So eine komplexe Welt aus imaginären Freunden ist mir bisher auch noch nie untergekommen.« Sie macht eine kurze Pause. »Eleonore und Esmeralda sind nicht die Einzigen. Es gibt da noch jemanden. Und der hat Elena wohl verboten, auf eigene Faust Kontakt mit der Fee aufzunehmen.«
Die Kindergärtnerin tippt auf den gezeichneten Luis.
»Wie soll ich ihr etwas untersagen, von dem ich gar nichts weiß«, fragt der echte Luis.
»Der Mann auf dem Bild bist nicht Du«, erwidert Katja.
Im gleichen Moment sieht Priska, dass Elena mit Liebe zum Detail gearbeitet hat. Die Augen der männlichen Figur sind blau und nicht grün. Die Haare blond statt schwarz. Wieso war ihr das nicht gleich aufgefallen?
Sie hält den Atem an und hört den Namen bereits, bevor er Katjas Mund verlässt: »Das ist Ranieri.«
Noch ein Stuhl, dessen Lehne an diesem Tag stürmisch Bekanntschaft mit dem Fußboden schließt. Priska kann sogar verstehen, dass ihr Mann wütend ist. Und sie weiß, gegen wen sich sein Zorn richtet. Als hätte er ihre Gedanken gelesen, blafft er sie an: »Siehst Du, was du angerichtet hast? Ich werde da jetzt nicht mehr länger tatenlos zusehen. Das ist definitiv ein Fall für den Psychologen.«
Katja reagiert mit wissenschaftlicher Neugier statt mit solidarischer Empörung. »Heißt das, Ranieri begegnet Euch heute nicht zum ersten Mal?«
»Nein, ich … ähm … kenne ihn schon länger«, antwortet Priska leise.
»Normalerweise neigst Du nicht zu solchen Untertreibungen«, lacht Luis humorlos. Dann wendet er sich an Katja: «Ranieri ist Priskas verstorbene Jugendliebe. Dass ich mich irgendwann mit toten Exfreunden herumschlagen muss, hat mir vorher auch keiner gesagt.«
»Deinen kindischen Sarkasmus kannst Du Dir sparen, Luis.« Zielgerichtet hat ihr Mann erneut die falschen Knöpfchen gedrückt. Priskas Körper mag auf Sparflamme köcheln, nicht aber ihre Wut.
Katja, ihrerseits routiniert und souverän im Umgang mit bockigen Kindergartenkindern, zeigt sich ungerührt von Luis und Priskas gegenseitigen Anfeindungen: »Interessant. Offensichtlich habe ich mit meinen bisherigen Erkenntnissen die Spitze eines Eisbergs touchiert. Übrigens wollte ich auch schon vorschlagen, dass wir eine Kinderpsychologin einschalten.«
»Ich glaube, Luis hatte eher an einen Psychologen für mich gedacht«, entgegnet Priska bitter.
»Das ließe sich ja gegebenenfalls miteinander verbinden«, antwortet Katja prompt. Priska fängt einen triumphierenden Blick von Luis auf. Sie kommt sich vor wie im falschen Film. Jede einzelne Faser in ihr sträubt sich gegen weitere Sitzungen beim Psychotherapeuten. Im Rahmen ihrer Insomnieproblematik hat sie eine regelrechte Odyssee an Therapien hinter sich gebracht. Und keine davon hat ihr bisher auch nur ansatzweise weitergeholfen. Gleich, ob es sich um verhaltens- oder tiefenpsychologisch orientierte Verfahren handelte. Um des lieben Friedens Willen versucht sie jedoch, versöhnlich zu erscheinen: »Ok, probieren wir es. Kannst Du uns jemanden empfehlen?«
Katja reicht ihr eine Visitenkarte. »Diplompsychologin Sarah Falkner – Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.« Die Skepsis steht Priska ins Gesicht geschrieben.
»Ich denke, Ihr werdet sie mögen. Elena und Du. Sie ist wirklich gut.« Obwohl Katja sich um einen neutralen Tonfall bemüht, entgeht Priska nicht das Drängen in der Stimme der Kindergärtnerin. Sie ist sich darüber im Klaren, dass sowohl Elenas »imaginäre Freunde« als auch die Zwistigkeiten mit Luis auf Außenstehende befremdlich, ja, sogar besorgniserregend wirken. Doch Priska bezweifelt, dass sich die Therapeutin mit der Art von Dämonen auskennt, die sie Nacht für Nacht umtreiben. Angesichts der Absurdität dieses Unterfangens muss sie laut auflachen. Sie erntet einen verwunderten Blick von Katja und einen verärgerten von Luis.
Während Priska hinter Luis und Elena hertrottet, die Hand in Hand zum Parkplatz laufen, wandern ihre Gedanken nochmals zu dem Gespräch von eben und zu Elenas Zeichnung zurück. Katja lag noch mehr auf dem Herzen. Insbesondere die »Bedrohung«, die Elena in Form der schwarzen Wolke in ihrem Bild verewigt hat, wollte sie genauer analysieren. Luis Unwillen und der Mittagsgong machten ihr Vorhaben jedoch zunichte. Daher waren sie so verblieben, dass sie die Zeichnung, die Priska nun zusammengerollt in ihrer Rechten hält, mit der Psychologin eingehend besprechen werden..
Mann und Tochter warten bereits auf sie und vertreiben sich die Zeit damit, sich gegenseitig um das Auto herum zu jagen. Priska kann kaum glauben, dass dies derselbe Luis ist, der noch kurze Zeit vorher einem Eisblock hätte Konkurrenz machen können. Jetzt, in diesem Moment, ist er wieder jener warmherzige Mensch, den Priska kennen und lieben gelernt hat. Die kühle Distanziertheit, mit der er sie heute mehrmals abgestraft hat, kommt beinahe seelischer Grausamkeit gleich und ist für sie viel weniger greifbar und aushaltbar als etwa ein ausgewachsener Tobsuchtsanfall. Aber Luis neigt im Gegensatz zu ihr selbst nicht zu Wutausbrüchen.
Das Wasser ist fast zu heiß. Die gläserne Wand der Duschkabine sieht bereits aus wie Milchglas. Doch der warme Regen, der beruhigend auf sie einprasselt, sie umhüllt und zugleich den gesammelten Schmutz dieses unerfreulichen Tages von ihr abwäscht und den Ausguss hinunterspült, ist genau das, was Priska jetzt braucht. Gerötete Haut und Schrumpelfinger, wie Elena die aufgeweichten Fingerkuppen gerne nennt, nimmt sie dabei gerne in Kauf. Die latenten, durch die hohe Wassertemperatur hervorgerufenen, Kreislaufprobleme, empfindet Priska sogar als wohltuend – gehen sie doch mit einem tiefen Gefühl der Entspannung einher.
Ein leises Geräusch holt Priska aus ihrer Trance und durch die beschlagene Scheibe sieht sie gerade noch, wie die Badezimmertür sachte zuklappt. Sie wundert sich ein wenig, dass Elena oder Luis – sie weiß nicht, wer von beiden ihr einen heimlichen Besuch abgestattet hat, sie nicht angesprochen haben, doch sie denkt nicht weiter darüber nach.
Als sie aus der Dusche steigt und zum Bademantel greift, hört sie, wie Elena in ihrem Zimmer, das sich direkt neben dem Bad befindet, lacht. «Unbeschwertes Kinderlachen ist ein Geschenk«, sinniert Priska glücklich. Sie schlingt sich ein großes Handtuch um die nassen Locken und hört, ein wenig gedämpft von ihrem improvisierten Turban, wie Elena ein ihr unbekanntes Liedchen anstimmt. Sie summt fröhlich mit und ruft dann durch die angelehnte Tür: »Elena, hast Du dieses Lied aus dem Kindergarten? Das ist wirklich schön!«
Drüben im Kinderzimmer ist es plötzlich still. Von einer Sekunde auf die andere sind Lachen und Singen verstummt.
»Elena?« Priska ruft nun lauter. Es sieht ihrer Tochter gar nicht ähnlich, dass sie sie sich tot stellt.
»Elena ist hier unten. Bei mir.« Luis Stimme kommt aus dem Wohnzimmer.
»Mama, wir müssen Dir etwas zeigen. Beeil Dich!« Ja, Elena befindet sich eindeutig in Luis unmittelbarer Nähe.
Priska stellt sich die Frage gar nicht erst. Ihr Kopf schreit bereits die Antwort. Und sie fürchtet sich. Hat Angst, dass gleich die Badezimmertüre aufschwingt und eine lächelnde Eleonore vor ihr steht. Ihr wird noch schummriger als ohnehin schon und kurzerhand setzt sie sich auf den Toilettendeckel hinter sich. Im Bad ist es so warm wie in einer Dampfsauna und trotzdem fröstelt Priska. Instinktiv zieht sie den Gurt des Bademantels etwas fester und fühlt sich dennoch schutzlos.
»Mama? Kommst Du?« Ihre Tochter wird langsam ungeduldig.
Priska fasst sich ein Herz, reißt die Tür auf und hetzt, ohne auch nur einen Blick in das benachbarte Zimmer zu werfen, barfuß die Treppe hinunter. Das Handtuch fällt von ihrem Kopf und ihr noch immer klatschnasses Haar hinterlässt Rinnsale auf ihrem Körper und kleine Pfützen auf den Holzstufen. Irgendwo in ihrem Hinterstübchen amüsiert sich ein abgeklärtes Über-Ich darüber, wie lächerlich sie sich benimmt. Doch das ist ihr herzlich egal. Ihr Fluchtinstinkt walzt jeden rationalen Gedankenfunken platt.
Luis und Priska starren sie entgeistert an. Dennoch hat sie das Gefühl, dass die verstörten Gesichtsausdrücke nicht nur ihrem seltsamen Auftritt zuzuschreiben sind.
Luis öffnet den Mund, doch er fragt nicht »Was zum Teufel ist in Dich gefahren?«, sondern: »Kennst Du dieses Foto? Das lag auf dem Esstisch, als wir vorhin heimgekommen sind.«
Er hält ihr eine vergilbte und etwas zerknitterte Schwarz-Weiß-Aufnahme entgegen. Eine innere Vorahnung will Priska davon abhalten, das Foto zur Hand zur nehmen. Doch sie ist zu überrumpelt.
Bevor der Schock droht, sie an den Rand einer Ohnmacht zu katapultieren, brennt sich das unheimliche Bild gnadenlos auf ihre Netzhaut: Ein kleines Mädchen sitzt auf einem mit einem geblümten Überwurf ausgestatteten Sessel. Es trägt ein Kleid mit einem gerüschten Saum und Riemchensandalen. Das Haar ziert eine große Schleife und im Arm hält sie eine Porzellanpuppe, deren starrer Blick dem des Mädchens in Nichts nachsteht. Priska weiß, wen sie da vor sich hat, auch wenn sie Eleonores Gesicht noch nie zuvor gesehen hat. Im Gegensatz zu Elenas Zeichnung lächelt sie nicht. Ihr Antlitz scheint wächsern, was jedoch an der alten Aufnahme liegen könnte, die allein schon durch die Sepiatöne und die lange Belichtungsdauer verwaschen und gespenstisch wirkt.
»Ich muss mich setzen«, murmelt sie.
»Werde ich jemals wieder schlafen können?«, denkt sie.
»Kennst Du das Bild?«, wiederholt Luis seine Frage. Trotz ihrer Benommenheit spürt sie seinen forschenden Blick.
»Nein«, entgegnet sie mit dünner Stimme. »Aber ich weiß, wer das Mädchen ist.«
»Ja, das ist Eleonore«, ergänzt Elena im Plauderton. »Aber in Wirklichkeit sieht sie nicht so komisch aus.«
In Wirklichkeit. Priska schlägt zitternd die Hände vor dem Gesicht zusammen. Das alles wächst ihr definitiv über den Kopf. Und Luis, ihr Fels in der Brandung, kann und will ihr nicht in diese erschreckende Welt folgen, die sich langsam aber sicher über ihre gewohnte Realität stülpt und auch vor ihrer Tochter nicht Halt macht.
Als die Decke über ihr knarzt, zuckt sie zusammen. Sie spürt, wie das Blut in ihren Ohren rauscht. »Das Holz arbeitet«, würde Luis normalerweise sagen. Doch gerade schweigt er. Sie alle halten den Atem an. Knarrende Geräusche sind hier für sich genommen nicht ungewöhnlich. Aber in eben diesem Augenblick können sie sich nicht mit Harmlosigkeit tarnen. Am liebsten würde Priska schreiend aus dem Haus laufen.
»Ich muss auf`s Klo.« Elena durchbricht die angespannte Stille und hüpft vom Sofa. Priska erhebt sich bereits, um mit ihr zu gehen. Irgendwie ist ihr unwohl bei dem Gedanken, dass ihr Kind ohne – lebende – Begleitung den Raum verlässt, doch Luis hält sie zurück.
Als Elena außer Hörweite ist, raunt er Priska zu: »Du weißt, dass das eine post- mortem-Aufnahme ist? Ich sehe dergleichen nicht zum ersten Mal.«
»Nein, das wusste ich nicht.« Die Augen des toten Mädchens verfolgen Priska, bis sie bewusstlos in Luis Armen zusammensackt. »Es gibt kein Entrinnen«, flüstert eine Stimme in ihrem Kopf. Dann wird alles schwarz.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  05.06.2016 01:03 05.06.2016 01:03
von Federfarbenfee
|
 |
|
An anderer Stelle hatte ich erwähnt, dass im neunten Kapitel gefühlte tausend Mal von den violetten Augen die Rede war. Inzwischen habe ich die häufigen Wiederholungen hoffentlich weitestgehend ausgemerzt.
Viele Grüße an alle, die sich hierher verirren und eine gute Nacht!
Kapitel 9: Dora
Eva konnte weder ihn, noch sich selbst täuschen. Sie hatte Angst. Vor der eigenen Tochter. Denn trotz allem war sie das: Ihr Kind. Sie hatte Dora unter dem Herzen getragen und sie zur Welt gebracht. Seit acht Jahren war sie dem Mädchen eine wundervolle Mutter. Johann hegte keinen Zweifel daran, dass Eva ihre Tochter inniglich liebte. Doch war ihm nicht entgangen, wie sie Dora ansah. Er spürte Evas Unwohlsein, wenn sie gezwungen war, mit ihr alleine zu sein. Zudem sorgte sich seine Frau wegen des Getuschels im Dorf. Obgleich sie es nie zugeben würde, teilte sie insgeheim die Meinung der tratschenden Weiber.
Nachdenklich betrachtete Johann seine Tochter, die neben ihm, auf dem von der Sonne vorgewärmten Steinwall saß. Arglos lächelte sie ihn an. Die goldenen Sprenkel in ihren violetten Augen leuchteten und die gebräunten Kinderbeine baumelten über saftigem Grün. Die Ziegen grasten zufrieden und auch Dora wirkte glücklich. Eine reine Kinderseele, wie sie unschuldiger nicht hätte sein können. Er fragte sich, was die Aufmerksamkeit der Leute erregt haben mochte. Dora verhielt sich in Gegenwart von Fremden stets unauffällig. Abgesehen von ihrer sonderbaren Augenfarbe unterschied sie sich nach außen hin nicht von ihren Altersgenossen. Gleichwohl redeten die Leute. Hinter vorgehaltener Hand munkelten sie, sein kleines Mädchen sei eine Hexe. Johann plagte das schlechte Gewissen. Es verging kein Tag, an dem er sich nicht fragte, ob es klug gewesen war, jenen Pakt einzugehen, von dem nur er und Eva wussten. SIE war keine Hexe. SIE diente weder Gott noch Teufel.
Eine dunkle Vorahnung umwaberte ihn. Sein Blick wanderte zu den schwarzen Wolken, die sich weiter oben, an den schroffen Felstürmen des Rosengartens, zusammenbrauten. Ein bedrohliches und zugleich faszinierendes Bild. Sie befanden sich gute tausend Höhenmeter unterhalb. Lediglich der leise Wind, der durch die Blätter der vereinzelten Buchen rauschte, die hier oben noch der Kälte trotzten, kündete von dem aufziehenden Unwetter.
»Sieh nur, Vater.« Dora strich eine haselnussbraune Strähne aus ihrem Gesichtchen und deutete auf zwei schwarze Scheren, die sich aus den Mauerfugen schälten. Der Skorpion war nicht groß. Von Kopf bis Stachel maß er höchstens vier Zentimeter. Nicht giftiger als eine ordinäre Wespe.
»Ein hübsches Tier«, flüsterte Dora andächtig. Schon streckte sie die Finger aus, um den dunklen Panzer zu berühren.
»Reiz ihn nicht, Dora!« Johann ergriff die Hand seiner Tochter und zwang sie, inne zu halten. Schönheit lag zweifelsohne in den Augen des Betrachters. Doch ein Skorpionstich war eine schmerzhafte Erfahrung, die er seinem Kind gerne ersparen wollte.
Der Skorpion verharrte einige Sekunden regungslos an Ort und Stelle. Als wartete er auf ein Zeichen. Auch Dora wirkte angespannt. Ihr Blick war entschlossen. Die Zeit selbst schien den Atem anzuhalten. Plötzlich kam Leben in das Tier. Zielstrebig krabbelte es auf Dora zu, hob dabei die Zangen und rollte seinen Stachel nach oben. Johann traute seinen Augen nicht. Der Skorpion ging zum Angriff über. Lag es an dem heraufziehenden Gewitter? Insekten waren in der Ruhe vor dem Sturm ungewohnt aggressiv. Dora zeigte jedenfalls keinerlei Anstalten, der Attacke aus dem Weg zu gehen. Sie glich einer lauernden Katze – ihre Beute im Visier. Johann versuchte, sie von der Mauer zu ziehen, doch Dora war schneller. Behände riss sie sich aus Johanns Umklammerung. In einer fließenden Bewegung pflückte sie den Skorpion von den warmen Steinen, führte ihn zum Mund und trennte mit einem beherzten Biss den Körper vom Giftstachel. Die Spitze zuckte kurz, bevor sie ins Gras fiel, doch Dora schien unversehrt. Der Panzer knackte, als sie ihn zermalmte und die Überreste des Spinnentieres genüsslich verspeiste. Sowohl der groteske Anblick als auch das knirschende Geräusch ließen Johann zusammenfahren.
»Warum hast du das getan«, flüsterte er heiser.
»Er wollte mir weh tun.« Der Augenaufschlag unter den dichten Wimpern war der eines Engels. Dennoch spürte Johann, wie sich die feinen Härchen in seinem Nacken aufstellten. Zum ersten Mal fragte er sich, ob seine Tochter das unschuldige Kind war, das sie vorgab, zu sein. Sogleich schalt er sich für diesen Gedanken und erstickte ihn im Keim. Doch die Saat war ausgebracht und sein verwirrter Geist bildete einen fruchtbaren Nährboden.
Der Wind hatte an Stärke zugenommen. Er ließ die Glockenblumen tanzen, kämmte das Gras und zerzauste Doras Locken. Die Ziegen horchten auf. Helle Blitze schossen aus dem schwarzen Himmel über dem Rosengarten und tauchten die zackigen Felsen in ein gespenstisches Licht. Sie mussten aufbrechen. Die Gewitterfront schob sich unaufhaltsam in ihre Richtung. Auch das Donnergrollen rückte näher.
Johann spürte, dass Dora ihn beobachtete. Er wandte sich ihr zu und erschrak. Durch dunkel umwölkte Augen hindurch starrte SIE ihn an. Eine Seele, so alt wie die Erde, bediente sich des Körpers seines geliebten Kindes. Johanns Verstand konnte noch immer nicht fassen, was das Herz längst begriffen hatte. Dora war eins mit IHR und dem bleichen Berg. Staub aus seinem Fels. IHR Geist und Johanns Fleisch und Blut. Miteinander verwoben auf ewig.
»Vater, warum siehst Du mich so seltsam an?« Die Kleinmädchenstimme riss ihn aus seinen Gedanken. Ihre violetten Augen musterten ihn unsicher. Keine Schatten mehr, die sie verdunkelten. Johann zog das Kind an sich und strich ihm zärtlich über die seidigen Locken. Dora schlang ihre Arme um seinen Hals und presste das weiche Gesichtchen an seine stachelige Wange.
»Du bist meine Sonne. Ich liebe Dich mehr als alles auf der Welt.« Johann atmete tief ein und sog den Duft ihres Haars in sich auf. Ihr Herz hämmerte gegen seine Brust. »Aber ich mache mir Sorgen.«
»Ich bin nicht wie die anderen, oder?« Ihr warmer Atem kitzelte sein Ohr.
»Wie meinst Du das?« Würde sie nun bestätigen, was seine Augen und sein Gefühl ihn glauben machten?
»Die anderen Kinder haben Angst vor mir. Und ich glaube, sie können es nicht.«
»Was können sie nicht?« Johann fühlte das Blut durch seine Adern rauschen. In seinem Kopf summte es eigenartig.
»Wenn ich etwas sehe und ganz fest daran denke, dann macht es das, was ich will.«
»Ich verstehe nicht«, sagte Johann. Dabei wusste er sehr wohl, wovon seine Tochter sprach. Er war weder blind noch taub.
»Der Skorpion vorhin. Ich hätte mir wünschen können, dass er sich selbst tötet. Das ist leicht. Aber ich wollte ihn essen.«
Trotz der Wärme, die ihr zarter Körper ausstrahlte, fröstelte Johann. Sein dröhnender Schädel ließ ihn keinen klaren Gedanken fassen.
»Hörst Du sie flüstern?« Dora hob ihren Kopf. Sie erinnerte Johann an ein Tier, das soeben Witterung aufgenommen hatte. Er schauderte. Zögernd schüttelte er den brummenden Kopf. »Von wem sprichst Du?«
»Die Stimmen.« Dora lauschte angespannt und wand sich aus Johanns Armen. Sie richtete sich auf und blickte ihren Vater ernst an. »Sie wollen mich warnen.«
»Wovor?« In jene Welt konnte Johann seiner Tochter nicht folgen. Zwar hatte sie damals ihre Pforten einen Spaltbreit geöffnet und das Unfassbare durch die schmale Öffnung schimmern lassen. Doch er hatte nur einen kurzen Blick darauf werfen könne. Allein dieser reichte aus, ihn zu verstören und die Angst vor dem Tod zu schüren, statt sie zu nehmen.
»Vor den Menschen.« Die Antwort war nur ein Wispern. So leise, dass Johann einen Atemzug lang überlegte, ob er sich verhört hatte. In diesem Augenblick zuckte direkt über ihnen ein Blitz und färbte den Himmel gelb. Kurz darauf folgte polternd der Donner. Das Gewitter hatte sie erreicht. Johanns Blick schweifte nervös und ziellos umher. Obgleich es unnötig war. Die Umgebung war ihm ebenso vertraut wie das Innere seiner Westentasche. Kein Unterstand weit und breit.
»Vater, Du musst keine Angst haben. Das Unwetter kann uns nichts anhaben.« Doras ruhige Stimme beendete Johanns rast- und sinnlose Suche. Die ersten Tropfen fielen auf sie herab. Kleine Rinnsale schlängelten sich über ihr anmutiges Puppengesicht. »Der Donner und der Regen. Sie sind Musik. Lassen meinen Körper schwingen und klingen.« Dora lächelte und verdrängte damit Johanns Impuls, sie in Sicherheit bringen zu wollen. Nicht sie musste gerettet werden, sondern er. Neben ihnen zerriss ein weiterer gleißender Blitz das Firmament. Der Krach war ohrenbetäubend. Nur wenige Meter von ihnen entfernt hatte das Himmelsfeuer eine Fichte in eine zehn Meter hohe Fackel verwandelt. Dora lächelte noch immer.
Es hatte schon weitaus schlimmere Unwetter gegeben, die sich eine Freude daraus machten, das Dorf in die Mangel zu nehmen und es kräftig durchzuschütteln. Es dauerte nicht lange und der Sturm zog weiter. Die graue Regenwand im Schlepptau. Als die Sonne erneut ihre Strahlen aussandte und die Vögel zaghaft ihre Melodien wieder aufnahmen, kamen auch die Menschen aus ihren Häusern, um die Spuren der Verwüstung zu beseitigen, soweit es ihre begrenzten Mittel zuließen. Die Bergwelt wirkte reingewaschen. Schneebedeckte Gipfel erhoben sich vor einem kobaltblauen Hintergrund. Nasses Grün leuchtete im goldenen Licht. Johann atmete frische, klare Luft, als er mit Dora und den Ziegen den Weg zu ihrem kleinen Gehöft emporstieg. Durchnässt bis auf die Knochen, aber wohlbehalten kehrten sie nach Hause zurück. Sein Verstand konnte ihm nicht erklären, wie sie es geschafft hatten. Doras nackte Fußsohlen tanzten vor ihm über den von Dreck umspülten Schotter. Neben ihnen waren Bäume umgestürzt. Unter ihnen hatten Sturzbäche die Pfade in rutschigen Morast verwandelt und über ihnen war das Poltern und Klackern unzähliger Steinschläge zu hören gewesen. Nicht nur einmal war ihnen zusätzlich zum Wind ein Geröllhagel um die Ohren gepfiffen. Es grenzte an ein Wunder, dass sie ohne den kleinsten Kratzer davongekommen waren. Oder? Johanns Herz wusste und es trug schwer. Die Leute hoben ihre Köpfe und sahen ihnen nach. Er spürte ihre misstrauischen Blicke im Rücken.
Eva erwartete sie bereits. Die Sorge in ihrem Gesicht wich Erleichterung, als sie Mann und Kind erblickte. Ihr Kuss war warm und Johann bildete sich ein, dass in ihren braunen Augen doch noch ein Funken Liebe für ihn glomm. Er sah zu, wie Eva ihre Tochter an ihre Brust drückte und beide in einer innigen Umarmung verharrten. Das Mädchen schien die Zuneigung der Mutter förmlich in sich aufzusaugen. Wie ein Äffchen hing es an Evas Hals. Johann zweifelte nicht daran, dass auch Dora die Furcht spürte, die ihre Mutter ihr gegenüber empfand. Umso mehr genoss sie die intensive Zuneigung, die ihre gerade zuteil wurde. »Könnte es doch nur immer so sein«, dachte Johann wehmütig.
Sie schlüpften in trockene Kleidung und wärmten sich am Kachelofen. Anschließend machte sich Johann daran, das Gatter vom Ziegenstall, das der Sturm aus den Angeln gehoben hatte, neu zu befestigen. Währenddessen sammelte Eva Fallobst und Reisig auf. Dora fegte den Hof.
»Sieh an! Die Dora mit dem Besen. Magst Du uns zeigen, wie Du darauf reitest? Ihr Hexen habt das doch im Blut!« Ein flachsblonder Schopf tauchte hinter der Steinmauer auf, die um das gesamte Grundstück herumführte. Es war Sophie vom Nachbarshof. Aufgeschreckt hoben Eva und Johann die Köpfe und unterbrachen ihre Arbeiten. Dora stand wie eine Statue mitten auf dem Platz und hielt den Besenstiel fest umklammert. Da Dora Johann den Rücken zuwandte, konnte er das Gesicht seiner Tochter nicht sehen. Das Sopherl ließ keine Gelegenheit aus, um Dora zu traktieren. Liebend gerne hätte er dem gemeinen Nachbarsbalg die Zöpfe langgezogen. Er kam hinter dem Schuppen hervor und hoffte, dass seine Gegenwart bereits ausreichte, um die kleine Göre zum Schweigen zu bringen. Doch Sophie dachte nicht daran, ihr Schandmaul zu halten.
»Dora komm und reite für uns auf Deinem Besen«, sang sie und balancierte die Mauer entlang. Weiter unterhalb ertönte Gekicher. Sophie war nicht alleine unterwegs. Sie und die Burschen vom Kofler Josef waren wie Pech und Schwefel. Wo der eine sich aufhielt, konnten auch die anderen nicht weit sein.
»Verschwinde, Du missratene Dirn! Oder es setzt was!« Johann fuchtelte drohend mit seinem Hammer, doch Sophie lachte nur.
»Du kannst mir gar nichts! Wenn Du mich anrührst, werde ich es sofort dem Vater erzählen und der hetzt das ganze Dorf auf Dich und Deine Hexe!«
Johann schnaubte vor Wut, doch er zweifelte keinen Augenblick daran, dass Sophie ihre Drohung wahrmachen würde. Fieberhaft überlegte er, was diese Plage dazu bringen mochte, sich von seinem Hof zu scheren. Da ergriff Dora das Wort:
»Mach, dass Du wegkommst! Du und Dein Vater werden es sonst bereuen!« Sie erhob ihre Stimme gerade so weit, dass Sophie sie und die unmissverständliche Warnung in ihren Worten verstehen konnte. Doras Aufforderung brachte Sophie kurz aus dem Takt. Irritiert musterte sie das versteinert wirkende Antlitz ihrer Altersgenossin. Johann war nun bei seiner Tochter angelangt und hatte ihr die Hand auf die Schulter gelegt. Besorgt studierte auch er Doras Gesicht, das keinerlei Gefühlsregung zeigte. Nur am Rande nahm er Notiz von dem herannahenden Hufgetrappel. Sophie hatte inzwischen ihre Fassung wieder zurückerobert und stemmte herausfordernd die Hände in die Hüften.
»Du willst mir drohen, Hexe? Denkst Du wirklich, ich habe Angst vor Dir?« Sophie legte den Kopf in den Nacken und wieherte wie ein Pferd. Ihre Kumpanen, die es sich inzwischen ebenfalls auf der Mauer gemütlich gemacht hatten, stimmten augenblicklich in das Gelächter mit ein.
»Ja. Wenn Du wirklich glaubst, dass ich eine Hexe bin, dann tätest Du gut daran, Dich zu fürchten.« Dora verzog keine Miene. Doch ihre Pupillen weiteten sich. Johann warf einen Blick zu seiner Frau hinüber. Eva war kreidebleich.
»Ich sage es Dir ein letztes Mal: Geh!« Scharf durchschnitt Doras Stimme die Luft. Erneut war ein leichter Wind aufgekommen. Er ließ die Blätter zu ihren Füßen und ihre braunen Locken tanzen. Abermals hielten die Vögel in ihren Gesängen inne. Dafür war das Donnern der Pferdehufe umso deutlicher zu hören. Der Reiter schien es eilig zu haben. Sophie kümmerte sich nicht darum. Sie bleckte ihre breite Zunge, tanzte im Kreis und trällerte:
»Du wirst auf dem Scheiterhaufen brennen, Du dummes Ding und ich werde dabei…« Sie kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Inmitten einer übermütigen Drehung rutschte das Standbein unter ihr weg. Johann sah die Todesangst in ihrem Blick, doch er war wie gelähmt. Die nackte Fußsohle glitt über die nassen Steine und Sophie verlor das Gleichgewicht. Mit einem gellenden Schrei fiel sie rückwärts von der Mauer. Nur ein Narr würde es dem Zufall in die Schuhe schieben, dass in eben diesem Augenblick das Pferd und sein verhüllter Reiter vorbeischossen. Sophies Schreie steigerten sich zu einem ohrenbetäubenden Gebrüll, als ihr Körper von den rasenden Hufen zertrampelt wurde. Müßig die Frage, warum das Pferd nicht rechtzeitig gescheut hatte und ausgewichen war. Ross und Reiter schienen wie vom Erdboden verschluckt. Sie hatten sich noch schneller in Luft aufgelöst, als sie auf der Bildfläche aufgetaucht waren.
Die beiden Knaben kicherten nicht mehr. Sie hingen über der Mauer und übergaben sich schwallartig und in hohem Bogen. Dora stand immer noch da wie eine in Stein gemeißelte Figur. Johann schüttelte sie leicht, doch sie rührte sich nicht. Unweit von ihnen ertönte ein Ächzen. Eva war zusammengebrochen. Johann eilte zu ihr. Sie war bei Bewusstsein. Zitternd umklammerte sie ihres Mannes Arm. Ihr Mund formte drei Worte, deren Bedeutung sich Johann erst Minuten später erschloss: »Ich bin schwanger.«
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  31.07.2016 23:51 31.07.2016 23:51
von Federfarbenfee
|
 |
|
Ich habe mir Eure Tipps zu Herzen genommen und möchte heute die Kapitel 10 und 11 einstellen. Vielleicht mag der ein oder andere mir kurz Feedback geben, ob sich der Lesefluss verbessert hat. Mir ist bewusst, dass ich in der letzten Zeit nur sporadisch zugegen war. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dafür nicht abgestraft werde.  Eure Kritik weiß ich nämlich sehr zu schätzen und danke Euch dafür schon im Voraus! Eure Kritik weiß ich nämlich sehr zu schätzen und danke Euch dafür schon im Voraus!
Kapitel 10: Zwischen Wahn und Sinn
»Elena, wo willst du mit meiner Orchidee hin?«
»Esmeralda braucht sie.«
Priska legt einen beherzten Sprint ein, doch das Kind ist bereits durch die Tür entschwunden. Den Blumentopf mit der hochsensiblen Miltonia moreliana unterm Arm. Die Pflanze war ein Geschenk gewesen. Prikas Qualitäten als Blumenflüsterin sind nur rudimentär ausgeprägt. Dennoch hatte sie sich sofort in die Orchidee mit den zart lila Blüten und dem anspruchsvollen Pflegebedürfnis verliebt. Tatsächlich schaffte es die fragile Schönheit, in Priskas Obhut zu überleben und zu sogar zu blühen. Bis jetzt.
Kaum hat Priska die Tür erreicht, fällt diese mit Schwung ins Schloss. In der Luft schwebt ein glockenhelles Kinderlachen. Ein leichter Luftzug streift kühl ihre Wange. Sie verschränkt fröstelnd die Arme. Wie hatte sie bloß Elenas glucksendes Gekicher mit dem Lachen des Geistermädchens verwechseln können. Nur scheinbar schwerelos ist es. Weht aus einem anderen Jahrhundert zu ihr hinüber und trägt des Todes Odem mit sich. Weitaus verstörender als das wächserne Gesicht auf der Fotografie.
»Ja, dieses Bild wurde eindeutig post mortem aufgenommen.« Die wachen Augen über der Lesebrille hatten interessiert dreingeblickt. Nicht ängstlich. In jenem Moment beneidete Priska Hans um seine wissenschaftliche Distanz. »Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass die Augen auf die geschlossenen Lider aufgemalt wurden.« Luis beugte sich prompt über das vergilbte Foto. Priska hingegen war schon mit ihrem Kopfkino mehr als ausreichend bedient. Der Kloß in ihrem Hals drückte ihr fast die Luft ab. Hans musterte sie nachdenklich über den Brillenrand hinweg. Dann fuhr er fort: »Im 19. Jahrhundert war es durchaus üblich, Kinder kurz nach ihrem Tod zu fotografieren. Oft sogar im Kreise der Familie. Die finanziellen Mittel reichten meist nicht aus, um die Angehörigen zu Lebzeiten abzulichten. Solche Totenbilder waren immerhin ein kleines Andenken an den geliebten Menschen. Daher waren wohl Aufnahmen, welche die Verstorbenen lebendig wirken ließen, besonders beliebt. Auf dem Foto hier wollte man die Lebendigkeit durch die scheinbar offenen Augen vortäuschen.«
Priska hatte das Gefühl, jemand würde ihr mit einer heißen Klinge in die Eingeweide schneiden. Sie konnte sich keinen größeren Schmerz vorstellen als den, das eigene Kind zu verlieren. Aber wie sollte jenes makabre Ritual dabei geholfen haben, die Wunden zu schließen und die Trauer zu verarbeiten? Hatte der Blick auf dieses starre, maskenhafte Antlitz den Eltern tatsächlich Trost gespendet? Ja, der tote Körper saß dort auf dem Stuhl, aber die Seele hatte ihn längst verlassen. Was war Eleonores Geist? Ein Nachhall ihres irdischen Lebens? Eine Art energetischer Fingerabdruck? Oder wahrhaftig ihre ruhelose Seele auf der Suche nach Erlösung? In Priskas Kopf türmten sich die Fragen, in ihrem Hals und Bauch Klumpen aus Angst und Mitgefühl.
»Also, stammte dieses Mädchen aus eher ärmlichen Verhältnissen? Hast Du eine Vorstellung davon, wann und wo das Bild entstanden ist?« Luis, Pragmatiker durch und durch, setzte andere Prioritäten im Hinblick auf die Fragen, mit welchen er seinen ehemaligen Professor für neuere Geschichte bombardierte.
»Nun, reich war die Familie wohl nicht. Die Kleidung erinnert an eine bäuerliche Tracht.« Hans rückte die Brille auf seiner Nase zurecht und studierte das Foto mit gerunzelter Stirn. »Scheint eine Art Dirndl zu sein. Sie trägt eine Schürze. Spontan würde ich auf die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts tippen. Vor allem die dunklen Töne und der hochgeschlossene Kragen sprechen dafür. Zum Ort kann ich leider nichts sagen.«
»Auf der Rückseite sind ein paar handschriftliche Zeilen vermerkt«, schaltete sich Priska in das Gespräch ein. Hans drehte das Bild um und Priska tippte auf den verblassten Text unten rechts. »Siehst Du? Das da sieht nach einem Datum und einer Ortsangabe aus: Leider sind die Worte viel zu verblichen, um sie zu entziffern.«
Hans hielt das Foto ans Licht. »Es gibt Verfahren, mit deren Hilfe die Schrift vielleicht wieder lesbar wird. Ich kenne ein Labor, das Erfahrung damit hat. Wenn es euch recht ist, reiche ich das Foto zur Analyse dort ein.«
Seit ein paar Tagen sitzt Priska nun auf glühenden Kohlen. Noch steht das Ergebnis aus. Während sie an der Haustüre rüttelt, versucht sie, das unheimliche Foto aus ihren Gedanken zu verbannen. Hier und jetzt hat sie es nicht mit der leblosen, körperlichen Hülle des Mädchens zu tun, sondern mit dem, was einst in ihr wohnte. Davon ist sie inzwischen überzeugt. Die Präsenz des Gespensterkindes ist deutlich zu spüren. Im Haus dürfte es um die einundzwanzig Grad haben. Trotzdem hat Priska klamme Finger und ihr Atem kondensiert an der Luft. Das Windspiel bewegt sich. Dabei hat sie die Tür noch nicht einmal einen Spalt weit aufbekommen. Sachte schlagen die silbernen Klangstäbe aneinander. Sie spielen eine eigenartige Melodie.
»Eleonore, bitte lass mich hinaus in den Garten!« Obwohl sie sich seltsam vorkommt, spricht sie das Geisterkind zum ersten Mal direkt an. Dabei bemüht sich um einen sanften und zugleich bestimmten Tonfall. Immerhin ist das Mädchen bei ihr und nicht in der Nähe ihrer Tochter, die wahrscheinlich gerade die Orchidee opfert, in der Hoffnung, Esmeralda zu beschwören. Elena hält sich häufig allein im Garten auf. Trotzdem drängt alles in Priska danach, zu ihrem Kind zu eilen. Unmittelbar neben Priska ertönt erneut das jenseitige Kinderlachen. Sie zuckt zusammen. »Das bilde ich mir doch nicht ein«, denkt sie. Luis Reaktion auf die Schilderung dieser bizarren Begebenheit kann sie sich lebhaft ausmalen. Besser, sie sagt gar nichts mehr dazu. Ihr Mann hat ohnehin eine besondere Begabung, in solchen Situationen mit Abwesenheit zu glänzen. Vielleicht lauern die Spukerscheinungen aber auch nur darauf, dass sie allein im Haus ist.
»Kannst du nicht mal zur Abwechslung Luis erschrecken?«, ruft sie über die Schulter, während sie sich mit ihrem gesamten Gewicht an die Türklinke hängt. Ihr ist bewusst, dass sie sich kindisch verhält, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie versucht, ihre Ängste mit beißendem Humor zu bekämpfen. Eleonore scheint nicht viel übrig zu haben für diese Art von Witz. Ihr eisiger Atem bläst Priska in den Nacken und verhöhnt sie. Priska fährt herum. Jede physische Konfrontation mit dem Geisterwesen fühlt sich an wie ein Stromschlag, der mit Lichtgeschwindigkeit durch ihren Körper jagt. Sie zittert so sehr, dass sie die Türklinke loslassen muss. Doch sie denkt nicht daran, sich von einem kleinen Mädchen schikanieren lassen.Ob tot oder lebendig.
»Jetzt mach endlich die verdammte Türe auf«, herrscht sie ihr unsichtbares Gegenüber an.
»Nein!«
Priska vernimmt nicht die Worte selbst, nur deren Echo, doch das ist deutlich genug. Es hüllt sie in eine bedrohliche Wolke aus negativer Energie. Erfordern trotzende Geisterkinder den gleichen Umgang wie jene aus Fleisch und Blut? Sie merkt, wie die Luft um sie herum zu wirbeln beginnt. Kleine, trappelnde Füße kreisen sie ein. Eleonore ist ihr nicht wohlgesonnen. Das spürt Priska deutlich. In Ranieris Gegenwart empfindet sie anders. Die Energie, welche von ihm ausgeht, ist nicht destruktiv. Die Aura, die Eleonore umgibt, hingegen schon. Diese Feststellung ängstigt Priska. Schließlich folgt Eleonore ihrem eigenen Kind wie ein Schatten. Wo ist Ranieri überhaupt? Sie könnte seine Unterstützung jetzt gut gebrauchen.
»Hier und doch weit fort.« Ein vertrautes, kaum hörbares Flüstern neben ihrem Ohr. »Ich kann nicht zu Euch gelangen. Ich stehe hinter dem Wasserfall und Ihr davor. Tosendes Rauschen übertönt Eure Worte und Gedanken und der dichte Vorhang verschleiert Euer Handeln.«
»Was heißt das? Bist Du in einer anderen Dimension? In einer anderen Dimension als Eleonore? Wie kann das sein? Ich habe doch gesehen, wie sie in Deine Arme gestürzt ist?« Kaum hat sie den letzten Satz ausgesprochen, fällt ihr ein, dass sie diese Beobachtung lediglich im Traum gemacht hat. Wobei das offensichtlich keine Rolle spielt. Seit Ranieri auf dem Plan erschienen ist, lösen sich die Grenzen zwischen Traum und Realität mehr und mehr auf. »Und was bedeutet, dass unsere Gedanken übertönt werden? Hast Du also doch telepathische Fähigkeiten?« Für einen Augenblick wird Priska sich gewahr, wie die Szenerie auf Außenstehende wirken muss. Wild gestikulierend führt sie abstruse Selbstgespräche. Manch einer würde sie wahrscheinlich sogar für schizophren halten. Du meine Güte, Priska hört Stimmen. Ab in die Klapse. Was würde wohl die Psychologin dazu sagen? Obwohl ihr nicht danach zumute ist, entfährt Priska ein heiseres Lachen. Die tapsenden Kinderfüße stehen still. Eleonore hält inne und lauscht. So scheint es.
»Du musst aufpassen, Priska. Sie sammelt Energie.« Ohne auf ihre Fragen einzugehen, die er offenbar nicht gehört hat, fährt er fort: »Du wirst sie bald sehen können. Sie manifestiert sich.«
»Ist sie bösartig?« Priska schämt sich beinahe, eine solche Frage im Zusammenhang mit einem kleinen Mädchen zu stellen, das zudem jedes ihrer Worte zu hören kann. Hinter ihr konzentriert sich die wirbelnde Luft. Ballt sich zusammen wie eine Windböe, die ihr in den Rücken drückt. Sie stemmt sich dagegen, um nicht über ihre eigenen Füße zu fallen. Dabei versucht sie, zu verdrängen, dass es eine Spukerscheinung ist, mit der sie in diesem Augenblick auf Tuchfühlung geht. Der gespenstische Wind gewinnt nochmals an Stärke und bäumt sich ein letztes Mal auf, bevor er plötzlich abebbt. Von einer Sekunde auf die nächste. Priska kann das Gleichgewicht nicht halten. Obwohl sie genau dies verhindern wollte, stürzt sie zu Boden. Ihre Hüfte quittiert den Aufprall mit einem schmerzhaften Stich.
»Nein. Nur eifersüchtig.« Ranieris Stimme ist nur mehr ein leises Vibrieren. »Konzentrier Dich auf die Tür, nicht auf sie.« Priska ist nicht sicher, ob sie ihn verstanden hat.
»Eifersüchtig? Worauf denn? Wie meinst Du das mit der Tür?« Sie horcht angespannt in die trügerische Stille hinein, doch Ranieri ist fort. In Priskas Kopf fahren die Gedanken Achterbahn inklusive Fünferlooping. Und Elena ist noch immer allein im Garten. Wobei es dort vermutlich gerade sicherer ist als im Haus. Die Vorstellung ist beängstigend. Für Priska ist der Ausspruch »My home is my castle« mehr als nur eine Redewendung. Ihr zu Hause war bisher der einzige, verlässliche Rückzugsort. Es fühlt sich an, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Wie soll sie hier weiter leben, in dem Wissen, dass permanent ein unleidlicher Geist um sie herumschleicht. Eine perfidere Psychofolter gibt es kaum.
In diesem Moment hört sie Elena schreien. Panik durchflutet sie. »Elena, was ist passiert?« Brüllend hämmert sie gegen die Tür. »Ich bin gleich bei Dir, mein Schatz!« Dann fällt ihr ein, dass sie sich völlig irrational verhält. Die Terrassentür. Wieso hat sie nicht gleich an diesen Ausgang gedacht? Stolpernd hechtet sie ins Esszimmer. Elenas Schreie klingen inzwischen schrill. Priska will den Griff der Glastüre, die in den Garten führt, nach oben ziehen. Doch der bewegt sich keinen Millimeter. »Bitte, bitte«, fleht sie aufgelöst. Fast kann sie Eleonores triumphierendes Lächeln spüren. Verzweifelt schluckt sie die Panik hinunter. Sie denkt an Ranieris Worte: »Konzentrier Dich auf die Tür, nicht auf sie.« Sie hat keinen Schimmer, was er ihr damit sagen wollte. Doch sie wird ihm beim Wort nehmen. Weder Lärmen, Betteln noch Gewalt haben ihr geholfen. Nur wenige Meter von ihr entfernt – lediglich die Hausmauer trennt sie, brüllt sich Elena die Seele aus dem Leib. »Mama!!!« Priska versucht, ihre Angst, die sie eher lähmt als antreibt, niederzukämpfen. »Ich komme, mein Schatz!« Beschwörend wiederholt sie ihre Worte. Spricht sich Mut zu: »Ich komme!« Sie starrt auf den silbern glänzenden Türgriff in ihrer Hand und bündelt ihre Gedanken, bis sie sich nur noch auf ein Ziel richten: Die Türe zu öffnen. Mit aller Kraft stellt sie sich vor, wie sie den Griff hochdrückt und die Türe mühelos aufstößt. Ihr Geist trifft sogleich auf einen Widerstand. Es ist Eleonore, welche sich ihr mit ihrer bisher gesammelten Energie entgegengestellt und versucht, sie mit aller Macht zurück zu drängen. Doch Priskas psychische Kräfte übersteigen ihre physischen bei Weitem. Erstaunt bemerkt sie, dass sie Eleonore mittels mentaler Waffen eine ebenbürtige Gegnerin sein kann. Diese Erkenntnis mobilisiert zusätzlich Reserven. Alles um sie herum verschwindet in einer Art Nebel. Am Rande von Priskas Bewusstseins reißen Elenas Schreie schmerzhafte Wunden in die milchige Kuppel, die sich über sie wölbt. Allein der silberne Türgriff ist noch klar und deutlich zu erkennen. Er scheint durch eine Art Tunnel auf sie zuzurasen. Schließlich ist er so nahe, dass ihr Geist ihn zu umfassen vermag und ihn mit Gewalt um hundertachzig Grad nach oben drückt.
Sekunden später steht sie auf den Terrassendielen. Der Nebel löst sich auf und die Kuppel gibt sie frei. Mit weichen Knien wirft sie einen Blick hinter sich. Das Holz am Türrahmen und am Griff ist gesplittert. Doch sie hat keine Zeit, um sich ihrer Überraschung und Grübeleien hinzugeben. Stattdessen folgt den Schreien ihrer Tochter. Rennt so schnell sie ihre Beine tragen. Um Haaresbreite verfehlt sie den brunnenartigen Schacht direkt zu ihren Füßen. Elena steht am Boden des auszementierten Loches. Auf einem Bett aus lila Orchideenblüten. Mit Tränen in den Augen sieht sie zu ihrer Mutter auf: »Mama, hol mich hier raus!« Priska fackelt nicht lange. Sie legt sich bäuchlings vor den Schacht und streckt ihrem weinenden Kind die rechte Hand entgegen. Mit der Linken umschlingt sie den schlanken Stamm der Zierkirsche neben sich. Allzu tief ist der stillgelegte Abwasserschacht zum Glück nicht. Hastig ergreift Elena die Hand ihrer Mutter und Priska zieht sie nach oben. Elena fällt ihr schluchzend um den Hals. Priska drückt das bebende Kind an sich. Eine Welle der Erleichterung erfasst sie. Umspült die spitzen Felsen des Psychoterrors, die sich langsam, aber stetig in ihr Herz bohren. »Geht es Dir gut, mein Schatz? Hast Du Dir wehgetan?«
»Nein.« Elena schüttelt ihren Kopf und bedenkt ihre Mutter mit einem Sprühregen aus Erdklümpchen, die aus ihren zerzausten Locken fallen. »Ich bin nur erschrocken. Und ich bin einfach nicht mehr hochgekommen. Die Wände sind zu glatt.« Priska betrachtet den schweren Gullideckel, der einen halben Meter weiter im Gras liegt.
»Wie hast Du es nur geschafft, den Deckel anzuheben? Und warum?« Unwillkürlich fragt sich Priska, was Luis jetzt wohl für eine rationale Erklärung parat hätte.
»Der Brunnen war schon offen«, antwortet Elena. »Eleonore hat mir gesagt, dass ich Esmeralda dort finde.« Ein eisiger Blizzard fegt die letzten Reste von Erleichterung hinfort. Priska umarmt ihre Tochter so fest, dass es wehtun muss. Das Kinderherz hüpft und flattert wie ein aufgeregtes Vögelchen. «Ich habe ein paar Blütenblätter hineingestreut und Esmeralda gerufen. Und dann hat sich unten etwas bewegt. Da bin ich in das Loch hineingeklettert. Ich habe mich am Rand festgehalten und dann hinunterplumpsen lassen.« Elena holt tief Luft. »Ich weiß, dass das blöd von mir war. Aber ich war so sicher, dass es Esmeralda ist. Und sie hätte mir bestimmt geholfen, wieder rauszukommen.« Elena löst sich ein wenig aus Priskas Umklammerung und zeigt in den Schacht. »Aber das war nicht Esmeralda, sondern ein Babyfrosch.« Priska versucht, sich ihre Verblüffung nicht anmerken zu lassen. Dann sieht sie ebenfalls nach unten. Tatsächlich: Halb verdeckt von den Orchideenblättern kauert am Rand des Schachtes eine hellbraune Kröte. »Können wir sie retten, Mama?«
Priska nickt: »Zumindest können wir sie da herausholen.« Mit ihrer Tochter an der Hand schnappt sie sich den Kescher aus der Garage. Damit ist es ein Leichtes, das Tier nach oben zu befördern. Elena setzt die kleine Kröte unter einen Laubhaufen. Danach gehen sie gemeinsam zurück ins Haus, obwohl sich in Priska alles dagegen sträubt, erneut mit Eleonore konfrontiert zu werden. Dass sie vorhin einen kleinen Sieg gegenüber dem unberechenbaren Geisterkind erringen konnte, verleiht ihr jedoch die nötige Zuversicht. Wäre doch gelacht, wenn sie sich von einem Gespenst aus dem eigenen Haus vertreiben ließen! Sie bugsiert die noch immer etwas verwirrte und sichtlich mitgenommene Elena auf die Küchenbank und legt ihr eine Fleecedecke um die Schultern. Auch in diesem Raum herrscht eine eigenartige Kälte. Dabei arbeitet die Heizung auf Hochtouren. Priska hofft inständig, dass die frostigen Temperaturen nichts mit Eleonore zu tun haben, obwohl sie es eigentlich besser weiß. Sie setzt Milch für einen heißen Kakao auf, lässt ihre Tochter dabei aber nicht aus den Augen. Doch Elena wirkt ganz in sich selbst versunken. Gedankenverloren rührt sie mit dem Kaffeelöffel in ihrer noch leeren Lieblingstasse mit dem Regenbogen. Wahrscheinlich verarbeitet sie gerade das unschöne Erlebnis von eben.
Als die Milch zu kochen anfängt, wird es allmählich wärmer in der Küche. Vielleicht ist es nur die Hitze des Ofens, welche die Raumtemperatur nach oben treibt. Gleichwohl fühlt sich Priska sofort behaglicher. Während sie das Kakaopulver in den Topf rührt, merkt sie, wie die Anspannung von ihr abfällt. Draußen klappt lautstark eine Autotür und im selben Moment ertönt neben Priska ein Rauschen. Es ist das Babyphone. Sie hat am Morgen vergessen, es auszuschalten. Gut, dass Luis nicht da ist. Auf seinen Vortrag in Sachen Stromverschwendung verzichtet sie gerne. Helles Tageslicht durchflutet Elenas Kinderzimmer. Im Gegensatz zu den dunklen Farben in der Nacht dominieren nun warme Gelb- und Rottöne. Priskas Finger liegt bereits auf dem Ausschalter. Aber sie schafft es nicht mehr, ihn zu betätigen. Ihre Horrorvision wird Wirklichkeit. Ein Gesicht schiebt sich direkt vor die Kamera. Das Antlitz ist verschwommen. Doch es besteht kein Zweifel: Es ist Eleonore, die da unverwandt in die Kamera blickt. Zumindest scheint es so. Ihre Augen flackern nicht weiß wie die von Elena in der Nachtsichtfunktion. Vielmehr gleichen sie zwei tiefschwarze Höhle, die Priska dennoch direkt in die Seele stieren. Die Gesichtszüge des Geistermädchens flimmern und die verschwommenen Konturen verleihen Eleonores Gesicht etwas Maskenhaftes. Lächelt sie oder öffnet sie ihren Mund zu einem lautlosen Schrei? Pfeifend entweicht der Atem aus Priskas Brust. Der Schock hat sie die Luft anhalten lassen. Unmöglich, dass Elena ihre Gespensterfreundin in eben dieser furchterregenden Gestalt wahrnimmt. Eine solche Erscheinung würde sie zutiefst traumatisieren. «Was willst Du?«, flüstert sie der Gestalt auf dem Display zu, ohne die Gesprächstaste zu drücken.
»Mama? Mit wem redest Du?« Elena klingt alarmiert. Priska spürt ihre Blicke im Rücken. Sie ist nicht in der Lage zu antworten. Zitternd presst sie ihren Finger auf den Ausschaltknopf, ohne auf eine Antwort zu warten. Die gespenstische Fratze verschwindet und der Bildschirm wird dunkel.
»Kannst Du Dich bitte umdrehen, Mama? Manchmal träume ich, dass Du am Herd stehst. Du hast Deine Lieblingsjeans an und Deinen blauen Pulli. Aber dann drehst Du Dich um und Du bist jemand anderes. Eine böse Frau, die mir wehtun will.« Elena schluchzt. Priska eilt zu ihr und nimmt Elenas Kopf in beide Hände: »Sieh mich an, mein Schatz. Ich bin es. Warum hast Du mir nie von diesen Träumen erzählt?« Die Ereignisse überschlagen sich. und alle Zuversicht ist dahin. Priska kann keine Nacht länger in diesem Haus bleiben.
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte Angst, dass es wahr wird, wenn ich es erzähle.« Elena lehnt ihre heiße Stirn an die ihrer Mutter. So verharren sie einige Sekunden. Bis Priska der Geruch verbrannter Milch in die Nase steigt.
»Ohje, der Kakao!« Beinahe ist sie froh, dass die Banalitäten des Alltags sie einholen. Sie springt auf und schnappt sich Elenas Tasse. Bevor sie diese mit der heißen Schokolade füllt, entfernt sie sorgfältig die Milchhaut, die sich an der Oberfläche gebildet hat. Dann greift sie nach der Küchenrolle und wischt mechanisch die übergelaufene Milch weg. Gleichzeitig fragt sie sich, wie sie sich in diesem Moment auf solche Kleinigkeiten konzentrieren kann. Um sie herum stürzt eine Welt ein. Reißt Priskas vertraute Festung mit sich und begräbt sie unter den Trümmern. Doch das gewohnte Ritual gibt ihr Halt. Sie reicht Elena den dampfenden Kakao und atmet tief durch. Elena bläst ihre Backen auf und pustet dann mit Inbrunst über ihre geliebte Regenbogentasse. Priska muss unwillkürlich lächeln angesichts dieser entwaffnend unschuldigen Geste. Elena schmunzelt ebenfalls. Vorsichtig nippt sie an dem noch immer heißen Getränk. »Eleonore würde am liebsten auch einen Kakao trinken.« Mit der Tasse am Mund klingt Elena etwas undeutlich. Priska braucht einen Moment, bis sie ihre Worte erfasst. Dann trifft sie die Erkenntnis wie ein dumpfer Schlag in die Magengrube. »Ist sie hier?« Priskas Stimme bebt.
»Kannst Du sie nicht sehen? Sie steht direkt neben Dir.« Priska möchte ihrem ersten Impuls folgen und Hand in Hand mit ihrer Tochter aus dem Haus stürmen und diesen ganzen Wahnsinn hinter sich lassen. Kurz denkt sie an ihren Traum vom Antermoiasee und an die Worte der Gana. Mühsam unterdrückt sie ihren Fluchtreflex. Mit klopfendem Herzen wendet sie den Kopf zuerst nach rechts, dann nach links. Niemand ist zu sehen. Doch sie weiß, dass Elena recht hat. Die jenseitige Kälte kriecht bereits unaufhaltsam über ihre Extremitäten und bis unter die Haarwurzeln. Aus dem Augenwinkel registriert sie eine Bewegung auf Höhe der Durchgangstür, die ins Wohnzimmer führt. Obwohl ihr Instinkt sie eindringlich warnt, richtet sie ihren Blick auf den Glaseinsatz. Zuerst nimmt sie nur ihr eigenes Spiegelbild wahr. Doch dann sieht sie den kleinen Schatten, der eine Handbreit von ihr entfernt steht. Trotz der riffeligen Oberflächenstruktur ist Eleonore nun viel deutlicher zu erkennen als vorhin auf dem Display des Babyphones. In diesem Moment erinnert sie sich an Ranieris Worte: »Sie manifestiert sich.«
Zwar wirkt die Mädchengestalt noch immer durchscheinend, aber statt schwarzer Löcher besitzt Eleonore nun Augen, die Priska aus dem provisorischen Spiegel heraus beobachten. Mit der grässlichen Fratze von eben hat dieses arglose Kindergesicht nichts mehr gemein. Die dunklen Haare werden von einer roten Schleife zusammengefasst. Das gerüschte Kleid und die Riemchensandalen leuchten im selben Farbton. Sie trägt andere Sachen als auf dem Foto, stellt Priska fest. Im Arm hält Eleonore die Puppe, welche Priska noch aus ihrem Traum in Erinnerung hat. Alles ist so unwirklich. Die Erscheinung überlagert Priskas gewohnte visuelle Wahrnehmung wie ein Störbild. Das Kind bewegt die Lippen, doch Priska kann es nicht hören.
»Sie wollte Dich nicht erschrecken«, übersetzt Elena in einem seltsam monotonen Singsang. »Aber sie braucht unsere Hilfe. Und sie wird mit uns gehen.«
»Wohin will sie mitkommen?« Priska fragt sich verzweifelt, wann die Hiobsbotschaften endlich ein Ende haben.
»Nach Hause.« Elena schlürft die lezten Kakaoreste aus ihrer Tasse. Dieses Geräusch klingt derart absurd und fehl am Platz, dass Priska zuerst zusammenzuckt und anschließend hysterisch kichert. Elena lässt sich nicht beirren: »Sie sucht ihre Mutter.«
Das Mädchen im Glas streckt Priskas Spiegelbild eine kleine weiße Hand entgegen. Der Platz neben der Priska aus Fleisch und Blut scheint nach wie vor leer zu sein. Doch als beide Abbilder sich berühren, spürt Priska einen elektrischen Schlag. Sie muss daran denken, wie sie im Traum versucht hat, Ranieris Hand zu ergreifen. Es hat sich ähnlich angefühlt. Wenn auch weniger beängstigend. Aber das hier ist kein Traum, oder?
Sie wagt es nicht, ihre Hand zurückzuziehen. Außerdem ist sie starr vor Schreck. »Warum hast Du mich nicht in den Garten gelassen?«, fragt sie das Kind im Spiegel. Als Eleonore diesmal den Mund öffnet, vernimmt Priska ein leises Rauschen. Doch sie versteht nach wie vor nicht, was die Erscheinung ihr mitteilen will. Wieder muss Elena als Dolmetscherin einspringen:
»Sie wollte, dass ich erst Esmeralda finde.«
Trotz ihrer Aufregung versucht Priska, sich die Situation von vorhin nochmal vor Augen zu führen. Überdeutlich erinnert sie sich an die negativen Schwingungen. Sie kann sich Eleonore beim besten Willen nicht als liebevollen Schutzengel vorstellen. Und ihr ist unwohl dabei, dass sie ihrer Tochter so nahe ist. Der Geist in der Glastür ist unheimlich und verstörend. Doch er löst keine Todesangst aus. Anders als die alptraumhafte Fratze im Babyphone. Sieht ihre Tochter Eleonore in der jetzigen Gestalt? War die Erscheinung im Kinderzimmer einfach noch nicht ausreichend manifestiert? Hat sie deshalb ausgesehen, als sei sie soeben einem indizierten Horrorfilm entstiegen? Priska hat keine Ahnung, was Eleonore im Schilde führt. Forschend blickt sie dem Gespensterkind in das blasse Gesichtchen. Eleonore zieht ihre Mundwinkel nach oben. Ihre Mimik hat etwas Künstliches, Puppenhaftes. Und das Lächeln wirkt tückisch. Oder täuschen Priska ihre überspannten Sinne? Das Kribbeln in ihrer Rechten, auf der Eleonores blasse Finger liegen, wird unangenehm. Abrupt schüttelt Priska die Geisterhand ab.
In diesem Moment durchbricht das Klingeln des Telefons die unheilvolle Stille. Es liegt auf der Anrichte. Priska greift danach wie nach einem Rettungsanker.
»Hallo?«, flüstert sie atemlos.
»Priska? Das Ergebnis der Analyse liegt vor.« Es ist Hans.
»Ja?«
Hans macht eine kurze Pause, bevor er antwortet. Vielleicht ist er irritiert von Priskas Einsilbigkeit. Dann räuspert er sich und fährt fort: »Der Text lautet: »Im Gedenken an meine geliebte Tochter Eleonore, die mir viel zu früh genommen wurde.« Jetzt folgt ein Satz, den das Labor nicht wiederherstellen konnte. Weiter geht es mit: »Mein Herz ist schwer. Ich bete dafür, dass Du nun an einem glücklicheren Ort weilst. In ewiger Liebe, Deine Mutter. Waidbruck, 1. November 1875.« Waidbruck – das ist doch in Südtirol?
»Ja, im Eisacktal. In der Nähe der Trostburg.« Priska merkt selbst, wie gepresst ihre Stimme klingt.
»Priska? Ist alles in Ordnung mit Dir?«
»Hans, ich muss jetzt auflegen. Vielen Dank für Deine Unterstützung und mach Dir keine Sorgen! Es geht uns gut. Bis bald!« Priska legt auf, ohne seine Antwort abzuwarten. Was hätte es für ein Sinn, sich in eine Diskussion mit ihm zu verstricken? Noch dazu in dieser Gesellschaft? Priskas Blick wandert von ihrer Tochter zum Abbild des Geistermädchens. Eleonore hat sich nicht vom Fleck bewegt. Noch immer lächelt sie wie eine Sphinx. So penetrant kann keine Einbildung sein. Doch jetzt weiß Priska, was zu tun ist.
»Komm, Elena. Wir müssen packen.«
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  31.07.2016 23:53 31.07.2016 23:53
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 11: Ein schmaler Grat
»Als Hans mir sagte, was sie im Labor herausgefunden haben, war mir klar, dass ich Dich nicht aufhalten kann.« Luis wirkt erstaunlich gefasst. Priska schiebt den Laptop aus der Sonne und stranguliert sich dabei fast mit dem Kopfhörerkabel. Luis nimmt ihr mit seiner Reaktion den Wind aus den Segeln. Sie hat eher mit wüsten Beschimpfungen denn mit Akzeptanz oder gar Verständnis gerechnet. Verwirrt setzt sie sich. Ursprünglich wollte sie ihm noch nicht einmal mitteilen, in welcher Pension sie abgestiegen sind. Aber er hätte es ohnehin herausgefunden. Und gleich, wie sehr sie sich in den letzten Tagen in die Wolle bekommen haben: Wenn es um seine Tochter geht, wird sie Luis nie ihm Ungewissen lassen. Das hat er nicht verdient.
»Hallo Papa!« Elena, die im Schneidersitz auf dem Bett hockt und glitzernde Elfen in ihr Stickeralbum klebt, wedelt mit ihrer Rechten gen Bildschirm. Luis kann sein Kind zwar nicht hören, aber sehen. Lächelnd winkt er zurück.
»Darf ich auch mit Papa sypen?«, wendet sich das Mädchen an Priska. Die Nonchalance, mit der sich Elena auf unvorhergesehene Situationen einläßt, muss sie von ihrem Vater geerbt haben. Sobald jedoch ein Lieblingshaargummi verschollen ist oder die Butter an der falschen Stelle im Kühlschrank deponiert wird, hat das jeweils Katastrophenpotential.
»Klar. Gib mir noch zehn Minuten, ok?«
Elena gähnt demonstrativ und widmet sich erneut ihren bunten Aufklebern. Zu ihrer Linken sitzt Professor Schrumpel. Die zweifarbigen Glasäuglein starren in die Spiegeltür des wuchtigen Kleiderschranks, der neben dem Bett steht. Am liebsten würde Priska das monströse Möbelstück aus dem Zimmer schaffen. Es löst Beklemmungen in ihr aus. Sie nimmt sich vor, den Spiegel später mit einem Tuch abzudecken. Vor Elena steht das handtellergroße Feenhäuschen aus Holz, das Luis ihr letztes Jahr zum Geburtstag gebastelt hat. Die Tür und die Fensterläden schmücken bunte Ornamente. Priskas bescheidener Beitrag zu diesem kleinen Kunstwerk. Seit ihrer Abfahrt hat Elena das Miniaturhaus nicht aus den Augen gelassen. Immer wieder hebt sie es an und späht hinein. Sie ist davon überzeugt, dass Esmeralda ihr Flehen erhört hat und vorübergehend in dieses behagliche, wenn auch etwas beengte Domizil eingezogen ist. Weder Priska, noch Elena selbst haben sie allerdings bisher zu Gesicht bekommen. Elena, nie um eine Erklärung verlegen, begründet dies damit, dass sich die Fee zu ihrem eigenen Schutz unsichtbar macht. »Wie kannst Du Dir dann sicher sein, dass sie da ist?«, hatte Priska gefragt. » Manchmal rappelt und leuchtet es drinnen.«
Priska dreht sich wieder zu ihrem Notebook und ihrem Mann um. Sie fragt sich, ob die Falte auf Luis Stirn seiner Konzentration oder der Sorge um ihre Zurechnungsfähigkeit entspringt.
»Die meisten Gedanken mache ich mir wegen Deiner Schlaflosigkeit, Priska. Ich habe Angst, dass Du das Auto um den nächstbesten Baum wickelst.«
»Vielen Dank für Dein Vertrauen!« Priska reagiert patziger, als sie wollte. Im Grunde ist sie Luis dankbar dafür, dass er ihren überstürzten Aufbruch so souverän weggesteckt. Ihr Mann – das unbekannte Wesen. »Ich wundere mich sowieso darüber, dass Du mir nicht prompt die Jungs in den weissen Kitteln auf den Hals gehetzt hast.«
»Priska, ICH bin nicht Dein Feind. Ich liebe Dich! Aber Du kannst in der Tat froh sein, dass Du mir gerade nicht wirklich gegenübersitzt.« Luis Gesichtsausdruck wirkt grimmig, doch um die Mundwinkel zuckt es verdächtig. «Ich weiß, dass Du Elena nie in Gefahr bringen würdest. Bei Dir selbst bin ich mir da allerdings nicht so sicher. So gesehen hat es vielleicht sein Gutes, dass sie Dich begleitet. Trotzdem ist dieser Tripp eine völlig bekloppte Aktion.«
»Genauso bekloppt wie ich? Willst Du das sagen?« Kaum haben die Worte ihren Mund verlassen, verpasst sich Priska in Gedanken eine saftige Ohrfeige. Warum muss sie dem Gespräch nur wieder eine so unschöne Wende geben? Doch Diplomatie war noch nie ihre Stärke.
»Hielte ich Dich für verrückt, würde ich hier bestimmt nicht seelenruhig mit Dir skypen.« Obwohl das Bild gerade ein wenig flackert, sieht Priska, dass Luis tief durchatmet. Etwas zögerlich fährt er fort: »Das größte Problem ist die pathologische Seite Deiner Schlaflosigkeit. Zumindest teilweise ist die Insomnie hausgemacht. Und das behindert Dich.«
»Wobei?« Luis drückt sich schon genauso rätselhaft aus wie Ranieri.
»Ja. Vielleicht hat er ja ein Auge auf Dich , bis ich da bin.«
Priska zuckt zusammen. Hat Luis das eben wirklich gesagt? Kann er nun etwa auch Gedanken lesen? Über die Schulter späht sie zu Elena hinüber, die gerade einen Einhornsticker im gemalten Schlosssaal platziert. Ihre rosa Zungenspitze berührt dabei die Oberlippe. Ein Zeichen von höchster Konzentration. Elena kann ihren Vater ohnedies nicht hören. Priska nestelt nervös am Headset und wendet sich wieder ihrem Mann zu. Luis grüne Augen funkeln. Ein wenig süffisant. So scheint es. »Der Schlafmangel macht es Deinem Hirn leicht, Dir etwas vorzugaukeln. Wie willst Du da erkennen, was Halluzination und was echt ist? Zunächst musst Du wieder klar werden in der Birne. Erst dann kannst Du analysieren, was hinter dem ganzen Hokuspokus steckt.«
»Und wie soll ich das anstellen?« Priskas Gedanken hängen noch an der Stelle, wo Luis Ranieri als Babysitter für sie vorschlägt. Damit hat er das Gegenteil von dem erreicht, was er von ihr fordert. Nun ist sie endgültig verwirrt. Ihr Schädel dröhnt und ihre Glieder sind schwer. Sie fühlt sich wie in einem Alptraum, in dem sie versucht, vor einer unbekannten Bedrohung zu flüchten, dabei aber keinen Millimeter vom Fleck kommt. Heimlich kneift sie sich in den rechten Oberschenkel. Nein, sie ist definitiv wach. Es ist der vergangene Tag, der ihr in den Knochen steckt. Und zwei Stunden Schlaf reichen einfach nicht aus, um sich ausreichend zu regenerieren. Ihr Körper fährt mit der letzten Pfütze Sprit. Sobald diese versiegt ist, hält die Zapfsäule nur einen weiteren Tropfen bereit. Nicht etwa eine komplette Tankfüllung. Seufzend massiert sie sich die Schläfen und bemüht sich, Luis Erläuterungen zu folgen.
»Die Verhaltenstherapie wäre ein erster Schritt gewesen. Sie hätte Dir das nötige Rüstzeug mitgegeben. Techniken, um Deine Panikattacken in Schach halten und in den Schlaf finden zu können. Derzeit bist Du ein Spielball Deiner Ängste. Das muss aufhören. Ich denke, Du brauchst eine Krücke, bevor Du losrennen und in die Abgründe Deiner und anderer Leute Seele und Vergangenheit eintauchen kannst. Du solltest zuerst halbwegs stabil sein. Verstehst Du?«
»Der ganze Entspannungsquatsch hat mir bisher rein gar nichts gebracht.« Priska merkt selbst, dass sie sich verhält wie ein Kleinkind, das nicht versteht, warum es Schwimmflügel braucht.
»So etwas Störrisches wie Dich gibt es auch kein zweites Mal! Du machst es Dir wirklich unnötig schwer.« Luis hat die Moralpredigt noch nicht beendet, als sein Blick scheinbar beiläufig von ihr wegwandert. Er fixiert nun einen Punkt in ihrem Rücken. Rasch dreht sich Priska um und erstarrt. Dabei wäre es angebracht, sich allmählich an Eleonores Gegenwart zu gewöhnen. Das Geistermädchen hat seine Drohung wahr gemacht und sich nicht abschütteln lassen. Im Spiegel des Kleiderschranks sieht Priska Eleonore auf der Bettkante sitzen. Lächelnd frisiert sie ihre Puppe. Elena ist noch immer mit ihrem Stickeralbum beschäftigt. Entweder hat sie ihre Gespensterfreundin nicht bemerkt oder sie will sich gerade nicht mit ihr befassen. Außerdem muss Elena nicht den Spiegel bemühen, um das Gespensterkind sehen zu können. Zudem bleibt ihr der Anblick der frei im Raum schwebenden Haarbürste erspart. Eleonores Spiegelbild hebt den Kopf und Priska verschränkt fröstelnd ihre Arme. Doch die Augen des Geistermädchens richten sich nicht auf sie. Die Szene hat etwas Surreales, doch es besteht kein Zweifel: Eleonore und Luis sehen sich an. Dafür, dass ihr Mann die Existenz dieses Wesens noch vor einigen Tagen rigoros geleugnet hat, wirkt er ziemlich gelassen. So tiefschürfend diese Erkenntnis, so flüchtig der Augenblick. Schon ruhen Luis Augen wieder auf Priska und Eleonore ist verschwunden. Lediglich die Haarbürste bleibt auf dem Bett zurück.
»Luis, was geht hier vor? Du hast sie auch gesehen! Wag ja nicht, es abzustreiten!« Priskas Stimme überschlägt sich fast. Fürchterlich, ihre Überspanntheit. Sie wird sich selbst immer unsympathischer.
»Mama, ist alles in Ordnung? Redest Du von Eleonore? Sie war eben noch da.« Elena klingt beunruhigt. Wahrscheinlich hat Priskas schriller Tonfall sie alarmiert.
»Ja, alles gut, mein Schatz.« Priska holt tief Luft und zieht den Laptop näher an sich heran.Luis Gesichtsausdruck ist schwer zu deuten. Seine Antwort scheint er sich jedenfalls genau überlegen zu müssen. Nachdenklich knetet er seinen Nacken.
»Kann ich jetzt mit Papa reden?«, schaltet sich Elena erneut ein.
»Gleich, Elena.« Priska beugt sich über die Tastatur. Ihre Nase klebt nun fast am Bildschirm. »Luis, ich hab Dich etwas gefragt.«
»Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe«, antwortet er ausweichend.« Die Lichtverhältnisse sind nicht gerade optimal. Vergiss nicht, dass ich Euer Zimmer nur auf dem Computerdisplay sehe. Und der Hintergrund ist lange nicht so deutlich zu erkennen wie Du. Reflexionen im Spiegel erst recht nicht. Aber ich werde gleich im Anschluss ein Tool installieren, mit dem ich künftige Videogespräche aufnehmen kann. So bringen wir möglicherweise Licht ins Dunkel. Vielleicht versuchst Du auch, das Ganze mit Deinem Smartphone festhalten, wenn es wieder passiert.«
»Also, das kann ich Dir nicht versprechen, Luis.« Priska stellt sich vor, wie sie lässig das Handy zückt, sobald Eleonore wieder auftaucht. Das Szenario ist derart grotesk, das sie sich zusammenreißen muss, um nicht hysterisch los zu kichern. »Aber immerhin weißt Du jetzt, dass nicht alles nur eine Ausgeburt meiner Schlaflosigkeit ist.« Kaum hat sie diese Worte ausgesprochen, da wird ihr bewusst, was sie bedeuten. Eleonores Geist ist echt. Keine Coproduktion von Elenas und ihrer Phantasie. Priska spürt, wie die Gänsehaut ihre Arme überzieht und sich in ihrem Magen ein flaues Gefühl einnistet. Außerdem ist sie überzeugt davon, dass Luis ihr nur die halbe Wahrheit erzählt. Zu deutlich war der Blickkontakt zwischen ihm und dem Geisterkind. Aber es macht wohl wenig Sinn, da heute nochmal nachzubohren.
»Glaubst Du, dass Du heute Nacht schlafen kannst?«, fragt ihr Mann, ohne auf ihre letzte Äußerung einzugehen.
»Ich habe meine Schlaftabletten dabei. Ich werde später eine halbe davon einwerfen. Damit sind mir ein paar Stunden Schlaf sicher, aber ich bin nicht so weggetreten, dass ich nichts mehr um mich herum mitbekomme.« Elenas inbrünstigen Seufzer im Hintergrund ignoriert Priska geflissentlich.
»Und morgen nimmst Du am besten die Autobahn und nicht den alten Brennerpass. Zu viele Kurven.«
»Luis, die Serpentinen sind nicht das Problem. Wenn ich stur geradeaus fahren muss, ist das viel gefährlicher. Monotonie ist der Killer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist der Sekundenschlaf fast vorprogrammiert.«
Sie hat keine andere Wahl: Sie muss unbedingt die alte Brennerstraße nehmen, an der Biegung in die Schlucht hinabblicken und unter den mächtigen Pfeilern der Europabrücke hindurchfahren. Es ist wichtig, dass sie die Präsenz der Berge spürt und die der Vergangenheit. Nur dieser Weg, auf dem vor Jahrhunderten bereits Goethe nach Italien gelangte und den sie selbst in und auswendig kennt, wird sie ans Ziel führen. Das sagt Priska ihr Instinkt und sie weiß, dass er sie nicht trügt.
Jetzt ist es an Luis, resigniert aufzustöhnen. Abwehrend hebt er beide Hände. »Ok, ich kann Dich sowieso nicht daran hindern. Hauptsache, Du schläfst und machst einen großen Bogen um jegliche Harakiri-Manöver. Ich komme nach, so schnell ich kann. Aber eines muss ich Dir lassen: Du hast echt ein mieses Timing.« Er klingt zerknirscht. Priska bindet ihm lieber nicht auf die Nase, dass sein Irlandaufenthalt ein Punkt auf der Pro-Liste für diese spontane Südtirolreise war. Wer hätte ahnen können, dass er ausgerechnet jenes Projekt, auf das er monatelang hingefiebert hat, im Stich lassen würde, um ihnen zu folgen. Nur selten hat Luis die Gelegenheit, an Ausgrabungen teilzunehmen. Dabei ist die Freilegung geschichtsträchtiger Funde damals die Hauptmotivation für sein Archäologiestudium gewesen. Nicht im Traum hat er sich vorstellen können, später einer von ihnen zu werden. Den leeren Körpern, wie er sich und seine Kollegen scherzhaft bezeichnet. Auch wenn ihm das Unterrichten inzwischen Freude bereitet, schlägt sein Herz nach wie vor für die echte Schatzsuche. Bei dem Gedanken muss Priska unwillkürlich lächeln. Gerührt erkennt sie, dass Luis ebenfalls schmunzelt.
Während in Priska Bauch die Liebe ein wärmendes Feuer entfacht und die negativen Emotionen vertreibt, zieht Elena ihrer Mutter das Headset vom Kopf. Routiniert streift sie es sich selbst über die braunen Locken. Ohne lange nachzudenken, wirft Priska ihrem Mann eine Kusshand zu. Er fängt den Kuss auf und erwidert ihren liebevollen Abschiedsgruß. »Oh Gott, seid Ihr kindisch«, stöhnt Elena, um sich dann sogleich in das Gespräch mit ihrem Vater zu vertiefen: »Papa, weißt Du schon, dass Esmeralda in das Feenhaus eingezogen ist?«
…
Der Menhir ragt wie ein riesiger, steinerner Thron aus dem Waldboden. Priska schreitet auf einem Teppich aus buntem Herbstlaub auf ihn zu. Nur wenige Sonnenstrahlen stehlen sich durch die Baumkronen und tauchen diesen einsamen Ort in ein magisches Licht. Voller Ehrfurcht legt Priska ihre Rechte auf den uralten Stein. Er ist warm und schmeichelt ihrer Hand. Es ist bereits Jahrzehnte her, dass sie zuletzt diese Brücke zwischen Dies- und Jenseits berührte. Sie schließt die Augen und beinahe kann sie sie sehen und hören. Wie sie um den Hühnenstein tanzen und keltische Weisen singen. Das dumpfe Grollen der Trommeln versetzt ihren gesamten Körper in Vibration. Dröhnt und pulsiert in ihrem Bauch und ihren Eingeweiden. Der Eindruck von warmer, menschlicher Haut – von einer Hand, die dicht neben ihrer Platz auf dem durchfurchten Fels findet, ist so real, dass ihr schauert. Kühler Stoff streift ihren nackten Unterarm.
»Ein Teil von Dir ist älter als ich. Ja, sogar älter als dieser Stein.« Es ist eine weibliche Stimme. Dicht an Priskas Ohr. Sie zuckt zusammen und schlägt die Augen auf. Neben ihr steht eine junge Frau. Sie trägt ein tannengrünes, bodenlanges Gewand. Das Haar ergießt sich in einem Meer aus rotblonden Locken über die Schultern.
»Wer bist Du?« Priska kann sich nicht vorstellen, dass ihr die Antwort weiterhilft, aber sie muss die Frage trotzdem stellen.
»Ich bin Juna.« Die wasserblauen Augen des Mädchens wirken ebenso offen wie unergründlich. Sie streicht andächtig über das Relikt ihrer Ahnen. »Alles ist vergänglich. Und auch wieder nicht. Du hast den rechten Weg eingeschlagen. Doch er ist lang und beschwerlich. Wende Dich an meine Nachfahren, wenn Du Hilfe brauchst. Sie leben nicht weit von hier.«
Zuerst sind es die Haare, die an Farbe verlieren. Wie grauer Nebel umspielen sie den schlanken, zunehmend transparenter werdenden Körper, durch den bald der Steinblock hindurchschimmert. Junas freundliches Lächeln ist das Letzte, was Priska sich vergegenwärtigt. Dann ist das Mädchen verschwunden.
Priskas Hand liegt noch immer auf dem Menhir, der schon so viele Menschen und Zeiten hat an sich vorüberziehen sehen. Er hat etwas Tröstliches und Beruhigendes, dieser riesige Steinblock. Unnachgiebig und dennoch einladend. Priskas Hand ertastet eine glatte Kuhle, in die sie nun wie selbstverständlich ihre Wange schmiegt. Im selben Augenblick spürt sie, wie der Boden unter ihr ins Wanken gerät und sich verändert. Priska blickt auf ihre Füße hinab. Ein Schwindelgefühl erfasst sie. Der Grat fällt zu beiden Seiten steil ab. Nur Zentimeter trennen sie vom Abgrund. Wolken hängen zwischen den Bergspitzen und Baumwipfeln. Sie verschleiern, was unter ihr liegt. Ein scharfer, kalter Wind reißt an Priskas Kleidern. Sie muss ich konzentrieren, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Langsam hebt sie ihren Kopf. Nur wenige Meter entfernt steht eine Gestalt. Obwohl das Gesicht ihr zugewandt ist, braucht Priska einen Moment, bis sie erkennt, wenn sie da vor sich hat. Es ist Ranieri. Zwar blickt er in ihre Richtung, aber er scheint durch sie hindurchzusehen. Seine Augen schweifen rastlos umher. Sie kann seine Anspannung fühlen. Er ist wieder zwanzig. Seine Konturen sind klar. Kein lumineszierender Schein. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jäh durchzuckt sie die Enttäuschung. Das ist nicht Ranieri, der Geist, sondern lediglich eine Erinnerung. Losgelöst aus ihrem ursprünglichen Kontext und neu eingepflanzt an einem anderen Ort. Offensichtlich träumt sie. Mit der Fußspitze scharrt sie im weißen Geröll. Sie überlegt, ob sie sich fallen lassen soll. Was kann schon passieren? Wahrscheinlich wacht sie einfach auf. Es ist ein Traum und nicht der Erste, in dem sie in die Tiefe stürzt. Sie ist sich nicht sicher, woher dieser plötzliche Impuls rührt. Wahrscheinlich ist es die Trostlosigkeit, der sie entfliehen will. Sie kann nicht mit Ranieri kommunizieren. Er nimmt sie nicht wahr. Und auch wenn er weitaus lebendiger erscheint als der Ranieri in Geistergestalt – er ist es nicht. Sie hat das Gefühl, vor einer Kinoleinwand zu sitzen. Der Film ist in 3D, aber eine Interaktion unmöglich.
»Du kannst mir keine Angst mehr machen. Ich habe abgeschlossen mit diesem Leben. Tot ist tot. Du bist nur eine irrwitzige Schöpfung meines kranken, verkrebsten Hirns. Es gibt keine Geister. Kein Jenseits. Kein Leben nach dem Tod. Nur Dunkelheit.« Ranieri klingt zugleich trotzig und verzweifelt. Seine Augen haben endlich einen Fixpunkt gefunden. Er starrt auf etwas in Priskas Rücken. Reflexartig will sie sich umdrehen. Doch dann wäre dieser Traum in der Tat zu Ende. Der Anblick würde ihren freien Fall erzwingen. Sie weiß sehr genau, wer sich da unaufhaltsam von hinten nähert. Schon vorher war es windig und kalt. Doch die klirrende Kälte, welche die schwarze Frau mit sich bringt, nimmt Priska die Luft zum Atmen. Sie spürt, wie die eisigen Finger sich in ihren Rücken bohren und in sie hineingreifen. Sie finden ihr Herz, quetschen es unbarmherzig und bringen es an den Rand des Erfrierungstodes. Verzweifelt versucht Priska, ihre Lungen mit Sauerstoff zu versorgen. Es ist nur ein Traum. Ein Traum!
Doch der Druck auf ihrem Brustkorb ist unerträglich. Von einem Moment auf den nächsten schlägt eine Welle aus Kälte, Schmerz, Liebe und blinder Wut über ihr zusammen. Priska taumelt. Sie fühlt sich benommen. Und noch immer fühlen sich ihre Lungen an, als seien sie in einen Schraubstock geraten. Sekunden später legt sich Dunkelheit wie ein blickdichter Schleier über sie. «Nun wache ich also doch auf«, denkt Priska. Einerseits ist sie erleichtert, andererseits enttäuscht. Obgleich Ranieri in diesem Traum lediglich eine Marionette ihres Unterbewusstseins ist, will sie ihn nicht im Stich lassen. Sie wartet auf den Sog, den sie immer vor dem Aufwachen verspürt und der sie zurück in die reale Welt katapultieren wird. Doch nichts geschieht. Kurz darauf hebt sich der Schleier. Priska steht noch immer auf dem schmalen Gebirgspfad. Direkt vor ihren wogt eine dunkle Nebelschwade den Weg entlang. Ranieri entgegen. Priska braucht einen Moment, bis sie erkennt, dass es sich dabei um das Gewand und das dunkle Haar der schwarzen Frau handelt. Auf dem Foto im alten Haus und in Priskas letztem Traum von der unheilvollen Frauengestalt trug sie eine züchtige Hochsteckfrisur. Nun jedoch umhüllt die lange Haarpracht die Spukerscheinung wie eine Gewitterwolke. Bedrohlich und energiegeladen. Priska kann das Gesicht des Geisterwesens nicht sehen. Zeugt es in diesem Moment von Rachegelüsten oder von Leidenschaft? Der graue Dunst hat inzwischen Ranieri erreicht. Langsam schlängelt er sich an seinen Beinen empor. Ranieri versucht zurück zu weichen, doch der Nebel ist jetzt auch hinter ihm. Baut sich in seinem Rücken zu einer undurchdringlichen, meterhohen Wand auf.
»Nein, Du wirst mich nicht bekommen!« Seine Stimme klingt fest und kraftvoll. Nur Priska kann das Zittern und die Verzweiflung heraushören. »So will ich nicht sterben. Du darfst nicht das Letzte sein, was ich sehe.« Die ersten Ausläufer des kalten Rauches haben inzwischen seine Schultern erreicht. Er zerrt an der dünnen Kette um seinen Hals. Priska kann sich noch daran erinnern, wie sie ihn damals scherzhaft fragte, ob er jetzt auch unter die prolligen Goldkettchenträger gegangen sei. Das wäre ja schon fast ein Trennungsgrund. Ranieri hatte nur gelächelt und sich an die Brust gefasst.
»Ich liebe Dich, Priska.« Zart küsst er den Gegenstand, den er in Händen hält. Es ist ein kleines Medaillon. Priska traut weder ihren Ohren noch ihren Augen. Ein Traum. Es ist nur ein Traum! Trotzdem schlägt ihr das Herz bis zum Hals. »Ranieri, ich bin hier!«, ruft sie, jeglicher Vernunft zum Trotz. Doch er hebt nicht einmal den Kopf. Mit dem geöffneten Anhänger an seinen Lippen macht er einen Schritt zur Seite und lässt sich fallen. Er führt seinen Suizid beinahe beiläufig aus. Kein einziger Schrei dringt aus seinem Mund. Dafür brüllt Priska sich die Seele aus dem Leib. In ihrem Kopf ist das Kreischen ohrenbetäubend. Doch nach außen scheint sie stumm. Trotzdem wendet die schwarze Frau sich zu ihr um. Auf ihrem Antlitz spiegeln sich widerstreitende Emotionen. Hass und Boshaftigkeit würden das Gesicht in eine dämonische Fratze verwandeln. Wären da nicht die Trauer und die Ahnung von Liebe und Menschlichkeit.
»Du hast ihn mir weggenommen.« Priska hört nur das Echo der Geisterstimme. Doch der anklagende Tonfall ist unverkennbar und der Nachhall erreicht Priskas Innerstes. »Nun sind sie alle fort. Die Lieben meines Lebens.« Sie kommt näher. Ihre Augen scheinen fast aus den Höhlen zu springen. Keine Sekunde lassen sie Priska aus dem Blick. »Am Schmerz bin ich zerschellt. Ich muss mein Leid teilen. Mit Dir. Deine Schuld kannst Du nicht begleichen, aber mildern. Ich nehme Dich mit in meine ewige Hölle.«
Mit jedem Schritt, den die schwarze Frau auf sie zugeht, nimmt die Enge in Priskas Brust zu. Sie wundert sich, warum sie noch nicht ohnmächtig geworden ist. Doch Träume halten sich nicht an anatomische und physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ihr Hirn signalisiert ihren Beinen, sich in Bewegung zu setzen. Nur weg von hier und von ihr. Priska unterdrückt den starken Fluchtimpuls und erinnert sich an Ranieris Worte. Hatte er nicht gesagt, dass ihr im Traum nichts geschehen kann? Ja, dass sie sogar erst im Traum zu ihrer wahren Macht findet? Wenn nicht jetzt, wann dann. Forsch stellt sie sich ihrer gespenstischen Widersacherin entgegen. »Ich kann Dir nicht wegnehmen, was Dir nie gehört hat. Er war noch nicht geboren, da lagst Du schon lange unter der Erde.«
»Du irrst Dich. Tatsächlich weißt Du gar nichts.« Auf einer Wolke aus Verachtung und Hohn weht die sinnentleerte Antwort der schwarzen Frau zu ihr hinüber. Priska spürt, wie die nebeligen Auswüchse sich um ihre Beine schlingen. Die unsägliche Kälte frisst sich unbarmherzig durch ihr Fleisch. In einer der entlegensten Ecken von Priskas Gehirn regt sich etwas. Es ist die Abteilung der tief verbuddelten, archaischen Überbleibsel. Doch sie hat keine Möglichkeit, an dieses alte Wissen heranzukommen. Und es ist nicht die schwarze Frau, die sie blockiert, sondern ein Fremdkörper, der in ihrem Hirn nichts verloren hat. Fieberhaft versucht Priska, die Barriere zu durchbrechen. Watte, nichts als Watte. Und dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: Die halbe Schlaftablette hat ihre Schlafarchitektur verändert. Sie ist das Knock-Out-Kriterium. Priska kann ihren Körper unterhalb ihrer Hüfte nicht mehr spüren. Nicht einmal die eisige Kälte. Sie blickt an sich hinunter. Mit Entsetzen stellt sie fest, dass ihre Beine eins geworden sind mit der schwarzen Masse, die mehr und mehr von ihr Besitz ergreift. Das Gesicht der schwarzen Frau schwebt nun direkt vor ihrem. Das Gespenst lächelt. Siegessicher. Gerade, als Priska sich fragt, ob sie nicht doch nach Freddy-Krüger-Manier im Traum sterben kann, erfasst sie ein mächtiger Strudel. Sekunden später wacht sie auf. Japsend schnappt sie nach Luft. Aber da ist keine. Der Druck auf ihrer Brust hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Hastig öffnet sie die Augen und sieht sich dem nächsten Alptraum gegenüber. Auf ihrem Oberkörper sitzt eine Kreatur mit abscheulich langen und unglaublich dürren Gliedmaßen. Der dunkle Leib selbst ist jedoch aufgedunsen und dicht behaart. Das Ungeheuer ähnelt einer fetten, schwarzen Spinne. Sechs Augen, glänzend wie feingeschliffener Onyx, starren Priska unverwandt an. Priska durchfährt der Schock wie Stromschlag. Kurz wirft sie einen Blick zur Seite. Elena schläft tief und fest. Eingerollt wie ein Baby. Den Kopf mit den seidenweichen Locken in Priskas Armbeuge geschmiegt. Nur Zentimeter von dem widerlichen Monster entfernt, das mit der Last seines pulsierenden Torsos Priskas Brust zerquetscht. Ein behaarter Spinnenfinger taucht am Rande ihres Blickfeld auf. Er berührt ihr Gesicht. Schabt über ihre Wange und hinterlässt dabei einen klebrigen Film. Ihre Abscheu und Furcht ist so gewaltig, dass Priska nicht mehr an sich halten kann. Mit einem gellenden Schrei fährt sie hoch, rammt dem Ungetüm mit letzter Kraft eine Faust in die behaarte Körpermitte und schleudert es von sich. Fast augenblicklich füllen sich ihre Lungen wieder mit frischem Sauerstoff.
»Mama, was ist los?« Schlaftrunken reibt sich Elena die Augen. Priska antwortet nicht sofort. Ihre Augen folgen dem monströsen Schatten. Bis er von der Dunkelheit verschluckt wird.
»Es passiert wieder! Mama, schau hin!« Elena sitzt nun ebenfalls aufrecht im Bett und Priska befürchtet schon, dass ihr Kind das Höllenwesen doch noch erspäht hat. Aber Elena sieht in eine völlig andere Richtung. Priska folgt ihrem Blick. Beide betrachten sie das Feenhäuschen, welches Elena auf dem Nachtkästchen platziert hat. Aus dem Inneren dringt ein goldener Schein.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  15.09.2016 21:21 15.09.2016 21:21
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 12: Grenzgänger
»Raus mit Euch!« Hecktisch wedelnd versucht Priska, zwei Fliegen zu verscheuchen, die vor ihrem Gesicht eine Art Balztanz aufführen. Das Fenster auf der Fahrerseite hat sie bereits geöffnet, aber die nervigen Insekten denken nicht daran, sich davon zu machen. Sie wirft einen kurzen Blick in den Innenspiegel. Elena schläft tief und fest in ihrem Kindersitz. Die rosigen Lippen sind leicht geöffnet. Priska spürt, wie sich ihr Herz wehmütig zusammenkrampft. Im Schlaf sieht ihre Tochter noch immer aus wie ein Baby. »Es ist nicht rechtens, dass dieses kleine Kind mit Geistern und Kreaturen aus düsteren Schattenwelten konfrontiert wird. Für sie sollte das Leben bunt und fröhlich sein. Frei von Sorgen und Ängsten.« Priska seufzt. Eine weitere Fliege hat sich auf Elenas rechtem Arm niedergelassen, der das kleine Feenhäuschen fest umklammert hält. »Habe ich vorhin versehentlich neben einem Misthaufen geparkt, oder wo kommen diese Viecher jetzt plötzlich alle her?« Priska fällt es schwer, sich auf die Straße zu konzentrieren. An der Windschutzscheibe tanzt inzwischen ein Fliegenquartett nach einer abstrusen Choreographie. Und draußen schüttet es wie aus Kübeln. Priska ist froh, dass die Strecke an diesem Tag kaum befahren ist. Spritzwasser und reflektierende Scheinwerfer hätten ihre übermüdeten Augen noch mehr strapaziert. Die graue Wolkendecke lässt kaum Licht hindurch. Doch Priska weiß, dass sich das Wetter schlagartig ändern kann, sobald sie den Brennerpass hinter sich gelassen haben. Sie hofft sehr darauf, bald von leuchtenden Farben und hellen, wärmenden Sonnenstrahlen empfangen zu werden. Möge die Helligkeit die Schatten der letzten Nacht vertreiben.
Priska ist überrascht darüber, dass sie nach dem Erlebnis mit der monströsen Kreatur nicht augenblicklich in Schockstarre verfallen ist. Vielleicht hat ihr Verstand noch nicht realisiert, was ihr widerfahren ist. Und auf eine verquere Art und Weise ist sie auch erleichtert, dass ihre Atemnot und ihre Panikattacken nun ein Gesicht haben. Wenn auch ein grässliches. Fast verspürt sie sogar ein wenig Genugtuung: Ihre Vermutung, dass ein Nachtmahr sie quält, ist alles andere als absurd. Obwohl Luis sie das glauben machen wollte. Zwar hat sie sich einen Aufhocker irgendwie anders vorgestellt. Menschlicher. All die Quellen, die sie in unendlichen schlaflosen Nächten studiert hat, vermitteln das Bild einer eher humanoiden Gestalt. Dass Priskas Aufhocker nicht diesem Klischee entspricht, ändert jedoch nichts an dem, was er ist. Ein Dämon, dem nach ihrer Lebensenergie dürstet. Ihr fröstelt und nervös blickt sie abermals in den Innenspiegel. Beinahe erwartet sie, dass sie den sechs seelenlosen, tiefschwarzen Augen begegnet, die sich nur wenige zuvor Stunden eispickelgleich in ihr Innerstes gebohrt haben. Doch der Platz neben Elena ist leer. Kein geiferndes Maul. Keine haarigen Gliedmaßen, die nach ihrer Tochter oder Priska selbst tasten.
Eine Fliege summt direkt an ihrem linken Ohr. Priska schüttelt reflexartig den Kopf. Dabei muss sie das Lenkrad ruckartig bewegt haben. Der Wagen gerät auf der nassen Fahrbahn ins Schlittern. »Oh Gott, das darf nicht wahr sein«, schießt es ihr durch den Kopf. »Ich werde jetzt doch nicht tatsächlich aus der Kurve fliegen.« Das Herz klopft ihr bis zum Hals und instinktiv will sie das Steuer herumreißen. Gerade noch rechtzeitig besinnt sie sich der Regeln bei Aquaplaning. Sie tritt die Kupplung durch und versucht mit zitternden Händen möglichst sanft gegenzulenken. Das Auto befindet sich auf der Gegenfahrbahn und rutscht auf die Leitplanke zu, welche die Straße von der Schlucht trennt. Glücklicherweise kommt ihnen niemand entgegen. Obgleich sie sich mit achtzig Stundenkilometer dem Abgrund nähern, fühlt sich Priska wie in einem Film, der in Zeitlupe abgespielt wird. Sie registriert, dass ihre Knöchel weiß werden, weil sie ihre Finger so ins Lenkrad krallt. Und sie sieht, dass die Fliegen sich an der Windschutzscheibe sammeln. Wie sensationslüsterne Zaungäste. Sie ist sogar so geistesgegenwärtig, um dieses Verhalten als merkwürdig zu bewerten.
»Mama, was ist los?«, ruft Elena schlaftrunken. Während der Wagen haarscharf an der Begrenzung entlang schrammt, macht sich Priska Vorwürfe, dass sie ihr Kind unnötig dieser Gefahr aussetzt und sie womöglich zu Tode erschreckt.
»Alles gut, mein Schatz«, erwidert sie heiser. Krampfhaft hält sie weiterhin das Lenkrad umklammert. Sie fühlt sich, als würde sie versuchen, einen wütenden Stier zu bändigen. Tatsächlich gewinnen die Reifen allmählich wieder an Bodenhaftung und Priska gelingt es, den Schlingerkurs zu beenden. Erleichterung durchströmt sie, als sie den Wagen endlich wieder unter Kontrolle hat.
»Mama, bitte fahr nie wieder so wild! Ich hatte richtig Angst«, tönt Elenas helles Stimmchen von der Rückbank.
»Nein, das verspreche ich Dir, mein Liebes.« Priska atmet tief durch. »Jetzt fürchtest Du Dich aber nicht mehr, oder?«, fragt sie vorsichtig.
»Mein Herz pocht ganz schnell. Aber sonst ist alles ok.« Elena klingt gewollt souverän.
»Das alles tut mir furchtbar leid, mein Schatz.« Priska schluckt. »Ich liebe Dich!«
»Ich Dich auch, Mama«. Elena spricht diese gewichtigen Worte betont langsam aus. Sie weiß, wie wertvoll sie sind. Priska hört, wie ihre Tochter ihr mit lautem Schmatzen einen Luftkuss zuwirft. Eine Geste, die Elena gestern selbst noch als kindisch verurteilt hat. Priska erwidert den Kuss, doch sie traut sich nicht, nochmal in den Innenspiegel zu sehen. Zu groß ist ihre Angst, dass sie erneut ins Rutschen gerät. Sie darf nicht darüber nachdenken, dass sie den Menschen, den sie am meisten liebt auf dieser Welt, soeben in Lebensgefahr gebracht hat. Das Adrenalin, das ihr gerade durch die Venen schießt, reicht jedenfalls für zehn Fahrten nach Südtirol und wieder zurück.
»Mama, nicht weinen!« Elena entgeht auch gar nichts. Priska wischt sich mit dem Handrücken die Tränen vom Gesicht. »Das sind nur Freudentränen, meine Süße«, erwidert sie leise.
»Warum sind hier so viele Fliegen im Auto?« Priska spürt einen Luftzug im Nacken. Wahrscheinlich ist ihr Kind auch gerade am Herumwedeln. »Die kitzeln mich.«
»Wir legen gleich eine kleine Pause ein. Und dann schmeißen wir die alle raus, in Ordnung?«
»Ja, das machen wir!« Elena klingt schon wieder fast normal.
Sie befinden sich nahe der Stelle, an der Priska bei jedem Besuch einem ureignenen Ritual folgt. Schon als kleines Kind hat sie mit ihren Eltern immer dort gehalten. Gemeinsam haben sie dann beinahe andächtig in die Schlucht hinuntergeblickt. Warum, weiß sie nicht. Doch wenn sie dem Drang widersteht und einfach an der unscheinbaren Parkbucht vorbeifährt, wird dieses Versäumnis wie ein Damoklesschwert über ihr hängen. Priskas Unterbewusstsein kennt den Grund. Nur noch eine Biegung und sie sind da. Alles ist wie immer. Abgesehen von einem kleinen Marterl, das dort zum Andenken an eine verunglückte Person errichtet worden ist. Dieses Täfelchen weckt keinerlei Erinnerung bei ihr. Es gehört nicht dorthin. Trotz des beklemmenden Gefühls, das sich in Priskas Magengrube breitmacht, lenkt sie den Wagen auf den kleinen Parkplatz. Unter den Rädern knirscht der Kies, als sie mit großzügigem Sicherheitsabstand zum Abhang anhalten. Priska vergewissert sich dreimal, dass die Handbremse aktiviert ist, bevor sie aus dem Auto steigt und nach hinten zu Elena geht, um sie abzuschnallen. Immerhin hat der Regen zwischenzeitlich nachgelassen. Doch die Sonne lässt sich immer noch nicht blicken. Priska zieht ihre Tochter direkt vom Kindersitz in ihre Arme. Das Kind schlingt seine Arme um ihren Hals und die langen Beine um ihre Hüften. Elenas Herz schlägt noch schneller als das ihrer Mutter. Priska vergräbt ihr Gesicht in den duftenden Locken ihrer Tochter. Mit ihr auf dem Arm öffnet Priska auch die anderen Türen. Sie hofft, dass diese Maßnahme ausreicht, um die Fliegen nach draußen zu locken.
»Was ist das?« Elena löst sich von ihrer Mutter und gleitet auf den Boden. Stattdessen ergreift sie Priskas Hand und zieht sie zu dem überdachten Marterl. Es hängt kein Kreuz über der Inschrift. Nur ein Grablicht steht auf einem Brett unter der Gedenktafel. Doch die Kerze brennt nicht. Priska ist unbehaglich zumute, als sie sich dem gespenstischen Mahnmal nähern. Dabei hat sie früher, auf den zahlreichen Wanderungen, die sie mit ihren Eltern und später mit Ranieri unternommen hat, jedes einzelne Marterl am Wegesrand studiert. Und ihm den nötigen Respekt gezollt. Aber dieses hier ist anders.
»Mama, jetzt komm. Ich möchte wissen, was da drauf steht.« Ungeduldig zerrt Elena an ihrer Hand.
»Elena, das ist eine Art Andenken. Für einen Menschen, der hier gestorben ist.« Priska denkt an die skurrilen und teils makabren Texte, mit denen der Toten auf diesen Tafeln gedacht wird. Der Humor soll dem Tod den Schrecken nehmen, doch auf Priska hat die Fröhlichkeit immer erst recht verstörend gewirkt. Es gibt schon genug, was Elena derzeit zusetzt. Die Geschichte auf dem Marterl ist bestimmt kein geeignetes Seelenfutter für sie.
Nun stehen sie direkt vor der Gedenktafel. Priska braucht einen Moment, ehe sie die geschwungenen Lettern entziffern kann. Als ihr Verstand den Worten Sinn gibt, erstarrt sie. Die Kälte ist wieder da und trifft Priska mit einer Wucht, die sie straucheln lässt. Mit klammen und zitternden Fingern kneift sie sich in den Unterarm. Sie gräbt ihre Fingernägel so tief in die Haut, dass sie zu bluten anfängt. Nein. Leider träumt sie nicht.
»Hier starb Priska Lavendar.
Verfolgt von einem Mahr.
Der Weg in die Ewigkeit ist nicht weit –
Um zwölf war sie fort und um eins schon dort.«
In welch grausames Spiel ist sie da nur hineingeraten? Wie in Trance blickt sie auf ihre Armbanduhr. Das Ziffernblatt verschwimmt beinahe vor ihren Augen. Es ist kurz vor zwölf Uhr Mittags.
»Mama? Alles in Ordnung? Wieso zitterst Du so?« Elena schüttelt besorgt die Hand ihrer Mutter. Die fühlt sich wie gelähmt. »Steht etwas Schlimmes auf der Tafel? Kannst Du mir das bitte vorlesen?« Elenas Fragenbombardement kann Priska im Augenblick nicht standhalten.
»Ich muss mich setzen«, murmelt sie und hockt sich direkt auf den nassen Kies. Elenas violette Augen mustern sie besorgt. Dann kuschelt sich das Kind auf ihren Schoß. Etwas in Priska drängt panisch zum Aufbruch. Wenn das der Ort ist, an dem sie sterben soll, müssen sie zusehen, dass sie so schnell wie möglich von hier fortkommen. Doch sie fühlt sich gerade nicht einmal dazu in der Lage, den Autoschlüssel ins Zündschloss zu stecken.
Es mögen vielleicht dreißig Sekunden verstrichen sein, da hört Priska, wie ein Auto auf den Parkplatz rollt. Alarmiert hebt sie den Kopf. Ein silberner Mercedes hält neben ihrem alten Kombi. Heraus steigt eine Frau in Priskas Alter. »Hallo«, ruft sie aufgeregt und winkt in ihre Richtung. Während sie auf Priska und Elena zueilt, löst sich eine blonde Strähne aus ihrem Haarknoten und kurz darauf kommt sie ins Straucheln, weil der Absatz ihres linken Pumps im Schotter hängenbleibt. Ein wenig Normalität in diesem wahrgewordenen Alptraum. Priska erhebt sich mit wackeligen Beinen. Ohne dabei jedoch ihr Kind auch nur einen Moment loszulassen. Die blonde Frau ist nun bei ihnen angelangt. Von dem Marterl nimmt sie keinerlei Notiz. Ihre klaren, blauen Augen sind auf Priska geheftet.
»Können Sie mir helfen? Bitte!« Ihre Stimme überschlägt sich fast.» Mein Sohn hat auf der Fahrt von Innsbruck plötzlich hohes Fieber bekommen. Wir brauchen dringend einen Arzt. Aber mein Tank hat scheinbar ein Leck. Ich verliere Benzin. So kann ich unmöglich weiterfahren.«
»Ich verständige den Notarzt«, murmelt Priska. Sie steht noch immer völlig neben sich. Doch es macht keinen Sinn, diese Unbekannte darüber zu informieren, dass sie selbst in zwei Stunden vielleicht schon Geschichte ist. Mechanisch zieht sie das Handy aus ihrer Tasche und will bereits die 112 wählen. »Kein Empfang«. Sie und die blonde Frau sagen es gleichzeitig. Ungläubig schüttelt Priska den Kopf.
»Ja, mir ging es eben genauso«, erklärt die Hilfesuchende hastig. »Doch ich hatte gehofft, dass nur mein Handy spinnt. Können Sie mich nicht bis nach Matrei mitnehmen? Dort gibt es bestimmt einen Arzt.« Flehend blickt sie Priska an. Zu Elena sagt sie: »Mein Sohn dürfte in Deinem Alter sein. Er ist fünf.«
Elena antwortet nicht. Stattdessen presst sie sich noch ein wenig fester an ihre Mutter. Priska weiß nicht, was sie tun soll. Es widerstrebte ihr zutiefst, wildfremde Menschen in ihr Auto zu lassen. Schon allein wegen Elena. Zudem befindet sie sich gerade nicht in der besten Verfassung, um auch noch die Verantwortung für zwei weitere Menschen zu übernehmen. Andererseits würde sie es sich nie im Leben verzeihen, wenn der kranke Junge ihrem Misstrauen zum Opfer fiele.
»Ich bin übrigens Marlene. Marlene Weber. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich erst jetzt vorstelle, aber ich bin völlig runter mit den Nerven.« Ein harmloser, bodenständiger Name. Schnörkellos und ebenso beruhigend, wie ihr Aussehen und Verhalten. Aber vielleicht ist gerade das die Absicht dahinter? Forschend blickt Priska in Marlenes meerblaue Augen. Auf der Suche nach einem dunklen, onyxfarbenen Schimmer. Doch da ist nichts.
»Ich heiße Patricia … Patricia Lautenbach.«
Marlene scheint zu stutzen. Ein Augenblick, so kurz wie ein Wimpernschlag. Dann streckt sie Priska ihre Hand entgegen. Elena scharrt mit den Füßen im Kies und stiert auf den Boden. Die langen Locken verdecken ihr Gesicht. Falls sie überrascht ist, dass ihre Mutter einen falschen Namen genannt hat, lässt sie es sich zumindest nicht anmerken. Marlenes Hand schwebt noch immer in der Luft.
»Bitte halten Sie mich nicht für unhöflich. Aber wir sind auch etwas krankheitsanfällig. Da schüttele ich lieber so wenig Hände, wie möglich.« Eine weitere Notlüge.
»Ja, das kann ich verstehen.« Marlene zieht die Hand zurück. Ihr Gesichtsausdruck ist noch immer freundlich. Ihr Blick wandert zum Mercedes. «Ich möchte nicht drängeln, aber Jeremias braucht wirklich dringend einen Arzt. Und ein fiebersenkendes Mittel. Und ich möchte ihn auch nicht länger allein lassen. Er schläft auf dem Rücksitz.« Während sie zu ihrem Wagen zurückläuft, ruft sie: »Kommen Sie?«
Priska und Elena folgen ihr zögernd. Eigentlich lag Priska noch ein anderer Vorschlag auf der Zunge. Am liebsten hätte sie nur den Jungen mitgenommen und Marlene gebeten, bei ihrem Auto auf den Abschleppdienst zu warten. Doch die Worte der anderen Mutter zeigen deutlich, dass sie sich unter keinen Umständen von ihrem Kind trennen wird. Und sei es auch nur für eine halbe Stunde. Priska kann es ihr nicht verübeln. Priska würde genauso handeln. Außerdem will Marlene im Grunde das Gleiche wie sie: Weg von hier. Wenn sie der Feind ist, kann es doch nicht in ihrem Interesse sein, diesen Ort zu verlassen? Priska blickt zur Schlucht hinüber. Hohe Bäume verdecken den Abgrund. Soll sie dort hinunterstürzen? Seltsam. Hat sie etwa jahrelang für diesen Abgang geprobt? Am Rande der Schlucht stehend und sich fragend, wie es sich wohl anfühlte. Der freie Fall. Und dann der Aufprall. Bei dem Gedanken war sie immer sofort mehrere Schritte zurückgewichen. Nein, trotz all ihrer Probleme und depressiven Anwandlungen verspürt sie keinerlei Todessehnsucht.
Inzwischen sind auch Priska und Elena bei den Autos angekommen. Marlene hebt gerade ihren Sohn aus dem Kindersitz.
»Ohje, der Kleine sieht wirklich nicht gut aus«, entfährt es Priska. Der Junge schläft so tief, dass er beinahe bewusstlos zu sein scheint. Seine Haut ist wächsern und unter den geschlossenen Augen zeichnen sich violette Ringe ab. Das blonde Haar wirkt stumpf und plattgelegen. So, als sei er schon eine ganze Weile in diesem komatösen Zustand. Schnell eilt Priska zu ihrem Wagen und öffnet die Beifahrertür für die Marlene und Jeremias.
»Ich kann ihn Dir abnehmen, bis Du eingestiegen bist«, bietet sie Marlene an und streckt schon ihre Arme nach dem Kind aus.
Doch Marlene presst den Jungen nur noch etwas fester an sich und murmelt: »Danke, das geht schon.«
Als Marlene Platz genommen hat, geht Priska mit Elena nach hinten. Erst jetzt fällt Priska auf, dass Elena kein einziges Wort mehr gesprochen hat, seit Marlene aufgetaucht ist.
»Alles in Ordnung, mein Schatz?«, flüstert sie, während sie Elena anschnallt.
»Eleonore will mir dringend etwas sagen. Aber ich kann sie nicht verstehen. Sie ist zu weit fort.« Elena hat ebenfalls sehr leise gesprochen. Marlene scheint nichts gehört zu haben. Ihr blonder Haarschopf ist nach vorne gebeugt. Sicher ist das Einzige, an das sie momentan denken kann, das Wohlergehen ihres Sohnes. Mit weichen Knien geht Priska nach vorne. Als sie die Fahrertür schließt, zuckt sie kurz zusammen. Nun ist es beschlossene Sache. Sie werden die beiden Fremden mitnehmen. Aber bis Matrei ist es nicht weit. Und jeder Kilometer, der sie von dem unheimlichen Marterl wegbringt, ist ein Gewinn. Die Uhr am Armaturenbrett sagt ihr, dass inzwischen zehn Minuten vergangen sind. Es ist Punkt zwölf. »Um zwölf war sie fort und um eins schon dort.« Priska ist kurz versucht, noch ein paar Minuten zu warten. Nur, um die Prophezeiung Lügen zu strafen. Aber vielleicht hat sie sich geirrt und es stand doch ein anderer Name an der Tafel. Gut möglich, dass sogar das gesamte ominöse Marterl eine Sinnestäuschung war. Kurz bevor sie den Parkplatz verlassen, blickt Priska in den Rückspiegel. Das Mahnmal steht leider noch immer dort. Und darunter flackert eine unruhige Flamme. Die Kerze brennt. Priska fühlt Panik in sich aufsteigen. Ihre Hände zittern so stark, dass sie kaum das Lenkrad halten können. Krampfhaft versucht sie, sich zu beruhigen. Angst bringt sie jetzt auch nicht weiter. Das Wichtigste ist jetzt, dass sie sich auf die Straße konzentriert. Jeremias sollte angeschnallt auf der Rückbank sitzen und nicht vorne auf dem Schoss seiner Mutter. Eigentlich hätten sie sogar den Kindersitz aus dem Mercedes aus- und in ihrem Wagen einbauen müssen. Schon eine scharfe Bremsung kann ihm zum Verhängnis werden. Inzwischen hat der Regen wieder eingesetzt. Die grauen Wolken scheinen bis auf den Boden hinunterzureichen. Dichter Nebel beschränkt die Sichtweite auf unter fünfzig Meter. Und zu allem Unglück sind auch die Fliegen noch da und führen ihr enervierendes Tänzchen an der Windschutzscheibe fort.
»Danke«, sagt Marlene schlicht. »Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen.«
»Schon in Ordnung. Ich hoffe nur, dass wir heil ankommen.« Priska beugt sich nach vorne und klebt jetzt mit der Nase fast an der Frontscheibe. Um sie herum sirrt es. Mittlerweile dürfte es mehr als ein Dutzend Fliegen sein, aber sie hat keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Nur fort von hier.
»Ein schönes Puppenhaus hast Du da«, wendet sich Marlene an Elena und blickt dabei in den Innenspiegel.
»Ja, das hat mein Papa gebastelt«, antwortet Elena zögerlich.
»Und wer wohnt in diesem gemütlichen Heim?«
Priska weiß nicht, ob sie erfreut oder irritiert darüber sein soll, dass Marlene sich so interessiert an dem Feenhäuschen zeigt. »Bitte erzähl ihr nichts von Esmeralda«, beschwört sie Elena still. .
»Meine Puppe. Aber die habe ich leider zu Hause vergessen.«
Priska seufzt erleichtert auf. Marlene mustert sie kurz. »Das ist aber schade«, erwidert sie schließlich nachdenklich.
Der Nebel wird dichter. Priska orientiert sich am Mittelstreifen. Meter um Meter kämpft sie sich so voran. Was nicht von den Scheinwerfern erfasst wird, geht in der grauen Suppe unter. Kein Wunder, dass bei diesem Wetter niemand vor die Tür geht. Trotzdem ist es eigenartig, dass ihnen seit Ewigkeiten kein anderes Auto mehr begegnet ist. In Priska regt sich eine Ahnung, dass sie dem Alptraum noch lange nicht entflohen sind. Sie stecken mittendrin. Und das Schlimme daran? Aufwachen ist unmöglich. Priska wirft Marlene einen verstohlenen Seitenblick zu. Sie klammert sich an ihren Sohn wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. Auf dem blassen Kindergesicht haben es sich zwei Fliegen bequem gemacht. Eine putzt sich gerade. Marlene scheint es nicht zu bemerken. Offensichtlich ist sie sogar selbst ein Magnet für die kleinen Plagegeister. Sie sitzen überall. Auf ihrem Kopf, ihren Armen, ihren Oberschenkeln und Knien. Doch welchen Sinn hätte es, sie darauf anzusprechen? Solange sich die andere Frau nicht gestört fühlt, ist es Priska gerade recht, dass nicht noch zehn weitere Fliegen um sie herum schwirren. Ihr Blick wandert zur Geschwindigkeitsanzeige. Sie hat das Gefühl, dass sie immer langsamer werden, aber die Tachonadel zeigt nach wie vor sechzig Stundenkilometer an. Schneller traut sich Priska nicht zu fahren bei diesen katastrophalen Sichtverhältnissen. Wahrscheinlich liegt es nur daran, dass alles gleich aussieht. Deshalb hat sie den Eindruck, nicht vom Fleck zu kommen. »Wieso lügst Du Dir eigentlich dauernd selbst in die Tasche?«, schilt sie sich in Gedanken. »Damit ich nicht durchdrehe«, lautet die pragmatische und ebenso stille Antwort.
Wie geht das gleich nochmal? Visualisieren?
Während Priska krampfhaft weiter den weißen Streifen auf der Mittellinie folgt, versucht sie, sich das Lokal in Klausen vorzustellen. Das mit der unscheinbaren Fassade und der wunderschönen Sonnenterrasse. Die meisten Touristen hasten an dem dunklen, etwas zurückgesetzten Eingang vorbei. Doch die Eingeweihten wissen, dass sich hinter jener schmalen Pforte das Paradies eröffnet. Schnell den großzügigen Gastraum durchqueren und durch den Hintereingang auf die lichtüberflutete Veranda hinaustreten. Kleine, runde Tische mit bunt karierten Decken. Zierliche Stühlchen mit bequemen Sitzkissen. Und hinter der Balustrade der glitzernde Eisack. Wie oft war sie mit Ranieri dort gesessen? Einen großen Teller dampfender Pasta vor sich. An den Lippen ein Glas mit vollmundigen, dunkelrotem Lagrein. Und zu ihren Füßen ein paar freche Spatzen, mit denen sie lächelnd das köstliche Weißbrot teilen.
Beim Gedanken an die in freundliches und warmes Licht getauchte Terrasse spürt Priska, wie schmerzlich sie die Sonne vermisst. Sie kann es kaum erwarten, endlich dieser lähmenden Tristesse zu entfliehen. Trotz des Adrenalins, das durch ihre Adern rauscht, fühlt sie sich seltsam schwer und träge. Wenn sie jetzt zusätzlich von Müdigkeit übermannt würde, hätte sie noch ein Problem mehr. Erneut sieht sie auf die Uhr. Es ist kurz nach halb eins. Sie müssten doch längst in Matrei angekommen sein. Am Rande ihres Gesichtsfeldes registriert sie plötzlich ein schwaches Licht. Es bewegt sich parallel zu ihnen, besitzt jedoch nicht die Kraft, den Nebel zu durchbrechen. Was mag das nur sein? Ein Hoffnungsschimmer?
»Mama, es werden immer mehr Fliegen!« Elena klingt verängstigt. Sie hat recht. Es gibt mittlerweile kein Plätzchen mehr, das nicht von einer Fliege besetzt worden ist. Und um ihre Köpfe schwärmen schwarze Wolken. Priska weiß, wer sie schickt. Doch sie hat keine Ahnung, wie sie dieser Plage Herr werden soll.
»Mach lieber den Mund zu, mein Schatz. Und halte Dir am besten die Hände vors Gesicht. Ich will nicht, dass Du eines der Viecher verschluckst oder einatmest. Wir müssen jeden Moment da…« Priska schafft es nicht, ihren Satz zu beenden. Das, wovor sie ihre Tochter warnen wollte, passiert ihr selbst. Eine Fliege hat sich in ihren Mund verirrt. Oder ist sie absichtlich hineingekrochen? Das Insekt vibriert und schabt an Priskas Schleimhäuten, während es auf ihren Rachen zusteuert. Priska röchelt und spuckt die Fliege angewidert aus. Obwohl sie ihre brennenden Augen ohne Unterlass auf die Straße gerichtet hält, bemerkt sie, dass Marlene sie mustert. Kurz löst Priska ihren Blick von der Windschutzscheibe und richtet ihn auf die Frau neben ihr. Lächelt sie etwa? Priska ist sich nicht sicher. Und ist es nur Einbildung – oder sind ihre Augen dunkler geworden?
»Bitte entschuldigen Sie. Aber das sah eben ziemlich komisch aus«, erklärt Marlene kichernd. Angesichts der prekären Situation, in der sie sich befinden, wirken ihre Worte reichlich deplatziert. Verwirrt wendet sich Priska wieder der Straße zu. Sie ist froh, dass Marlene und Jeremias neben ihr und nicht bei Elena sitzen. Endlich gesteht sie sich ein, dass ihr Bauchgefühl sie nicht getrogen hat. Mit der Frau stimmt etwas nicht. Und ihr Sohn hängt die ganze Zeit wie eine leblose Stoffpuppe in ihren Armen. Atmet er überhaupt noch? Jetzt ist es auch schon egal. Bald würden die Masken ohnehin fallen. Instinktiv greift Priska zu dem Kind hinüber, um seinen Puls zu fühlen. Doch Marlene schlägt ihre Hand grob zur Seite, noch ehe es Priska gelingt, Jeremias auch nur anzufassen. Jäh zuckt sie zurück. Marlenes Berührung fühlt sich an wie der Biss der Kreuzspinne letztes Jahr. Nur hundertmal so stark. Das Gift legt sich direkt auf Priskas Atemwege. Geschockt schnappt sie nach Luft und kann von Glück reden, dass sie dabei nicht noch eine Fliege inhaliert. Es fällt ihr immer schwerer, sich auf das Fahren zu konzentrieren und das Lenkrad gerade zu halten. Absichtlich meidet sie Marlenes Blick. Sie spürt überdeutlich, dass die Frau sie anstarrt. Die Insekten an der Frontscheibe haben sich mittlerweile zu einem beweglichen, schwarzen Teppich formiert. Priska bleiben nur kleine Gucklöcher, durch die sie Ausschnitte der Straße erkennen kann. Es grenzt an ein Wunder, dass sie noch keinen Unfall gebaut hat. Unmöglich kann sie so weiterfahren. Ihre Energie ist aufgebraucht. Und mittlerweile ist sie überzeugt davon, dass sie Matrei auf diesem Wege niemals erreichen.
»Nach der nächsten Biege kannst Du halten«, hört sie Marlene sanft sagen. »Du hast es gleich geschafft…Priska…« Obwohl es einerlei ist, fällt Priska die veränderte Anrede auf. Im Zeitlupentempo quält sie sich um die Kurve. Die Kerze brennt noch immer. Ihr roter Schein weist ihnen den Weg. Es ist zehn vor eins, als sie erneut auf dem Platz neben der Schlucht halten.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  15.09.2016 21:23 15.09.2016 21:23
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 13: Tanz mit dem Dämon
Eine ungeheure Schwäche hat von Priska Besitz ergriffen. Marlene ist ein Dämon, der mit Engelszungen spricht. Trotzdem ist Priska geneigt, sich von ihren säuselnden Worten einlullen zu lassen. Sie ist so unsagbar müde. Zu müde sogar, um Angst zu verspüren. Allein die Liebe zu ihrer Tochter hält ihren Lebenswillen aufrecht. Bevor sie sich dem Tod zuwendet, der neben ihr geduldig auf seinen Einsatz wartet, wirft sie einen Blick in den Innenspiegel. Statt Elenas Augen begegnen ihr die des Geistermädchens. Eleonore hockt mit angezogenen Beinen neben dem Kindersitz. Die Arme hat sie um die Knie und ihre Puppe geschlungen. In einer wiegenden Bewegung schaukelt sie vor und zurück. Als wolle sie sich selbst beruhigen. Ihre Mimik kann Priska nicht recht deuten. Die Gesichtszüge des Gespensterkindes sind verschwommener als die letzten Male. Nur ihre dunklen Augen stechen hervor. Und sie sind angsterfüllt. Elena dagegen hat noch immer ihre Hände vorm Gesicht. Ob zum Schutz vor den Fliegen oder aus schierer Verzweiflung, vermag Priska nicht zu sagen. Soviel leichter wäre ihr ums Herz, wenn sie das Kind in Sicherheit wüsste. Instinktiv greift Priska nach hinten. Sie bekommt Elenas rechten Unterschenkel zu fassen und drückt ihn sachte. Ihre Tochter anzusprechen, traut sie sich nicht. Und was soll sie schon sagen: »Du brauchst keine Angst zu haben. Alles ist gut.« Nein, solche Worte helfen jetzt nicht. Sie würden alles nur noch schlimmer machen. Nichts ist in Ordnung. Inständig hofft Priska, dass Elenas Kinderseele unversehrt aus diesem Grauen hervorgeht.
»Deiner Tochter wird nichts geschehen, Priska. Das versichere ich Dir. Es ist nicht ihr Kampf. Noch nicht.« Marlenes Strahlen ist einnehmend wie das einer Hollywooddiva. Makellose, weiße Zahnreihen. Damit könnte sie für Zahnpasta werben. Der Junge auf Marlenes Schoß sieht aus wie tot. Priska muss schon genau hinsehen, um zu erkennen, dass sein Brustkorb sich sachte hebt und senkt. Eine Fliege krabbelt träge über seine blassen Lippen. Auch ihre Artgenossinnen sind zwar nicht weniger, aber ruhiger geworden. Sie sitzen überall. An der Windschutzscheibe, auf den Türgriffen, dem Schalthebel, am Innenspiegel und natürlich auf den vier Insassen. Das Geistermädchen ausgenommen. Es scheint so, als würden die Insekten auf etwas warten.
»Wer ist dieses Kind?«, fragt Priska unverblümt. Die Zeit des Schmierentheaters ist vorüber. Es gibt keinen Grund mehr, sich gegenseitig etwas vorzuspielen.
»Eine erste Anzahlung. Zur Begleichung der alten Schuld.« Beinahe zärtlich streicht Marlene dem Jungen eine blonde Haarsträhne aus dem weißen Gesichtchen. Sie macht dabei jedoch keine Anstalten, die penetranten Fliegen zu verjagen, welche ihn in Beschlag genommen haben wie ein Stück gammliges Fleisch. Sie hebt den Kopf und blickt Priska unverwandt an. Die Augen der Dämonin sind inzwischen so schwarz, dass Priska nicht einmal mehr die Pupillen erkennen kann. »Doch den größten Anteil dieser Schuld wirst du abgelten, Priska.« Marlenes selbstgefälliges Lächeln ist noch breiter geworden.
Priska spürt, wie ihre Angst einer unbändigen Wut weicht. Glaubt Marlene wirklich, sie ließe sich wie ein argloses Lamm zur Schlachtbank führen?
»Was soll das für eine Schuld sein?« Kaum haben die Worte Priskas Mund verlassen, da muss sie an ihren Traum von letzter Nacht denken. Ihr Gefühl sagt ihr, dass es die schwarze Frau ist, die hier die Fäden zieht und Marlene nicht eigenmächtig, sondern in ihrem Auftrag handelt. Hat dieses angebliche Schuld etwas mit Ranieri zu tun? Doch ein Zusammenhang mit ihm und der Spukgestalt aus dem alten Haus existiert doch nur in ihren Träumen. Oder? Priska schafft es nicht, die Gedankenfetzen zu sortieren, die in ihrem Kopf wild durcheinanderwirbeln. Sie weiß, dass sie unter Schock steht. Ihr Körper ist wie gelähmt, während ihr Hirn krampfhaft nach einem Ausweg sucht. Ein weiterer Gedankenschnipsel taucht vor ihrem geistigen Auge auf und hält kurz inne. Was hatte die Nichtnixe im Antermoiasee gefordert? Sie sollen erst die Verrückte und ihre Schergen loswerden? Inzwischen ist Priska sicher, dass damit die schwarze Geisterhexe gemeint war sowie die Kreaturen, die Priska des nächtens heimsuchen. Und hatte sie nichts von einem alten Pakt gesagt? Doch auch dieses Zusammentreffen hat lediglich im Traum stattgefunden. Einen Wimpernschlag lang fragt sich Priska, ob sie nicht auch jetzt, in diesem Moment, in Morpheus Armen liegt und gleich aufwachen wird. Wenn sie das hier überlebt, braucht sie dringend einen Anker. Irgendetwas, das ihr dabei hilft, Schlaf und Wachzustand zu unterscheiden.
»Weißt du das wirklich nicht, Priska?« Sanfter Tadel liegt in Marlenes Stimme. Sie klingt wie eine Mutter, die ihr ungehorsames Kind mit freundlicher Autorität zur Raison bringen will.
Priska schüttelt stumm den Kopf und starrt auf die beiden Fliegen, die gerade den kalten Schweiß von ihren Händen lecken. Fieberhaft überlegt sie, wie sie Marlene noch hinhalten kann. Bis ihr eine Lösung eingefallen ist. Es muss eine geben. Sie ist noch nicht bereit, zu sterben. Ohne ersichtlichen Grund schon gar nicht.
»Nein, ich habe keine Ahnung. Wärst Du so gütig, mich aufzuklären?« Trotz ihrer Verzweiflung kann sich Priska den sarkastischen Tonfall nicht verkneifen.
»Mir scheint, dass du den Ernst der Lage nicht erkennst.« Die Liebenswürdigkeit in Marlenes Zügen ist wie weggewischt. Ihr falsches Lächeln erinnert nun eher an ein Raubtier, das die Zähne bleckt. Die dunklen Augen vervielfachen sich. Es ist, als habe Priska zu viel getrunken. Sie sieht nicht nur doppelt, sondern dreifach. Marlenes zarter, milchweißer Teint wirkt plötzlich transparent und lässt die grässliche Fratze hinter der menschlichen Maske erahnen. Entsetzt weicht Priska zurück und wirft einen hastigen Blick in den Innenspiegel. Das Bild, welches sich ihr auf der Rückbank bietet, ist unverändert. Elena verbirgt ihr Gesicht noch immer in ihren zitternden Kinderhänden und Priska sehnt sich danach, sie in ihre Arme zu ziehen. Eleonore wiegt sich nach wie vor unaufhörlich vor und zurück.
»Im Grunde ist es einerlei. Denn gehen musst du sowieso. Vielleicht erhältst du deine Antworten im Jenseits. Von IHR selbst.« Auch Marlenes Stimme klingt verändert. Surrend und vibrierend. Unangenehm und hypnotisch zugleich.
Im selben Moment stöhnt plötzlich das Kind auf Marlenes Schoß auf. Ohne nachzudenken, greift Priska abermals zu ihm hinüber. Ein Reflex. Der Junge braucht dringend Hilfe. Sie kann nicht tatenlos dabei zu sehen, wie er stirbt. Gleich, was das Schicksal heute Nacht noch für sie selbst parat hält. Außerdem scheint es so, als ob Marlene den Jungen als Schutzschild benutzt. Sie braucht ihn. Doch das ist keine Symbiose. Diesem kindlichen Wirt kann der Parasit, der ihn aushöhlt, nur eines bieten: Den sicheren Tod. Marlene reagiert sofort. Einem Schraubstock gleich umschließen ihre lange Finger Priskas Handgelenk. Sie fühlen sich seltsam klebrig und rau an. Und so stark, als könnten sie Priskas Knochen mit Leichtigkeit zermalmen. Ihr klopft das Herz bis zum Hals. Marlenes Gift ist bleischwer und eiskalt. Es lähmt zuerst Priskas Fingerspitzen und kriecht dann über ihren Handrücken langsam den Arm hinauf. Zentimeter um Zentimeter erobert es Priskas Körper und entzieht ihr langsam, aber stetig ihre Lebensenergie. Verzweifelt versucht Priska, sich zu befreien, doch es ist, als befinde sie sich im Wachkoma. Ihr Gehirn erteilt Befehle und die Gliedmaßen regen sich nicht. Priska spürt, dass das Toxin an ihrem Herzen angelangt ist. Trotz ihrer Panik verlangsamt sich ihr Herzschlag und paradoxerweise kann sie kaum noch die Augen offenhalten.
»Lass dich einfach fallen, Priska. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dich besuche. Doch diesmal führen wir es zu Ende. Schlaf ein. Was gibt es für einen schöneren Tod?«
»Mama!«, gellt Elenas helle Stimme durch den Wagen. »Lass mich nicht allein! Du darfst nicht sterben!« Das verzweifelte Schluchzen ihrer Tochter bringt Priskas fast stillgelegtes Herz zum Beben. Es ist noch Leben in ihr und sie wird es nicht hergeben.
»Mein Schatz, ich sterbe nicht! Hab keine Angst!« Priska versucht, all ihre Überzeugungskraft in dieses Versprechen zu legen, das Marlene mit einem schallenden Lachen quittiert. Doch plötzlich rollt von hinten eine Art Druckwelle an Priska heran, drückt sich gegen ihren Rücken und hebt sie fast vom Sitz. »Eleonore«, schießt es Priska durch den Kopf. Genauso hat es sich angefühlt, als das Geistermädchen sie vor der Haustür zu Fall gebracht hat. Dieses Erlebnis scheint Jahre zurückzuliegen. Marlenes Gelächter verstummt augenblicklich. Sie hebt den Kopf. Ihre Nasenflügel zittern. Sie ähnelt einem Tier, das die Witterung aufnimmt. Priska kann Eleonore nicht sehen, doch sie fühlt sich wie im Auge eines Tornados. Durch den tosenden Geisterwind kann sie Marlene kaum noch ausmachen. Doch die Dämonenklaue hält ihr Handgelenk noch immer umklammert.
»Deine Geister können dir hier nicht helfen, Priska. Das ist unsere Dimension. Und sei dir gewiss: Es gibt noch mehr von uns. Ich bin nicht die Einzige, die dich jagt.« Marlenes Stimme klingt drohend, aber auch etwas desorientiert. Es mag sein, dass Eleonore ihr nichts anhaben kann, doch wenn der Auftritt des Geistermädchens als Ablenkungsmanöver gedacht war, ist er gelungen. Priska merkt, wie der tödliche Sog, der sie aus dem Bewusstsein und dem Leben zieht, ins Stocken gerät. Ihre rechte Körperhälfte ist nach wie vor taub und bewegungsunfähig, aber der linke Arm gehorcht zum Glück wieder den Kommandos aus der Schaltzentrale. Sie tastet sie nach dem Griff der Fahrertür. Als sie durch die wirbelnde Luft hindurch greift, peitschen unzählige Fliegen über ihre Hand und ihren Unterarm. Sie sind in dem Strudel gefangen. Fast empfindet Priska ein wenig Genugtuung. Vorsicht öffnet sie die Tür einen Spalt. Sie denkt daran, wie sie den Zugang zur Terrasse zum Bersten gebracht hat. Allein mit der Kraft ihrer Gedanken. Sie versucht, sich zu konzentrieren und wappnet ihren Geist gegen die dämonische Kraft, mit der er sich gleich konfrontiert sehen wird. Dann schickt sie ihn auf die Reise. Er muss nicht lange suchen. Schon bald stößt er auf eine schwarze Wand aus Gewitterwolken. Im Inneren der dunklen Masse zuckt und blitzt es. Priska bemüht sich, ihren Gedanken, die Schmetterlingen mit sanft tastenden Fühlern gleichen, eine andere Gestalt zu verleihen. Sie vereinen sich und werden zu gesichtslosen Kriegern, die ihre Speere in die undurchdringliche Mauer stoßen, die Marlenes Geist schützt. Doch die Wolken ballen sich noch mehr zusammen, um sich kurz darauf mit einem Schlag zu entladen. In Priskas Kopf wird es grell. Der mächtige Stromschlag bewirkt, dass ihr Gehirn verkrampft und die unerträglichen Schmerzen lassen sie zurückfahren.
»Glaubst Du wirklich, Du kannst mich mit Deinen telepathischen Taschenspielertricks besiegen?« Marlenes Lachen ist voller Hohn. Eine Welle der Hilflosigkeit und Verzweiflung schwappt über Priska hinweg. Sie hatte so sehr gehofft, dass es funktioniert.
»Der Junge ist fast bei mir. Er wird uns helfen.« Aus dem Tosen um Priska herum kristallisiert sich eine mädchenhafte Stimme heraus. Es ist das erste Mal, dass sie für Eleonore keinen Dolmetscher braucht. Sie kann das Geistermädchen tatsächlich hören. »Die Dämonin achtet gerade nicht auf ihn. Das ist gut. Kämpfe weiter, Priska!«
Es muss das Kind auf Marlenes Schoss sein, von dem Eleonore spricht. Zwar hat sie nicht ganz verstanden, was das Gespenstermädchen ihr sagen will. Doch sie wird die Chance ergreifen. Sei sie auch noch winzig. Erneut sendet sie ihre Gedankenkrieger aus und wieder prallt sie auf die bebende Wand.
»Hast Du immer noch nicht genug, du dummes Ding?«, zischt Marlene ungehalten. Priska sieht, wie sich die Wolken ein weiteres Mal bedrohlich auftürmen. Doch dann ändert sich die Szenerie. Priskas Speerkämpfer werden plötzlich von einem dampfenden Nebel eingehüllt, der vom Boden emporsteigt. Schnell hat er die Wolken erreicht und tränkt sie mit dem Wasser, das er mit sich führt. Zugleich wird der Wirbelsturm, der Priskas körperliche Hülle umgibt, stärker.
Priska hört, wie Marlene wütend schnaubt. Dann schreit sie. Es ist ein schriller, grauenhaft hoher Ton. Priska hat das Gefühl, dass ihr Schädel gleich zerplatzt. Vor ihrem geistigen Auge erscheint ein Kindergesicht. Jeremias. In seinen ozeanblauen Augen liegt verzweifelte Hoffnung. Der kleine Mund formt stumme Worte. Sie kann ihn nicht hören, aber spüren. Ihre Seelen berühren sich. Priska spürt ein schmerzliches Ziehen im Herzen. »Ich werde Dir helfen!«, ruft sie ihm in Gedanken zu. Die Wolken sind dank Jeremias nun schwer und träge und nicht mehr in der Lage, Priskas Geist mit elektrischen Schlägen zu traktieren. Als sie schließlich abregnen, löst sich der Griff um Priskas Handgelenk. Mit einem Ruck entzieht sie sich Marlenes Klaue und springt aus dem Wagen.
Von jetzt auf gleich ist es windstill und Priska muss aufpassen, dass sie nicht fällt. Ihr ist schwindelig. Doch sie kann nicht fliehen. Nicht ohne ihre Tochter. Mit bebenden Händen reißt sie die hintere Tür auf. Elena hat die Gurte zum Glück schon selbst gelöst. Im einen Arm hält sie noch immer das Feenhaus. Den anderen schlingt sie um ihre Mutter. Priska drückt das Kind an sich. So schnell es ihre Beine zulassen, rennt sie weg von Wagen und Abgrund. Doch als sie sich der Straße nähert, erkennt sie, dass dort unzählige, schemenhafte Gestalten auf sie warten. Der gesamte Fahrbahnrand ist mit ihnen gesäumt. Bestürzt weicht Priska zurück. Wo soll sie jetzt hin. Ihr gehetzter Blick schweift ziellos umher und wird schließlich von dem Marterl mit ihrer Todesankündigung eingefangen. Die Kerze auf dem Brett brennt hell. Doch da ist noch ein zweites Licht. Nicht ganz so klar und stark. Es zittert und flackert und sieht aus, als befinde es sich hinter einem grauen Vorhang. Im einen Moment scheint es fast zu erlöschen, doch im nächsten fängt es sich bereits wieder. Sein schwaches Leuchten hat für Priska eine magische Anziehungskraft, die sich selbst nicht erklären kann. Während sie auf das gespenstische Licht zu stolpert, klammert sich Elena so fest an ihren Hals, dass Priska fast die Luft wegbleibt.
»Wir schaffen das, mein Schatz«, flüstert sie ihrer Tochter ins Ohr. Elena schmiegt ihr Köpfchen noch dichter an Priskas Wange.
»Ich habe solche Angst, Mama«, schluchzt sie leise.
»Ich auch«, denkt Priska. Doch sie spricht die Worte nicht aus. Stattdessen bedeckt sie Elenas Kopf mit unzähligen Küssen. Ihre heißen Tränen versickern in den dichten Locken.
Inzwischen sind sie bei dem seltsamen Licht, das neben der Grabkerze schwebt, angelangt. Hinter ihr knirscht der Kies. Er verrät schon von Weitem die Schritte, welche sich ihnen zielstrebig nähern. Ein kurzer Blick hinter die Schulter bestätigt Priskas Vermutung, dass es sich um Marlene handelt. Sie wird diesen Kampf erst für beendet erklären, wenn einer von ihnen beiden tot ist. In ihren Armen hält sie den halbtoten Jungen. Seine Gliedmaßen baumeln schlaff und leblos herab. Priska muss an seinen flehenden Blick denken und ihr schnürt sich das Herz zusammen. Sie muss ihm helfen.
Das weißliche Licht vor ihnen flackert und verändert ständig seine Form. Im einen Moment scheint es sich beinahe krampfhaft in ein längliches Gebilde zu zwingen. Im nächsten Augenblick schrumpft es erneut in sich zusammen. Als Priska noch etwas näher herantritt, fängt die Luft um sie herum an, zu sirren und zu vibrieren.
»Priska, ich schaffe es nicht, zu dir durchzudringen. Die Mahre schirmen mich ab. Eleonore hat ein Schlupfloch gefunden. Doch nach der Aktion von eben fehlt ihr die Energie, um sich nochmal zu manifestieren.« Ranieri. Er ist es wirklich. Hoffnung keimt in Priska auf. Sie hat das Gefühl, als hätte ihr jemand eine wärmende Decke um die Schultern gelegt. Die Schritte in ihrem Rücken werden lauter und Elena krallt sich mit jedem Meter, den Marlene näher kommt, fester in Priskas Rücken.
»Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, Priska? Dass du diese Dämone in deinen Träumen bekämpfen kannst? Im Wachzustand hast du keine Chance. Nicht, solange sie den Jungen bei sich hat. Sie ist zu stark.« Priska muss sich konzentrieren, um ihn zu verstehen. Eine Art statisches Rauschen überlagert seine Stimme.
»Ich weiss auch noch, dass du gesagt hast, ich sei in meinen Träumen sicher. Doch vorhin wollte mich Marlene umbringen, indem sie mich einschläfert. Im wahrsten Sinne des Wortes.« Priska bemerkt selbst ihren vorwurfsvollen Tonfall, doch sie kann sich nicht vorstellen, in dieser lebensgefährlichen Situation ans Schlafen zu denken. Gerade sie. Die größte Insomnikerin, die dieser Planet je gesehen hat. Beinahe hätte sie bitter aufgelacht. Außerdem kommt es nicht in Frage, dass sie Elena einfach sich selbst überlässt. An diesem gottlosen Fleck, umgeben von alptraumhaften Kreaturen.
»Elena hat die Fee. Vielleicht kennt sie einen Schutzzauber. Für dich ist das allerdings keine Lösung. Du musst Marlene auslöschen, um euch zu retten. Theoretisch ist es möglich, dass du im Traum stirbst. Ja. Die Aufhocker legen es sogar darauf an. Es ist ihre übliche Masche. Doch das Biest unterschätzt deine Macht. Du musst…«
»Es ist soweit, Priska. Zeit, zu gehen.« Eisiger Atem bläst Priska in den Nacken und Elena wimmert entsetzt auf. Priska fährt herum und blickt direkt in Marlenes kalte, pupillenlose Augen. Während die Dämonin einen weiteren Schritt auf sie zumacht, spielt ein bösartiges Lächeln um ihren Mund.
»Es ist dein Glückstag. Du darfst dir aussuchen, ob du springen oder im Schlaf sterben willst. Glaub mir: Durch meine Hand zu sterben, ist wesentlich angenehmer.« Sie kichert. »Aber ich gebe zu, dass ich da wenig objektiv bin. Schließlich käme mir so eine kleine Energiespritze sehr gelegen.«
Mit diesen Worten rückt sie noch ein Stückchen näher und Priska weicht automatisch zurück. Nur wenige Meter hinter ihr befindet sich die Schlucht. Eine Baumreihe verbirgt sie vor neugierigen Blicken. Doch Priska weiß, dass sie da ist. Fieberhaft überlegt sie, ob sie tatsächlich Ranieris Ratschlag folgen soll. Ein Sturz in die Tiefe bedeutet jedenfalls den sicheren Tod. Sie kann förmlich spüren, wie sich hinter ihr der gähnende Abgrund auftut.
Marlene drängt sie immer weiter zurück.
»Ein bisschen mehr Entscheidungsfreude stünde dir gut zu Gesicht, Liebes.« Höfliche Worte aus dem Mund des personifizierten Bösen. Marlenes Gesichtszüge sind mittlerweile so verzerrt, dass sie trotz ihrer fraulichen Maske nichts Menschliches mehr an sich haben. Sie gibt sich keine Mühe mehr, die Mimik eines sterblichen Geschöpfes glaubhaft zu imitieren. Für einen kurzen Augenblick stellt sich Priska vor, welch groteskes Bild sie einem unbeteiligten Beobachter bieten mögen. Zwei Mütter mit ihren Kindern auf dem Arm. In einem stummen Todestanz am Rande der Schlucht.
»Kann Esmeralda dich wirklich mit einem Schutzzauber belegen?«, wispert sie Elena hastig ins Ohr. Die Fee reagiert schneller als das Mädchen. Zwar ist das Häuschen außerhalb ihrer Sichtweite, weil Elena es über ihre rechte Schulter hält, doch sie spürt, wie es in ihrem Rücken plötzlich warm wird.
»Was zur Hölle..!« Marlenes Blick wandert von Priska weg und heftet sich statt dessen auf Elena. Zorn, aber auch Verunsicherung huschen über die Parodie eines weiblichen Gesichtes. Auch Priska nimmt nun den goldenen Wirbel wahr, der sich um ihre Tochter gebildet hat. In Sekundenschnelle umhüllt er ihre Gestalt. »Es scheint zu funktionieren«, denkt Priska erleichtert. Marlene hat sich inzwischen wieder gefasst. Mit einem Satz springt sie nach vorne. Als ihre langen Finger auf sie zu schnellen, erkennt Priska die Widerhaken an den Spitzen. Vor ihren Augen verwandeln sich Marlenes Finger in behaarte Spinnenbeine, die nach ihrer Beute tasten. Erschrocken weicht Priska noch einen Schritt zurück. Als sie ihren rechten Fuß aufsetzt, bröckelt der steinige Untergrund. Noch einen Schritt weiter und sie und Elena stürzen in die Tiefe. Sie sitzen in der Falle. Marlene befindet sich nun direkt vor ihr. Fauliger Atem steigt Priska in die Nase. Die Spinnenbeine jedoch greifen vergeblich nach Elena. Sie vermögen den transparenten, leuchtenden Kokon nicht zu durchdringen.
»Priska, ich halte mich an meine Versprechen«, säuselt die Dämonin. »Deiner Tochter wird nichts passieren. Aber jetzt lass die Spielchen. Spring oder nimm meine Hand.«
»Träum Dich an einen schönen Ort, Priska. Einen, der die Kraft gibt.« Priska zuckt fast zusammen, als ihr Ranieris Stimme unvermittelt ins Ohr raunt. Sie wendet sich Marlene zu:
»Bevor ich dich anfasse, möchte ich weg von der Schlucht. Ich werde mich unter den Baum da setzen. In Ordnung?« Ohne Marlenes Antwort abzuwarten, schiebt sich Priska an ihr vorbei und lässt sich am Stamm einer Birke nieder. Sie kann sich jedoch nicht dazu überwinden, Elena abzusetzen und ihre Tochter würde es auch nicht zulassen. Es muss so gehen. Ein leichter Wind ist aufgekommen. Fröstelnd zieht Priska ihr Kind noch ein wenig näher an sich.
Mit einem siegessicheren Lächeln nimmt auch Marlene Platz. Abgesehen von den Spinnenbeinen und ihrer dämonischen Fratze ist ihre menschliche Hülle noch intakt. Fürsorglich bettet sie den komatösen Jeremias auf ihren Schoß. Ein Teil ihrer behaarten Gliedmaßen umschlingt seine Körpermitte. Der Rest streckt sich Priska entgegen.
»Mein Schatz, es wird jetzt so aussehen, als ob ich schlafe. Aber ich bin bei Dir. Und Du bist in Sicherheit. Vertrau Esmeralda.« Elenas Antwort ist ein Kuss, den sie Priska in die Halskuhle drückt. Marlenes missbilligender Blick bei der Erwähnung der Fee ist nicht zu übersehen. Glücklicherweise scheint sie den Schutzzauber nicht brechen zu können. Priska holt tief Luft und berührt dann angeekelt und mit klopfendem Herzen das Spinnenbein, welches ihr am nächsten ist. Unter dem braunen, borstigen Fell vibriert es. Im gleichen Moment bohrt sich der Widerhaken in Priskas Handgelenk und schon strömt Marlenes ureigenes Narkotikum durch Priskas Venen. Das Letzte, was sie hört, bevor sie das Bewusstsein verliert, ist das Rauschen der Birkenblätter über ihr.
Das sanfte Rascheln geht bald über in ein mächtiges Tosen. Als Priska die Augen aufschlägt, sieht sie schäumende Wellen ans Ufer branden. Die Gischt glitzert im hellen Sonnenlicht. Ein strahlend blauer Himmel wölbt sich über Strand und Ozean. Möwen kreischen in der Luft und es riecht nach Salz und Algen. Vor ihr Wasser, soweit das Auge reicht. Und hinter ihr die sanften Dünen. Priskas nackte Zehen graben sich in den kühlen, weichen Sand. Für einen Moment ist sie glücklich und unbeschwert. Sie möchte glauben, dass dies hier die Realität ist. Und jener von Dämonen regierte, dunkle Ort, an dem ihr Körper unter der Birke sitzt, nur ein böser Alptraum. Sie denkt an Elena und ihr Herz, das eben noch vor Freude hüpfte, krampft sich jäh zusammen. Gleich wird sie um ihr Leben kämpfen. Und sie weiß noch nicht einmal, was ihre Waffen sind. Geschweige denn, wie sie sie einsetzen soll. Es behagt ihr nicht, dass dieser Strand so menschenleer ist. Andere Leute würden ihr Sicherheit vermitteln, auch wenn sie ihr nicht helfen können. Es ihr Traum. Ihr Unterbewusstsein. Und sie ist der Architekt. Konzentriert versucht sie sich vorzustellen, dieser Strand sei von fröhlichen, badenden und am Ufer flanierenden Menschen bevölkert. Zuerst hört sie es nur. Kinderlachen. Stimmengewirr. Dann rennt ein Junge an ihr vorbei und schmeißt sich johlend in die Fluten. Ein paar Meter neben ihr liegt ein Paar händchenhaltend auf zwei Badetüchern.
»Ich bin beeindruckt, Priska. Zum Sterben schön, dieser Ort.« Priska wirbelt herum. Hinter ihr steht Marlene. Ein weißer Sommerrock umspielt ihre gebräunten Knie. Die blutrot geschminkten Lippen unter der überdimensionalen Sonnenbrille lächeln.
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  02.10.2016 13:57 02.10.2016 13:57
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 14: Am Traummeer
Dort, wo die Ausläufer der schäumenden Brecher sanft ans Ufer schwappen, sitzen zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Sie kehren Priska den Rücken zu. Etwas an ihnen ist anders als an den imaginären Gestalten, die Priska bewusst in ihren Traum gepflanzt hat. Die Sonne blendet sie. Doch die Umrisse der Beiden erscheinen ihr vertraut. Sie hebt die Hand und schirmt ihre Augen ab. Zuerst fällt ihr das blonde Haar des Jungen auf. Es leuchtet golden im gleißenden Licht und erinnert sie an Ranieri. Dann erkennt sie die rote Schleife auf dem Kopf des Mädchens. Und das gerüschte Kleid, welches die kleine Gestalt wie einen Fächer umgibt. Der Junge trägt noch immer die dunkle Jeans und das bunte T-Shirt, auf dem sich vorhin noch zahlreiche Fliegen tummelten. Als hätten sie gespürt, dass sie beobachtet werden, drehen sich Jeremias und Eleonore gleichzeitig um und winken ihr zu. Egal, wie trügerisch diese Idylle auch sein mag: Priska freut sich, dass sie da sind. Das Geistermädchen und der kleine Junge, der gerade an der Schwelle zum Jenseits entlangbalanciert. Sie winkt zurück. Die Kinder lächeln. Es ist das erste Mal, dass Eleonore so unschuldig wirkt, wie sie früher einmal gewesen sein muss. Ein kleines Mädchen, das mit ihrem Freund Sandburgen baut. Keine seelenlose Wachspuppe auf einem alten Foto. Keine Ansammlung negativer Energie. Keine düstere Erscheinung mit dunklen Höhlen statt Augen und einem hämischen Grinsen im flackernden Antlitz.
»Sie haben es also auch geschafft, hierher durchzudringen.« Marlene tritt neben Priska. Das sechsäugige Monster hat sich in ihr Inneres zurückgezogen und die Maskerade ist wieder perfekt. Vollendet bis in die Fingerspitzen mit den rotlackierten Nägeln. Diese krallen sich jedoch statt in Priskas Fleisch in den Rand des hellen Strohhutes, der Marlene vom Kopf zu segeln droht. Aber ihre Präsenz alleine reicht schon aus, um Priska zu lähmen. Und sie fühlt, wie das Gift der Dämonin in ihren Adern pulsiert. Obwohl sie sich kaum bewegen kann, ist Priska bis in die kleinste Körperfaser angespannt und bereit, sich zur Wehr zu setzen. Fast hofft sie, dass es bald zum Kampf kommt. Diese Ruhe vor dem Sturm ist unerträglich.
»Ich werde mich diesmal nicht wie ein wildes Tier auf dich stürzen, Priska«, erklärt Marlene beiläufig, während ihr Blick über den glitzernden Ozean schweift. »Mir stehen noch andere Methoden zur Verfügung. Diese Umgebung verlangt nach einem eleganteren Abgang. Oder wie siehst du das?«
Priska wird erst jetzt bewusst, dass Marlene sich in ihrem Kopf befindet und auch ihre verstohlensten Gedanken kennt. Deshalb nimmt sie wohl auch Eleonore und Jeremias wahr. Die Dämonin sieht mit Priskas Augen. Sie denkt mit ihrem Hirn und fühlt mit ihrem Herzen. Priska ist ihr mit all ihren Sinnen ausgeliefert. Sie spürt, wie die Hoffnungslosigkeit ihren Geist nach Schwachstellen abtastet. Mit einem Mal scheint das Meer nicht mehr ganz so blau und die Sonne verschwindet hinter einer dunklen Wolke, die aus dem Nichts aufgetaucht ist. Die Wellen werden höher und die windigen Böen zudringlicher. Priska sammelt all ihre Konzentration, um der Verwandlung ihres persönlichen Paradieses entgegenzuwirken und die Hölle auszusperren.
Plötzlich merkt sie, wie der Sand unter ihren nackten Füßen nachgibt. Ehe sie es sich versieht, steckt sie bis zu ihren Knien in der rieselnden Masse. Und sie sinkt immer tiefer. Die Badegäste um sie herum nehmen keinerlei Notiz davon, dass der Sand sie langsam verschluckt. All diese Menschen sind lediglich Statisten in ihrem Traumfilm. Seelenlose Phantasiegestalten. Keine mitfühlenden und eigenständig handelnden Personen. Priska fühlt, wie Panik in ihr aufsteigt. Verzweifelt versucht sie, den Sand mittels ihrer Gedanken in einen festen Untergrund zu verwandeln. Doch das Bild eines asphaltierten Weges passt nicht in diese Kulisse und sie scheitert. Inzwischen reicht ihr der Sand bis unter die Achselhöhlen. Ihre Hände finden keinen Halt. Unmöglich kann sie sich selbst aus diesem kühlen, weißen Sumpf, der sie in wenigen Sekunden lebendig begraben wird, befreien. Je mehr sie sich bewegt, desto schneller rutscht sie nach unten. Hektisch blickt sie sich nach einem Rettungsanker um. Doch da sind nur Marlenes gebräunte Füße, die in strassbesetzten Zehensandalen stecken.
»Gleich wird Sand in deine Nase dringen. Dann wirst du den Mund öffnen, um nach Luft zu schnappen. Auch er wird sich mit Sand füllen.« Die hypnotische Stimme der Dämonin schwebt über ihr. Der Sand umschließt nun Priskas Hals und kitzelt sie am Kinn.
»Du bist in MEINEM Kopf. Und Du bist nicht willkommen!« Beherzt greift Priska mit beiden Händen nach Marlenes schmalen Fesseln. Die Teufelin in Menschengestalt keucht überrascht. Sie macht einen Schritt zurück, um sich aus Priskas Umklammerung zu lösen. Dabei gerät sie ins Straucheln. Doch Priska lässt nicht locker. Verbissen versucht sie, sich an Marlenes Beinen aus der sandigen Todesfalle zu ziehen. Aber die Dämonin hat nicht vor, Priska Schützenhilfe zu leisten und setzt alles daran, um ihre Gegnerin abzuschütteln. Die schlanken Frauenbeine weichen erneut den behaarten Gliedmaßen der widerwärtigen Kreatur, die hinter der hübschen Fassade lauert. Aber dieses Spielchen kennt Priska inzwischen. Sie hat keine Angst mehr. Stattdessen tobt in ihr eine heiße Wut. Sie taucht den Strand als Spiegelbild ihrer Seele in ein rötliches Licht. Unbeirrt gräbt sie ihre Finger in die dürren, borstigen Spinnenbeine. Sie legt es förmlich darauf an, dem Monstrum Schmerzen zu bereiten. Marlene stürzt rücklings zu Boden. Halb sitzend, halb liegend, robbt sie von dem Sandloch weg. Genau das hat Priska sich erhofft. Mit jedem Zentimeter, den ihre Kontrahentin nach hinten rutscht, hilft sie Priska, ihrem Gefängnis zu entkommen. Der Zorn verleiht ihr ungeahnte Kräfte. Er reißt sie aus ihrer Lethargie und spült Marlenes lähmendes Gift aus ihren Zellen. In einer anderen Wirklichkeit sitzt Priska noch unter der Birke. Mit Elena auf dem Schoß und Marlenes Krallen in ihrem Unterarm. Doch hier, am Traummeer, kehrt sich das Machtverhältnis allmählich um. An diesem Ort ist es Priska, die Marlene in ihren eisernen Griff zwingt. Das Triumphgefühl, das langsam in ihr aufsteigt, erstickt sie trotzdem sofort im Keim. Der Kampf ist noch lange nicht gewonnen.
Ein Zittern fährt durch den Körper der Dämonin. Priska spürt, wie die Gliedmaßen unter ihren Finger beben. Die kurzen Ärmel von Marlenes Sommerbluse können nicht verbergen, dass sich nun auch ihre Arme verwandelt haben. Kaum hat sie die überlangen Spinnenbeine neben sich auf den sandigen Boden gesetzt, bemerkt Priska entsetzt den enormen Kraftzuwachs und die gesteigerte Körperspannung. Der luftige Rock zerreißt und im selben Moment platzt auch die Bluse auf. Priska beobachtet perplex, wie die Knöpfe von Marlenes Oberteil springen und in den Sand kullern. Der pralle Spinnenleib kommt zum Vorschein. Unter dem behaarten Chitinpanzer pulsiert es. Einzig und allein der Kopf der Dämonin ist noch nicht mutiert. Doch dieser groteske Anblick eines Frauengesichts mit roten Lippen auf einem fetten Spinnenkörper ist sogar noch grässlicher, als wenn sich das Monstrum sich komplett verändert hätte. Doch Priska bleibt keine Zeit, angewidert zu sein. Die lebenden Stecken in ihren Händen fuchteln wild und setzen alles daran, sich ihr zu entziehen und den Körper des Ungeheuers in eine andere Position zu bringen. Priska kann sich nicht mehr lange festhalten und ihre Verzweiflung nährt Marlenes Kraft. Ihre Blicke begegnen sich. In Marlenes Augen glitzert es gefährlich. Und um ihre Lippen spielt ein siegessicheres Lächeln. Priska weiß, dass ihre Panik kontraproduktiv ist, doch sie kann nicht verhindern, dass die Angst zurückkehrt. Für einen kurzen Augenblick hält die Dämonin in ihren wilden Bewegungen inne. Dann schnellt sie empor und wirft sich mit einem Ruck auf den Bauch. Dabei entgleitet Priska eines der Spinnenbeine. Geistesgegenwärtig schlingt sie stattdessen beide Hände um die verbliebene Gliedmaße. Das Ungeheuer krabbelt in Windeseile über den Strand und schleift Priska hinter sich her. Der aufgewirbelte Sand brennt in Priskas Augen. Sie sieht kaum noch etwas. Das Tosen der Wellen wird lauter. Offensichtlich steuert das Monstrum das Meer an.
Fieberhaft überlegt Priska, wie sie die Dämonin aufhalten kann. Gerade pflügen sie durch eine Menschentraube. Die Leute stieben aufgescheucht auseinander. Sie haben die Beiden nun also doch bemerkt. Aber warum? Weil Priskas Unterbewusstsein es für logisch erachtet, dass diese Situation für Aufmerksamkeit sorgt. In diesem Moment kommt Priska eine Idee. Und sie spürt, wie die Stimme der Panik in ihr schlagartig verstummt. Sie ist die Puppenspielerin und sie hat die Fäden in der Hand. Sie konzentriert sich und dirigiert ihre Marionetten mit der Kraft ihres Gedanken, eine menschliche Mauer zu bilden. Zwischen ihnen und dem Ozean. Das Monstrum wird langsamer. Es funktioniert also. Immer mehr Menschen versammeln sich auf Priskas Befehl entlang des Ufers. Die steife Meeresbrise treibt Priska Tränen in die Augen und schwemmt die Sandkörner aus ihren Lidern. Direkt vor ihr stehen Jeremias und Eleonore. Sie halten sich an den Händen und blicken Priska beschwörend an. Der lumineszierende Schein um ihre Gestalten hebt sie von den menschlichen Figuren rundherum ab.
»Priska, pass auf! Sie versucht, zu entkommen.« Eine weitere Person gleitet in Priskas Gesichtsfeld. Die Umrisse sind weniger deutlicher zu erkennen als bei den beiden Kindern. Dafür ist das Flimmern und Flackern, welches den transparenten Körper umgibt, umso stärker ausgeprägt. Im ersten Moment ist Priska einfach nur glücklich, dass Ranieri es auch in ihren Traum geschafft hat.
Kurz blitzt eine alte Erinnerung vor ihrem geistigen Auge auf und die aktuelle Traumkulisse verschwimmt. Sie sieht sich selbst. Wie ein Äffchen hängt sie auf Ranieris Rücken. Ihre Arme hat sie um seinen Hals geschlungen und die langen Beine um seine schmalen Hüften in den marineblauen Badeshorts. Priska trägt ihren perlenbestickten Bikini. Inzwischen sind die ehemals leuchtenden Farben ausgeblichen. Unter ausrangierten Négligés fristet das gute Stück ein trauriges Dasein in der alten Kommode auf dem Speicher. Doch jetzt gerade ist sie wieder siebzehn. Ihrer beider Haut schimmert bronzefarben und zeugt von vielen glücklichen Stunden an der Adria. Priska vergräbt jauchzend ihr Gesicht in Ranieris dichtem Blondschopf, als er sich lachend mit ihr zusammen in die Fluten stürzt. Kurz tauchen sie unter und Priska löst sich vom Rücken des Geliebten. Stattdessen umfasst er ihre Taille, um sie dicht an sich zu ziehen. Sie sind noch nicht wieder an der Oberfläche, da berühren sich schon ihre Lippen. Sie kann noch immer das Salz schmecken und sein klopfendes Herz spüren. Bittersüßer Schmerz, aber auch Zuversicht erfüllt sie.
Bis sie sich der Bedeutung von Ranieris Worten bewusst wird. Der Erinnerungsfetzen verblasst. Gleichzeitig fühlt sie, wie der Spinnenschenkel in ihrer Hand weicher und zu einem formlosen Brei wird, den sie kaum noch greifen kann. Sie blickt nach oben. Die Konturen des alptraumhaften Rieseninsekts mit dem Menschenschädel verschwimmen. Marlene will sich tatsächlich aus dem Staub machen. Priska weiß, dass sie der Dämon nur im Traum gewachsen ist. Verzweifelt überlegt sie, wie sie das Geschöpf dazu zwingen kann, in ihrem Traum zu bleiben. Noch hat Marlene es nicht geschafft, sich aus Priskas Umklammerung zu lösen. Die wild zuckende Masse in ihrer Hand ist immerhin noch stofflicher Natur. Der Rest von Marlenes Körper flackert verdächtig und wird immer transparenter. Auf einer anderen Bewusstseinsebene beobachtet Priska die Dämonin dabei, wie sie in menschlicher Gestalt durch ihr Gehirn hastet. Sie sucht nach einem Schlupfloch, durch das sie nach draußen gelangen kann. Angestrengt konzentriert sich Priska darauf, Marlene in ihrem Kopf einzusperren. Die Gehirnwindungen werden zu einem Labyrinth ohne Türen. Verborgene Kammern am Rande von Priskas Verstand zu dunklen Verliesen. Gleichzeitig hängt sie sich in ihrem Traum mit aller Kraft an die gräuliche Materie, die einmal ein Bein war.
Gerade, als sie merkt, dass sie diesem mentalen Spagat nicht mehr länger gewachsen ist, ändert sich etwas an der Traumkulisse. Zuerst nimmt Priska die Bedrohung nur aus dem Augenwinkel wahr. Ein dunkler Schatten türmt sich hinter der künstlichen Menschenkette auf. Im selben Moment hört sie Ranieri neben sich:
»Priska, du musst sie vernichten! Jetzt!« Eine körperlose Stimme. Ranieris Erscheinung ist wieder zu dem Licht neben der Totentafel geworden. »Um mich zu manifestieren, fehlt mir die Energie. Von dir kann ich sie mir nicht borgen. Diesmal nicht. Du brauchst deine Kraft selbst. Beeil dich!«
Als Priska alarmiert den Blick hebt und ihn aufs Meer richtet, stockt ihr der Atem. Eine gigantische Flutwelle rollt auf das Ufer, die menschlichen Figuren, die Geister und sie selbst zu. Nun vernimmt sie auch das Tosen und Zischen der gewaltigen Wogen. Priska hat keine Zeit. Sie möchte sich nicht ausmalen, wie die Riesenwelle die Mauern ihres Verstandes niederreißt, ihr Bewusstsein auslöscht und die Kinder verschlingt. Das darf einfach nicht passieren.
»Jeremias, Eleonore! Kommt her! Schnell!« Priskas Stimme überschlägt sich, als sie die Geister zu sich ruft. Die Beiden reagieren sofort. Eleonores dunkles Haar fliegt, als sie mit Jeremias an der Hand zu rennen anfängt. Geschickt weichen die Kinder Marlenes Tentakeln aus. Sie vermag es nicht, diese kleinen, starken Seelen aufzuhalten. Doch die schwarze Wasserwand hat sie fast erreicht. Sie ist zu nah und zu hoch, als dass Priska noch bis ganz nach oben blicken kann, wo die wütende Gischt brodelt und tobt. Gleich wird die Welle brechen und sie alle unter sich begraben.
»Haltet euch an mir fest!«, schreit sie. Augenblicklich fühlt Priska den elektrischen Sog, der an ihren Armen, die immer noch das letzte greifbare Stück des Höllenwesens umklammern, zieht. Geballte, Funken sprühende Energie. Zusammen schaffen sie es. Sie merkt, wie neue Kraft und Zuversicht durch ihre Adern strömen.
»Mama! Wach auf! Marlene bewegt sich.« Das ist Elena, deren Flehen wie ein Messer in Priskas Bewusstsein und ein Loch in ihren Traum schneidet. Priskas Puls verdreifacht sich. So schnell ihr Verstand es zulässt, springt sie zurück in die Dunkelkammern ihres Geistes. Marlene eilt jetzt nicht mehr hin und her. Sie steht ruhig vor ihr und wartet darauf, dass die Welle diese Räume flutet. Ihr stechender Blick spricht Bände. Nervös tastet Priska nach den Kindern. Sie kann sie nicht sehen, aber spüren. Der Geisterwind umschließt Priska wie eine schützende Rüstung. Auch Ranieri ist ihr auf diese Bewusstseinsebene gefolgt. Der Widerschein seines Lichts erhellt die Wand zu ihrer Rechten.
»Mama!« Elenas Rufe klingen näher. Und da sieht Priska endlich den Spalt. Er leuchtet kurz auf, als Ranieris Flackern ihn streift. Im nächsten Moment ist er wieder verschwunden. Doch Priska würde die Stelle auch blind wiederfinden. Obwohl die Wassermassen bereits gegen ihre Gehirnwände drücken, holt sie Luft, um sich zu sammeln. Ihre und Marlenes Blicke begegnen sich. Erkenntnis blitzt in den pupillenlosen Augen der Dämonin auf. Im gleichen Moment löst Priska am Traummeer ihre Verbindung und lässt das, was von Marlenes Bein übrig ist, aus ihrer Hand gleiten. Gleichzeitig umfasst sie mit beiden Armen die Kinder neben sich – eine eher symbolische Geste, da sie den unsichtbaren Strom nicht wirklich zu greifen vermag. Zusammen hechten sie auf den verborgenen Ausgang zu. Am Rande ihres Gesichtsfeldes registriert sie, wie Marlene zum Sprung ansetzt. Es ist zu früh. Noch sind sie nicht am Ziel. Im Laufen dreht sich Priska um. Alles in ihr ist auf Abwehr programmiert. Und sie spürt, wie ihre Gedankenkraft zurückkehrt. Die Kinder an ihrer Seite stärken sie und helfen Priska, das ganze Potential ihrer Macht zu entfalten. Ihr Sichtfeld verengt sich und schrumpft zu einem Tunnel zusammen, durch den die Dämonin auf sie zurast. Priska stellt sich vor, wie die diese Ausgeburt der Hölle an einer unsichtbaren Trennwand abprallt und benommen zu Boden taumelt, während hinter ihr die Welle durch die Mauer bricht und über Marlene zusammenstürzt. Dieses Gedankenbild schwebt noch über ihr, als sie sich gemeinsam mit den Kindern durch die schmale Öffnung zwängt. Ranieris Licht wartet auf der anderen Seite und weist ihnen den Weg. Sie rechnet damit, dass sie gleich von zwei klebrigen Tentakeln zurückgezogen wird. Doch nichts dergleichen geschieht. Priska dreht den Kopf und wirft einen kurzen Blick über ihre Schulter. Sie muss Gewissheit haben. Und tatsächlich: Das sprudelnde Wasser reicht inzwischen bis zur Decke. Und inmitten der sich übereinander wälzenden Wassermassen schwimmt Marlenes lebloser Körper. Die Scheibe, die Priska und die Kinder vor dem Ertrinken bewahrt, scheint aus Panzerglas zu sein. Trotzdem vernimmt Priska schon ein leises Knacken. Nicht mehr lange und das Glas wird bersten. Kaum sind sie auf der anderen Seite, lässt Priska den Riss in der Wand verschwinden. Und sie ist selbst erstaunt darüber, wie leicht ihr das fällt.
Nebel umfängt sie und als sie einen Schritt in das vor ihr liegende Nichts macht, stürzt sie in die Tiefe. Sie fühlt, wie Eleonore und Jeremias sich von ihr lösen. Der energetische Wirbel, der sie bis jetzt umhüllt hat, verebbt. Im nächsten Moment jedoch spürt sie den warmen Körper ihrer Tochter, die sich noch immer eng an sie schmiegt. Zitternde Lippen wandern über Priskas Wangen. Bedecken sie mit unzähligen Küssen.
»Mama, bist du wach?« Elenas ängstliches Stimmchen vertreibt die letzten Schwaden des Traumnebels. Priska schlägt die Augen auf und blickt in das blasse Antlitz ihrer Tochter. Ihr Herz krampft sich zusammen bei dem Gedanken, dass sie ihr Kind so lange allein lassen musste. Obwohl es die ganze Zeit auf ihrem Schoß saß.
»Ja, mein tapferes Mädchen. Ich bin endlich zurück.« Sie streicht Elena über die zerzausten Locken und übersät die kalten Kinderbacken ihrerseits mit innigen Küssen. Erst als sie das Kind an sich drückt und seinen Kopf an ihre Schulter bettet, fällt ihr auf, dass Marlene sie nicht mehr festhält. Mit klopfendem Herzen blickt sie zu ihrer Widersacherin hinüber. Die Dämonin liegt auf dem Rücken. Im Tod hat sie ihre menschliche Hülle vollständig abgestreift. Die haarigen Extremitäten sind gekrümmt. Sie kleben dicht an ihrem Leib und lassen den monströsen Körper plötzlich viel kleiner erscheinen. Dieser Anblick erinnert Priska an die Erdspinne, die sie kürzlich neben ihrem Bettenlager erschlagen hat. Nützlich hin oder her. Neben ihrer Schlafstatt haben die Viecher nichts verloren. So oder so wird sie nie das Geräusch der acht Beine vergessen, wie sie über den Laminatfußboden scharrten und Priska aus dem kurzen Schlummer holten, der ihr in jener Nacht vergönnt war.
Jeremias liegt direkt neben dem Ungeheuer. Er ist nach wie vor weggetreten, doch Priska hat den Eindruck, dass ein Hauch von Rosa das schmale Bubengesicht überzieht. Und das blonde Haar wirkt nicht mehr ganz so stumpf. Es scheint, als langsam das Leben in den kleinen Körper zurückfließt. Gerade als Priska überlegt, wie sie Jeremias Familie ausfindig machen kann, öffnet der Junge tatsächlich seine Augen. Und Priskas Herz setzt für einen Moment aus. Nach vielen Jahren blickt sie erneut in das Abbild des Karersees. Solch blaue Augen hat sie bisher nur einmal gesehen.
»Gib gut auf meinen Neffen acht. Er braucht euch und ihr ihn.« Ranieris Worte sind nur ein Flüstern. Kaum zu unterscheiden vom Rascheln der Birkenblätter. »Danke, dass du ihm das Leben gerettet hast. Nun weißt du, wozu du in der Lage bist.«
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
Federfarbenfee
 Wortedrechsler Wortedrechsler

Alter: 47
Beiträge: 94
Wohnort: Bayern
|
  19.10.2016 22:41 19.10.2016 22:41
von Federfarbenfee
|
 |
|
Kapitel 15: Im Exil
Das letzte Stück des Weges war steil. Halt suchend klammerte sich Johann an die Gesteinsbrocken, welche entlang des schmalen Pfades versprengt lagen. Der Korb auf seinem Rücken wog schwer. Er war bis zum Rand gefüllt mit Äpfeln, Speck, Schüttelbrot und anderen Lebensmitteln. Die spätsommerliche Sonne brannte erbarmungslos auf ihn herunter. Am wolkenlosen Himmel kreiste ein Steinadler. Sein Kreischen hallte an den Felswänden wider und fuhr Johann durch Mark und Bein. Dennoch war er froh, dass er den schattenspendenden Wald hinter sich gelassen hatte. Das Raunen und Wispern zwischen den Baumwipfeln bereitete ihm weitaus mehr Unbehagen als die Schreie des Greifvogels. Kurz hielt er inne und tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn. Auf dem Stofftaschentuch hatte Eva seine Initialen eingestickt. Nun waren ihre Finger klamm und kalt. Nie wieder würden sie kunstvolle Handarbeiten fertigen oder ihm sanft und tröstend übers Gesicht streifen. Der Anblick ihres leblosen Körpers, wie er vom Balken des Schuppens baumelte, verfolgte ihn noch immer. Krampfhaft versuchte er, den Kloß, der ihm die Kehle zuschnürte, hinunterzuschlucken. Er war schuld an all dem Leid. Und wäre Dora nicht, hätte er seinem Leben auch schon längst ein Ende gesetzt.
Zehn Jahre waren nun seit dem Tag vergangen, als sie den kleinen Jakob tot in seinem Bettchen vorgefunden hatten. Nicht einmal sein erstes Lebensjahr hatte er vollenden dürfen. Als Johann Evas tränenverschleiertem Blick begegnete, wusste er es: Dass sie sich entschieden hatte, ihm bald zu folgen. Dora stand wie ein Geist neben ihrem Bruder. Sie weinte nicht. Doch ihr Gesicht war fahl und ihre violetten Augen lagen in tiefen Höhlen. In diesem Augenblick glich sie einer Greisin. Nicht einem neunjährigen Kind. Allesamt waren sie zusammengezuckt, als plötzlich ihre helle Mädchenstimme die erdrückende Stille durchschnitt:
»Ihr dürft nicht traurig sein. Der Tod ist nicht das Ende.« Ihre kleine, weiße Hand legte sich auf Evas bebende Schultern: »Seine Seele ist gut behütet. An einem anderen Ort.«
»Woher willst du das wissen?« Zweifel und ein wenig Hoffnung schwangen in Evas Worten.
»Ich weiß es ebenso sicher, wie dass er sterben würde.« Dora konnte nicht entgangen sein, dass sich die Haltung ihrer Mutter versteift hatte. Dennoch fuhr sie fort: »Er war zu schwach. Deine Kinder können nur überleben, wenn sie sind wie ich. Doch er hatte es nicht in sich. In der jenseitigen Welt aber ist er stark. Und glücklich.«
Dicht neben Johann ging ein Steinhagel nieder und riss ihn aus seinen Erinnerungen. Die kleinen, aber tödlichen Geschosse pfiffen ihm um die Ohren. Schnell kauerte sich hinter den nächstgelegenen Felsbrocken. Die Hände hob er schützend über den Kopf. Als das Klackern nach einer schieren Ewigkeit verebbte, setzte er seinen beschwerlichen Aufstieg fort. Gleich hatte er es geschafft. Mit letzter Kraft zog er sich über die Kante des Felsvorsprungs auf die verborgene Hochebene. Der Anblick der üppigen Almwiese überwältigte ihn jedes Mal aufs Neue. Zwischen zitronengelben Anemonen und tiefblauem Enzian erhoben sich leuchtende Feuerlilien. Schmetterlinge und Bienen taumelten trunken von Blüte zu Blüte. Und inmitten dieses Blütenmeers graste friedlich das Vieh. Das vertraute Läuten der Kuhglocken vermittelte Johann das Gefühl von Heimat. Für einige glückliche Augenblicke übertönte es das Wehklagen seiner Seele.
Dora stand vor der Hütte. Und sie war nicht allein. Ein hochgewachsener, dunkel gewandeter Mann unterhielt sich mit ihr. Er kehrte Johann den Rücken zu. Doch die schwarze Kapuze, die über des Fremden Schultern lag, löste in Johann ein verschwommenes Déjà-Vue aus. Er hatte kein Bild vor Augen, verspürte aber Beklommenheit. Und allein schon die Tatsache, dass dieser Kerl in ihr hart erkämpftes Idyll eingedrungen war, machte ihn zu einer Bedrohung. Was hatte er mit Dora zu schaffen? Und wie war er hierher gelangt? Sein Beschützerinstinkt trieb Johanns müde Beine an. Obwohl er wusste, dass seine zierliche Tochter hundertmal stärker war als er selbst. Als Dora ihren Vater erblickte, unterbrach sie die Unterhaltung sofort. Mit wehenden Röcken eilte sie ihm entgegen und fiel ihm ungestüm um den Hals. Gerührt erwiderte er ihre innige Umarmung und strich über die langen, braunen Locken, die unter ihrem Kopftuch hervorquollen. Im Sonnenlicht schimmerte ihr Haar rötlich.
»Wie schön, dich zu sehen!« Die goldenen Sprenkel in den violetten Augen funkelten und ihr strahlendes Lächeln brachte sein Vaterherz zum Schmelzen. Dora war zu einer jungen Frau von nahezu überirdischer Schönheit herangewachsen. Wer sie nicht kannte, würde nicht glauben, dass dieses feengleiche Wesen ihr Heimatdorf in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Zwar kam es nach Sophies Tod zu keinem vergleichbar tragischen Unfall mehr. Und auch der geheimnisvolle Reiter ward von jenem Tag an nicht mehr gesehen. Hin und wieder wurde gemunkelt, dass der Schatten seines Höllenrosses die Steilwände des Rosengartens hinaufgeschossen sei. Doch da hatten wohl eher die Dämpfe der Gerüchteküche einigen Dorfbewohnern die Sinne vernebelt. Nein, es gab andere Abnormitäten, die den Leuten und sogar Johann selbst kalte Schauer über den Rücken jagten. Noch immer dachte er voller Grauen an die Vollmondnächte. Dora schlafwandelte nicht einfach. Sie veränderte sich. Es war, als würde SIE von ihr Besitz ergreifen, während Doras Geist sich nicht widersetzen konnte, weil er im tiefen Schlaf gefangen war. Die weit aufgerissenen Augen blickten ins Leere, doch ihr Körper bewegte sich zielgerichtet voran. Dabei berührten ihre Füße nie den Boden. Dora lief nicht, sie schwebte. Es schien so, als baumelte sie an den Fäden eines unsichtbaren Marionettenspielers. Und ganz gleich, wohin ihre nächtlichen Streifzüge sie auch führten: An jeder Ecke und hinter jedem Baum warteten gesichtslose Schatten darauf, sich ihr anzuschließen. Johann war ihr fast jede Nacht gefolgt. Und er konnte verstehen, dass der Anblick von Dora und ihrer Geisterarmee jeden, der zufällig ihren Weg kreuzte oder gerade zum Fenster hinaussah, zutiefst verstörte.
Irgendwann endete ihre Nachtwanderung immer auf dem Dorffriedhof. Hier vereinigten sich die Schatten zu einer dichten Nebelwand, die sich hinter Dora auftürmte und sie schließlich verschluckte. Wenige Augenblicke später verschwand auch der graue Dunst. Doch er löste sich nicht einfach in einzelne Schwaden auf, die dann langsam auseinanderdrifteten. Vielmehr schien es so, als würden die Schatten von einem starken Sog erfasst, der sie in Sekundenschnelle durch ein unsichtbares Loch zog. Nicht nur das Bild, das sich Johann dort auf dem Friedhof bot, war widernatürlich. Auch die Geräusche klangen, als befinde er sich in einem Vorhof zur Hölle. Das Jammern und Heulen und die verzweifelten Schreie hallten ihm noch stundenlang in den Ohren. Obwohl seine Instinkte ihn mit aller Macht davor warnten, hatte er ein einziges Mal versucht, den Geisternebel zu durchdringen, bevor er sich verflüchtigte. Eine Ahnung von ineinander verschmelzenden Gliedmaßen, verzerrten Mündern und Augenhöhlen, streifte ihn, als er sich näherte. Er fasste sich ein Herz und tauchte seine Hand in die wabernde Masse. Doch kaum hatte er die Spukgestalten berührt, durchzuckten ihn schmerzhafte Blitze. Gleichzeit grub sich eine eisige Kälte durch seine Eingeweide. Johann hatte das irrwitzige Gefühl, im selben Moment zu verbrennen und zu erfrieren. In seinem Kopf schwoll das Heulen und Schreien zu einer scheußlichen Kakophonie an. Sie ließ seinen Schädel dröhnen und beinahe platzen. Lange würde er dem nicht standhalten können. Dabei war noch kein Stück vorangekommen. Inzwischen hatte die brennende Kälte seine Arme und Beine in empfindungslose Stümpfe verwandelt. Johann spürte nichts mehr. Und so hatte er keine andere Wahl: Er musste wie gelähmt verharren und dabei zusehen, wie der Nebel und damit auch sein Kind durch das verborgene Nadelöhr gesaugt wurde.
Viele Nächte hatte er dort draußen auf dem Friedhof zugebracht. Aus Angst, dass Dora nicht zurückkäme oder dass sie von feindlich gesinnten Dorfbewohnern entdeckt würde. Und aus dem Bedürfnis heraus, das Geheimnis ergründen zu wollen. Doch weder der Nebel, noch seine Tochter kehrten auf demselben Weg zurück, auf dem sie verschwunden waren. Nie. Aber jedes Mal, wenn er enttäuscht und mit bangem Herzen nach Hause kam, lag Dora in ihrem Bett und schlief friedlich.
»Das ist kein sicherer Ort für dich, alter Mann.« Der Unbekannte mit dem schwarzen Umhang war neben Dora getreten. Johann musterte ihn. Die Mimik des Mannes war unbewegt und sein Gesicht alterslos. Er hätte ebenso gut zwanzig wie fünfzig sein können. Und er war wirklich von ungewöhnlich hochgewachsener Statur. Johann selbst war schon kein kleiner Mann. Doch der Fremde überragte ihn noch um anderthalb Köpfe.
»Niemand kann mir verwehren, meine Tochter zu besuchen!« Johann hatte nicht vor, sich von diesem wildfremden Kerl einschüchtern zu lassen. Schlimm genug, dass er sein Kind so selten zu Gesicht bekam. Obwohl es wirklich ein Segen und wahrscheinlich auch Doras Rettung war, dass sie hier oben als Sennerin arbeiten konnte. Johann dankte Gott jeden Tag für diese glückliche Fügung.
»Ja, auf eine gewisse Weise hast du recht. Du bist ihr Vater. Aber dennoch nur ein verschwindend kleiner Teil ihrer Selbst. Sorge dich nicht: Es geht ihr gut. Sie ist fast zu Hause.« Der Funken von Milde, der in den pechschwarzen Augen glomm, wirkte seltsam deplatziert in diesem Gesicht, das Johann an einen dunklen Racheengel denken ließ. Der Wind zersauste das Haar des Fremden und eine schwarze Locke legte sich über sein Antlitz. Sie verdeckte den Hauch von Freundlichkeit und verlieh ihm stattdessen ein verwegenes Aussehen.
»Wer bist du überhaupt, dass du dir anmaßt, so mit mir zu sprechen?« Johann straffte seine Glieder und versuchte, seiner Stimme und Haltung Würde zu verleihen. Dora legte ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Der Fremde lachte nur. Statt Johann zu antworten, führte er Daumen und Zeigefinger an seine Lippen und ein durchdringender Pfiff ertönte. Im selben Augenblick löste sich ein gewaltiger Schatten aus den Kiefern hinter der Hütte und ein riesiger Rappe kam auf sie zu galoppiert. Sein schwarzes Fell glänzte in der Sonne und Johann stockte der Atem. Noch nie hatte er ein derart schönes und zugleich furchterregendes Pferd gesehen. Die wilde Mähne des Tiers war ein Abbild der Haare seines Herrn, neben dem es nun anhielt. Als dieser ihm über die geblähten Nüstern strich, schnaubte der Rappe leise, während seine feurig lodernden Augen auf Johann ruhten. Der Fremde wechselte einen kurzen Blick mit Dora. Dann schwang er sich auf den Rücken des Pferdes und zog sich die schwarze Kapuze über den Kopf. Der lange Umhang floss über den Körper und den Schweif des Tieres und verschmolz Ross und Reiter zu einer imposanten Einheit. Das Pferd scharrte ungeduldig mit den Hufen. Zweifellos dieselben Hufen, die damals über Sophie hinweggedonnert waren. In Johann tobten widerstreitende Gefühle. Furcht, Entsetzen, Zorn, aber auch Erleichterung und sogar Verbundenheit kämpften um die Vorherrschaft in seinem Herzen. Noch bevor er seinen inneren Aufruhr in den Griff bekommen konnte, schnalzte der dunkle Reiter mit der Zunge und schoss mit seinem Pferd Richtung Felsen davon.
»Dora, wer ist dieser Mann?« Johanns Stimme war nur mehr ein Flüstern, doch seine Tochter hatte ihn trotzdem gehört.
»Das ist eine lange Geschichte, Vater.« Dora fasste seine Hand und lief dann mit ihm zusammen zielstrebig auf die Hütte zu. »Wenn die Zeit reif ist, werde ich sie dir erzählen. Aber jetzt bekommst du erstmal ein warmes Mus. Du musst hungrig sein nach deinem langen Aufstieg.« Wie immer trug sie keine Schuhe. Leichtfüßig tanzte sie über die Almwiese und knickte dabei nicht eine einzige Blüte. Bei dem Gedanken an die sättigende Milchspeise krampfte sich Johanns leerer Magen zusammen. Doch so leicht ließ er sich nicht ablenken.
»Ist er überhaupt ein Mensch?« Noch bevor die Worte seine Lippen verlassen hatten, wurde ihm bewusst, wie unglaublich allein die Frage klang.
»Kennst du einen einzigen Menschen, der mir wohlgesonnen ist? Außer dir?« Dora lief unbeirrt weiter. Doch der Trotz und die Ablehnung in ihrer Stimme waren nicht zu überhören. »Was spielt es für eine Rolle, wer oder was er ist? Er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Er will mir nicht schaden. Er beschützt mich.« In Doras Augen glitzerte es verdächtig und Johann verspürte einen kleinen, eifersüchtigen Stich in seinem Herzen. Wofür er sich schon im selben Augenblick schalt. Seiner Tochter war in ihrem jungen Leben bereits so viel Unfassbares widerfahren. Vor diesem Hintergrund erschien es lächerlich, sich darum zu sorgen, ob der schwarze Reiter der richtige Umgang für sie war. Doch obwohl Johann in den letzten Jahren lernen musste, dass die Welt mehr war, als sie vorgab zu sein, blieb er ein Vater. Und Dora sein Kind.
»Hier oben sind die Menschen ohnehin in der Unterzahl und das ist auch gut so.« Mit diesen Worten öffnete Dora die Hüttentür und schob Johann in die Stube. Seine Augen benötigten ein paar Minuten, um sich vom gleißenden Sonnenlicht auf die schummrige Dunkelheit umzustellen. Es brannte kein Feuer unter dem gusseisernen Kessel. Er würde also noch etwas warten müssen, bis er seinen Hunger stillen konnte. Johann setzte sich an den wurmstichigen Holztisch und holte die mitgebrachten Vorräte aus seinem Korb. Diese Lebensmittel waren für seine Tochter bestimmt. Auch wenn sein Magen bei ihrem Anblick vernehmlich grummelte. Dora öffnete derweilen eines der Fenster, um etwas frische Luft und Licht hereinzulassen. Nun wurde auch der hintere Teil des Raumes sichtbar. Eine lange Leiter führte zu dem kleinen Zwischenboden, der Dora als Bettstatt diente, hinauf. Unwillkürlich fragte er sich, ob sie noch immer schlafwandelte. Wohl war ihm nicht bei der Vorstellung, dass sie schlafend die Leiter hinunterkletterte. Allerdings warteten draußen noch weitaus größere Gefahren auf sie. Er spürte ihre kühle, zarte Hand, die sich behutsam über seine legte und Johanns raue Finger leicht drückte. Sie hatte ihm gegenüber Platz genommen.
»Das Essen ist gleich fertig«, erklärte sie ihm, machte aber keinerlei Anstalten, sich zu erheben. In Johanns Kopf türmten sich unzählige Fragen und mit jedem Tag wurden es mehr. Seit Jahren schon. Doch Dora war ihm die Antworten immer schuldig geblieben. Entweder kannte sie diese selbst nicht oder sie wollte ihre Geheimnisse um keinen Preis lüften. Inzwischen hatte er es aufgegeben, sie auszuhorchen, auch wenn sein Schädel beinahe barst angesichts der Last an Unausgesprochenem, die er mit sich herumtrug. Es war ausschließlich die Sorge um sein Kind, die seine Neugier anfachte. Doch allmählich begriff er, dass er tatsächlich nur ein unbedeutendes, graues Behelfsstück in dem schillernden Mosaik war, aus dem Dora zusammengesetzt war. Obwohl er nicht zu den anderen Steinchen und in das Gesamtbild passte, versuchte er beinahe gewaltsam, weiterhin ein Teil von Doras Leben zu bleiben. Er schluckte und streichelte mit seinen spröden Fingerspitzen ihre weiche Haut. Hatte sie auch nur die leiseste Ahnung davon, wie sehr er sie liebte? Dass sie der einzige Grund dafür war, dass er noch an diesem erbärmlichen Leben festhielt? Ihre violetten Augen musterten ihn forschend.
»Soll ich dir helfen?«, erkundigte er sich schlicht.
»Nein, das ist nicht nötig«, erwiderte sie lächelnd und hielt einfach weiter seine Hand. In diesem Augenblick öffnete sich abermals die Tür und eine junge Frau trat zu ihnen in die Stube. Sie war gekleidet wie eine Magd, wobei ihre Kluft sehr in die Jahre gekommen war. Solch ein Gewand hatte er zuletzt an seiner Großmutter gesehen. Johann sprang auf, um die Unbekannte zu grüßen und sich ihr vorzustellen, doch Dora zog ihn zurück auf die Bank.
»Das ist vergebliche Liebesmüh, Vater. Sie kann dich nicht hören. Und auch nicht sehen. Noch nicht.« Wie so oft sprach sein Kind in Rätseln. Gebannt beobachtete er das Mädchen mit der altmodischen Haube und der Schürze, wie es sich zielstrebig auf die Feuerstelle zubewegte. Ein eigenartiger Schein umgab den Körper der jungen Frau und erhellte ihre unmittelbare Umgebung. Als sie bei dem Kessel angelangt war, bückte sie sich und schaufelte mit bloßen Händen die Asche aus der verloschenen Glut in den Topf. Johann rieb sich die Augen. Was war das nur für eine groteske Darbietung? Er warf Dora einen ratlosen Blick zu, doch seine Tochter fand offensichtlich nichts Merkwürdiges an dem Verhalten des Mädchens, das nicht sehr viel älter wirkte als sie selbst. Schweigend und entspannt saß sie da und lächelte. Die Besucherin hatte nun angefangen, den Inhalt des Kessels mit einer langen Holzkelle umzurühren. Es dauerte nicht lange und bläuliche Flammen leckten an dem schweren Gefäß. Es schien, als wäre das Feuer von Geisterhand entfacht worden.
»Das scheint nicht nur so«, las Dora seine Gedanken. »Marias Knochen sind Teil des Gerölls, über das du bei deinem Aufstieg hinweggeklettert bist. Sie wurde vor langer Zeit von der Alm gejagt, weil dem Bauern ihr Mus nicht schmeckte. Tragischerweise ist sie in der Scharte zu Tode gestürzt, bevor sie diesem Ort entfliehen konnte.« Obwohl Dora die Geschichte in ruhigem Ton und ohne Dramatik vorgetragen hatte, hatte Johann das Gefühl, als hätte sie ihn in einen eiskalten Bergsee getaucht. Er zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub.
»Sie kocht ihr Mus nun für uns. Und es wird sie mit Glück erfüllen, wenn es uns schmeckt. Tun wir ihr den Gefallen. Immer und immer wieder. Vielleicht findet ihre arme Seele dann irgendwann Erlösung.« Johann konnte nicht glauben, dass diese Worte aus dem Mund einer neunzehnjährigen Maid kamen, die noch dazu seine Tochter war. War SIE es, die aus ihr sprach?
»Vater, ICH bin es. Und sei dir gewiss: Ich weiß um deine starke Verbundenheit. Nie werde ich einen anderen Menschen mehr lieben als dich. Dir verdanke ich mein Leben und du hast deines mehr als einmal für mich riskiert. Einen besseren Vater gibt es nicht auf dieser Welt.« Ihre Wärme durchflutete den Raum und erfasste auch Maria. Ein leises Lächeln spielte um ihre blassen Lippen. Mit einer raschen Handbewegung wischte sich Johann die Tränen aus den Augenwinkeln und unterdrückte den altbekannten Kloß, der nun wieder seinen Hals hinauf wanderte.
Gerade, als er Dora in seine Arme ziehen wollte, kam die Geisterfrau an den Tisch. Ihre Augen sahen durch Johann und seine Tochter hindurch. Dennoch stellte sie die zwei Holzschalen direkt vor ihnen ab. Die Schüsseln waren bis zum Rand gefüllt mit schwarzem Brei. Dora nahm einen der bereitliegenden Löffel zur Hand und tauchte ihn in die unappetitliche, dunkle Masse. Ohne zu zögern, schluckte sie die erste Portion hinunter.
»Vater, iss. Das Mus schmeckt vorzüglich. Glaub mir!« Unbekümmert aß sie weiter. Und sie schien ihr Mahl tatsächlich zu genießen. Es kostete Johann einiges an Überwindung, von dem dunklen Aschebrei zu probieren. Nie hätte erwartet, dass seine Geschmacksknospen förmlich jubilieren würden, als das Aroma der süßen Speise sie erreichte. Er wusste nicht, ob er je ein besseres Mus gegessen hatte. Überrascht blickte er hoch und begegnete Marias Blick. Sie sah ihn an.
»Ein wahrhaft köstliches Mal!«, lobte er das bleiche Mädchen und sie strahlte. Auch der sie umgebende Glanz wurde heller. Dora nickte ihr ebenfalls anerkennend zu. Maria öffnete den Mund und die Ahnung eines geflüsterten »Dankeschöns« hing für einen Augenblick in der Luft. Dann drehte sich die Erscheinung um und glitt durch die Tür hinaus. Diesmal jedoch, ohne sie vorher zu öffnen.* Im selben Moment, da Maria die Stube verlassen hatte, verlosch das blaue Feuer unter dem Kessel. Dora erhob sich und ging hinüber, um noch eine weitere Schale mit dem Brei zu füllen. Das Mus war offenbar echt. Eine Illusion hätte Johann wohl auch nicht annähernd so gut sättigen können. Dora trug die volle Schale hinüber zu dem geöffneten Fenster und stellte sie auf das schmale Brett. Dann trat sie einige Schritte zurück.
Johann rechnete damit, dass gleich eine Katze auf das Fensterbrett springen und sich auf den Brei stürzen würde. Stattdessen waren es zwei milchweiße Kinderhände, die nach der Schale griffen und gleich darauf mit ihr verschwanden. Merkwürdig. Zu wem gehörte dieses Kind? Hier oben gab es keine Familien. Johann hatte seine Gedanken nicht laut ausgesprochen, doch für Dora war das einerlei. Sie wusste, was in Johanns Kopf vorging.
»Das sind Adams verborgene Kinder.«*
*In Anlehnung an die Sagen von „der erlösten Sennerin“ und „den antrischen Leut'“
« Was vorher geschah12345678910
1112131415161718Wie es weitergeht »
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 2 von 3 |
Gehe zu Seite 1, 2, 3 |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
| Empfehlung | Buch | Empfehlung | Empfehlung | Buch | Empfehlung | Empfehlung | Buch | Empfehlung | Empfehlung |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






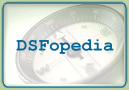









 Login
Login






