  |
|
| Autor |
Nachricht |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  15.11.2015 11:08 15.11.2015 11:08
Elirium Saga : Die Rückkehr der Götter [Arbeitstitel]
von Leveret Pale
|
   |
|
|
Neue Version »
Ich stelle hier mal die erste Hälfte, des ersten Kapitels des Romans, an dem ich zurzeit arbeite, rein. Dazu habe ich bereits letzte Woche einen möglichen Prolog veröffentlicht. Wie wirkt der Text auf euch und kommt ihr mit den vielen Infos und Namen am Anfang zurecht? Sollte ich möglicherweise Dialoge einbauen? Bei mir gibt es manchmal Kapitel, die bestehen fast nur aus Seitenlangen Dialogen und dann wieder Kapitel, die sind wie dieses hier, wo nur eine handvoll Sätze gesprochen wird, aber auch erst in dem Teil des Kapitels, den ich noch nicht eingestellt hab. Die zweite Hälfte stelle ich vielleicht rein, sobald ich sie fertig bearbeitet habe.
THEODOR ( Es gibt keine Kapitelnamen, sondern es steht nur da aus wessen Sicht gerade erzählt wird)
Die Hufen der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer, so wie unzähligen Türmen und Festungsanlagen darin, die wie die erstarrten Finger einer toten Hand nach dem Himmel griffen, ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee, doch an ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen er und Theodor Helme mit heruntergelassenen Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappens der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont neben der Stadt ging die Sonne im dunklen dynerischen Meer unter. Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Farly Kasteron einen heben. Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern den Wein angestoßen, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Der Ärger mit König würde ihr geringstes Problem sein, sollten sie sich noch nach Sonnenuntergang außerhalb der Stadt aufhalten, sofern die Gerüchte stimmten. Theodor gab seinem schäumenden Pferd die Sporen. Seine Schenkel brannten und verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Ser Bylbon hatte darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen, was ihn es einen Augenblick lang bereuen ließ seine Wut an ihm ausgelassen zu haben, doch hatte er Angst und diese übertraf sein Mitleid mit dem Tier.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu übernächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden und nur noch schwarze, verkohlte Holzskelete zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt und nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern, doch saßen sie auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie damals vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber nun. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf den er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Farly Kasteron zu beschließen. Sein Vater hatte ihn wahrscheinlich nur mitgeschickt, damit er selber Geschmack an einer der Eistöchter des alten Graf Kasterons fand. Allein bei den Gedanken, an die drei weißhaarigen Frauen mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. Er würde seinen Vater wieder enttäuschen müssen und es war schon fast eine Schande für ihn, da sogar seine kleine zehnjährige Schwester bereits verlobt war, aber niemals Kasteron. Dort war es zu kalt und zu weit weg von den Gärten Absborgens und sein Vater hatte ihn zum Glück frei Hand bei Wahl seiner Braut gegeben.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite seiner Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Feryas, dem kleinen Königreich im Süden von Malestur, doch dieser ließ sich wie immer keine Zweifel oder Angst anmerken.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Nur noch fahles Licht am Himmel zeugte von ihrer einstigen Anwesenheit und zwischen den Wolken lächelten sie die beiden Monde Fratos und Sora an.
Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und hüllte die Nacht in sein leichenblasses Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Sie nahmen ihren Tanz von neuem auf.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht nur noch auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits schäumten und bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass er erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Ein Mann in einem schwarzen Mantel stand dort im Mondlicht. Seine Haut blass und seine schneeweißen Harre kurzgeschoren, die Wangen seines strengen Gesichts eingefallen und seine Augen leuchteten rot wie glühende Kohle. Theodor riss die Zügel seines Pferdes um und brachte es gerade noch so zum Stehen, ohne das es ihn abwarf. Doch der Prinz reagierte zu spät. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor, durch die Schlitze seines Helmes, wie der Mann mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedonnert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes.Sein schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm, wo er aufplatze wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles schien sich in Theodor vor Angst zusammenziehen. Pferde wieherten. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Ser Bylbon versuchte sein tolles Pferd unter Kontrolle zu bekommen und sein Schwert zu ziehen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt ,bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf sein Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, während des Ritters Schreie langsam erstickten. Weitere Ghule sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Sein Pferd drehte laut wiehernd durch und trat nach den Ghulen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sein Pferd von fünf oder mehr Ghulen in Stück gerissen wurde. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappeln konnte sprang ein Ghul auf ihn. Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Panzerung. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen wohl früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf, um mit seinem schweren gepanzerten Stiefel ihr auf dem kahlen Schädel zu treten. Er zerbrach laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Eine entsetzliche Abscheu und Übelkeit überkam Theodor und er musste dagegen ankämpfen sich nicht ins sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, wo ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn sicherlich in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor erblickte sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er den Griff mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte. Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg und dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie bloß? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage, welche ihn in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hatten, in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Angewidert trat er dem Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Er hielt sich wacker in dieser Schlacht und eine Welle aus Kraft durchströmte plötzlich seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Nächsten wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte. Langsam beschleunigte sich die Welt wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem riesigen Haufen von endgültig totem Fleisch. Ihm war kalt, doch musst er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. In seinem Teil des Weges war niemand Lebendiges mehr. Nur noch einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, auf die wenig übriggebliebenen Männer vor ihm. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer und erschöpfter. Ihm war unglaublich kalt, aus Gründen die er nicht feststellen konnte. Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte.
Rücken an Rücken im Kreis versuchten die Männer mit Theodor den Angriffen stand zuhalten. Ihre immer stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen die nach ihnen greifende Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Doch nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Sie massakrierten sie oft direkt vor den Augen ihrer Kameraden. Für jeden Ghul, den sie erschlugen, schien ein Dutzend frischer aus ihrem Grab zu steigen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab. Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er wie eine Schnecke eine Spur aus Blut hinterließ. Kurz nach dem der Mann im Nebel verschwunden war, brach das Geschrei abrupt ab. Ein bedrohliche Still senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von fast hundert, waren außer ihm übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer, und einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Zu groß war die Angst vor den Ghulen, um zu schreien. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern drückte sie sie hinab. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft, wenn auch dieser von dem, der Eingeweide und des Blutes, fast überdeckt wurde.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, doch fragte sich wahrscheinlich jeder, genauso wie Theodor, warum der Angriff so plötzlich abgebrochen war. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte als er, meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte schien ihn zu umspülen, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert und tatsächlich löste sich wenige Schritte vor ihnen aus dem Schatten, der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
Weitere Werke von Leveret Pale:
|
|
| Nach oben |
|
 |
Lapidar
 Exposéadler Exposéadler

Alter: 61
Beiträge: 2701
Wohnort: in der Diaspora
|
  15.11.2015 20:41 15.11.2015 20:41
Re: Elirium Saga : Die Rückkehr der Götter [Arbeitstitel]
von Lapidar
|
 |
|
| Leveret Pale hat Folgendes geschrieben: | Ich stelle hier mal die erste Hälfte, des ersten Kapitels des Romans, an dem ich zurzeit arbeite, rein. Dazu habe ich bereits letzte Woche einen möglichen Prolog veröffentlicht. Wie wirkt der Text auf euch und kommt ihr mit den vielen Infos und Namen am Anfang zurecht? Sollte ich möglicherweise Dialoge einbauen? Bei mir gibt es manchmal Kapitel, die bestehen fast nur aus Seitenlangen Dialogen und dann wieder Kapitel, die sind wie dieses hier, wo nur eine handvoll Sätze gesprochen wird, aber auch erst in dem Teil des Kapitels, den ich noch nicht eingestellt hab. Die zweite Hälfte stelle ich vielleicht rein, sobald ich sie fertig bearbeitet habe.
THEODOR ( Es gibt keine Kapitelnamen, sondern es steht nur da aus wessen Sicht gerade erzählt wird)
Die Hufen der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer, so wie unzähligen Türmen und Festungsanlagen darin, die wie die erstarrten Finger einer toten Hand nach dem Himmel griffen, ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
du magst lange Schachtelsätze?
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee, doch an ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen er (wer ist er? vorhin wars Theo) und Theodor Helme mit heruntergelassenen Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappens der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
einige würden nun sagen, viel zu viel Info.. ist die hier nötig.. ich sage das nicht..
Am Horizont neben der Stadt ging die Sonne im dunklen dynerischen Meer unter.
Mein räumliches Denken macht hier grad einen Purzelbaum..
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Farly Kasteron einen heben./anstoßen, einen heben hat ein bisschen ein komisches Geschmäckle Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern den Wein angestoßen/das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten.
 dont ride, when drunk...dein Prinz ist aber recht sattelfest, wenn er mit Kater noch vorne an der Spitze seiner Recken im vollem Gallop durch die Ebene reitet.. dont ride, when drunk...dein Prinz ist aber recht sattelfest, wenn er mit Kater noch vorne an der Spitze seiner Recken im vollem Gallop durch die Ebene reitet..
Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Der Ärger mit dem König würde ihr geringstes Problem sein, sollten sie sich noch nach Sonnenuntergang außerhalb der Stadt aufhalten, sofern die Gerüchte stimmten. ich denke, wenn du den Teil vorne hinstellst, ist es iwie spannender. Theodor gab seinem schäumenden Pferd (hat das Tier Epilepsie? mach draus Schaum oder schweißbedeckt.. )die Sporen. Seine Schenkel brannten und verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Ser Bylbon hatte darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen,Puntk. Einen Moment lang bedauerte er.. was ihn es einen Augenblick lang bereuen ließ seine Wut an ihm ausgelassen zu haben, doch hatte er Angst und diese übertraf sein Mitleid mit dem Tier.
Darf Theo seinem Prinzen davonreiten? wenn er das Pferd anspornt, überholt er ihn doch... außerdem 8 mal 12 reiter und wo ist das Gepäck? irgenwo müssen doch die Rüstungen mit transportiert werden oder wird das Gepäck teleportiert? oder darf der Troß nachts draußen bleiben und hat nichts zu befürchten?
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu übernächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. glaub hier stimmt der Tempus nicht Einige waren niedergebrannt worden PUNKT und nur noch schwarze, verkohlte Holzskelete zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt undPUNKT nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern, PUNKT doch saßen sie auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie damals vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber nun. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf den er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Farly Kasteron zu beschließen. Sein Vater hatte ihn wahrscheinlich nur mitgeschickt, damit er selber Geschmack an einer der Eistöchter des alten Graf Kasterons fand. Allein bei den Gedanken, an die drei weißhaarigen Frauen mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. Er würde seinen Vater wieder enttäuschen müssen und es war schon fast eine Schande für ihn, da sogar seine kleine zehnjährige Schwester bereits verlobt war, aber niemals Kasteron. hier ist die Formulierung etwas ungeschickt
Dort war es zu kalt und zu weit weg von den Gärten Absborgens und PUNKT sein Vater hatte ihn zum Glück frei Hand bei Wahl seiner Braut gegeben. ÄHM..wenn der kerle sich verlobt, muss er doch nicht nach Kasterton ziehen.. nehm ich an
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite seiner /der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Feryas, dem kleinen Königreich im Süden von Malestur, doch dieser ließ sich wie immer keine Zweifel oder Angst anmerken. mit einer vollen Ritterrüstung und Helm dürfte es schwer sein, Blicke zu werfen und zu erkennen was einer unter seinem Helm für ein Gesicht macht..
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Nur noch fahles Licht am Himmel zeugte von ihrer einstigen Anwesenheit und zwischen den Wolken lächelten die beiden Monde Fratos und Sora sich an.
Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und hüllte die Nacht in sein leichenblasses Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Sie nahmen ihren Tanz von neuem auf.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht nur noch auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits schäumten Epilepsie??und bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass er erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Ein Mann in einem schwarzen Mantel stand dort im Mondlicht. Seine Haut blass und seine schneeweißen Harre kurzgeschoren, die Wangen seines strengen Gesichts eingefallen und seine Augen leuchteten rot wie glühende Kohle.
Vollbremsung? Was man doch so alles erkennt unter einem Ritterhelm... und im dunklen..
Theodor riss die Zügel seines Pferdes um und brachte es gerade noch so zum Stehen, ohne das es ihn abwarf. Doch der Prinz reagierte zu spät. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor, durch die Schlitze seines Helmes, wie der Mann mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedonnert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes.Lerzeile Sein schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm, wo er aufplatze wie eine überreife Frucht. ich nheme an der Prinz aber es könnte auch das Pferd sein..
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles schien sich in Theodor vor Angst zusammenziehen. Pferde wieherten. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Ser Bylbon versuchte komma sein tolles vor Angst wahnsinniges Pferd unter Kontrolle zu bekommen und sein Schwert zu ziehen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt ,bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf sein/wessen? Pferd und riss ihm /wem?mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, während des Ritters Schreie langsam erstickten. Weitere Ghule sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Sein Pferd drehte laut wiehernd durch und trat nach den Ghulen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sein Pferd von fünf oder mehr Ghulen in Stück gerissen wurde. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappeln konnte sprang ein Ghul auf ihn.
Hier wirds sehr unklar.. irgendwo geht verloren, dass der Kerl vom Pferd fällt..
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Panzerung. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen wohl früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf, um mit seinem schweren gepanzerten Stiefel ihr auf dem kahlen Schädel zu treten. Er /wer ?zerbrach laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Eine entsetzliche Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor und er musste dagegen ankämpfen komma sich nicht ins sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, wo ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn sicherlich in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor erblickte/sah.. sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er den Griff mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und zerrten an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte. Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg und dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie bloß? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage, welche ihn in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hatten, in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Angewidert trat er dem Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Er hielt sich wacker in dieser Schlacht und eine Welle aus Kraft durchströmte plötzlich seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Nächsten wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte. Langsam beschleunigte sich die Welt wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem riesigen Haufen von endgültig totem Fleisch. Ihm war kalt, doch musst er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. In seinem Teil des Weges war niemand Lebendiges mehr. Nur noch einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, auf die wenig übriggebliebenen Männer vor ihm. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer und erschöpfter. Ihm war unglaublich kalt, aus Gründen die er nicht feststellen konnte.
Mich nervt seine innere Kalkulation.. aus gründen, die nicht feststellen konnte, er wusste nicht woher.. also bitte soviel energie hat er grad nich tübrig..
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte.
Rücken an Rücken im Kreis versuchten die Männer mit /Um Theodor den Angriffen stand zuhalten. Ihre immer stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen die nach ihnen greifende Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Doch nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Sie massakrierten sie oft direkt vor den Augen ihrer Kameraden. Für jeden Ghul, den sie erschlugen, schien ein Dutzend frischer aus ihrem Grab zu steigen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab. Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er wie eine Schnecke eine Spur aus Blut hinterließ. Kurz nach dem der Mann im Nebel verschwunden war, brach das Geschrei abrupt ab. Ein bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von fast hundert, waren außer ihm übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer, und einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Zu groß war die Angst vor den Ghulen, um zu schreien. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern drückte sie sie hinab. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft, wenn auch dieser von dem, der Eingeweide und des Blutes, fast überdeckt wurde. Langsam wirds langweilig mit der detaillierten Beschreibung..
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, doch fragte sich wahrscheinlich jeder, genauso wie Theodor, warum der Angriff so plötzlich abgebrochen war. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte als er, meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte schien ihn zu umspülen, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert und tatsächlich löste sich wenige Schritte vor ihnen aus dem Schatten, der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete. |
nunja... also eigentlich gefällt mir die Idee.. aber ich finde es etwas arg langatmig.. die Schlachtenszene ist ausführlich aber ausser dass du mir sagst, dass es stinkt und blutig ist, fühle ich nichts..
Du hast versucht, es episch zu halten, was ja einem Ritterpos gut entspricht aber manchmal schnell abgleitet.. da du manchmal die Bilder vermischst.
Ich hoffe, ich bin nicht zu unfreundlich gewesen.
LG
Lapidar
_________________
"Dem Bruder des Schwagers seine Schwester und von der der Onkel dessen Nichte Bogenschützin Lapidar" Kiara
If you can't say something nice... don't say anything at all. Anonym. |
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  15.11.2015 21:15 15.11.2015 21:15
von Leveret Pale
|
  |
|
Zu Unfreundlich? Eine zu freundliche Kritik ist doch nichts wert! 
Also danke für die ausführlichen Verbesserungen, damit kann ich arbeiten.
Über einige der Kommentare muss ich sogar schmunzeln.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  17.11.2015 11:01 17.11.2015 11:01
von Leveret Pale
|
  |
|
So ich hab das meiste von deiner Korrektur umgesetzt sowie noch hier und da einige Kleinigkeiten ausgebessert. Ist zwar sicherlich noch nicht perfekt, aber durch die Korrektur sind mir ein paar Dinge aufgefallen, auf die ich jetzt verstärkt achten werde.
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger eine toten Hand nach dem Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee, doch an ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme mit heruntergelassenen Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappens der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satt hatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Farly Kasteron anstoßen. Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen. Einen Moment lang bedauerte er es, doch hatte er Angst und diese übertraf sein Mitleid mit dem Tier.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelete zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber nun. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf den er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Farly Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken, an die drei weißhaarigen Töchter, des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Feryas, dem kleinen Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er durch die Schlitze seines Helmes zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel hingen ziwschen den Wolkenfetzten, an ihrer Stellle die beiden Monde Fratos und Sora.
Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht nur noch auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie fast im Dunkeln zu leuchten schienen und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen was er sah nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu spät. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor, durch die Schlitze seines Helmes, wie der Mann mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedonnert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm, wo er aufplatze wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Ghule lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen und sein Schwert zu ziehen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, während des Ritters Schreie langsam erstickten. Weitere Ghule sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Sein Pferd drehte laut wiehernd durch und trat nach den Ghulen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sein Pferd von fünf oder mehr Ghulen in Stück gerissen wurde. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappeln konnte sprang ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Panzerung. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen wohl früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf, um seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten niedersausen zu lassen. Der Kopf zerbrach laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, wo ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn sicherlich in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte. Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Angewidert trat er dem Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Er hielt sich wacker in dieser Schlacht und eine Welle aus Kraft durchströmte plötzlich seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte. Langsam beschleunigte sich die Welt wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem riesigen Haufen von endgültig totem Fleisch. Ihm war kalt, doch musst er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu du der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte.
Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab. Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand.Ein bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von fast hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert und tatsächlich löste sich wenige Schritte vor ihnen aus eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  10.12.2015 10:35 10.12.2015 10:35
von Leveret Pale
|
  |
|
Und nochmal überabreitet.
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee, doch an ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme mit geöffneten Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Farly Kasteron anstoßen. Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen. Einen Moment lang bedauerte er es, doch hatte er Angst und diese überschattete sein Mitleid mit dem Tier.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelete zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber nun. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Farly Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken, an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora.
Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln zu leuchten schienen und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedonnert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters.Weitere Ghule sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach den Ghulen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappeln konnte sprang ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen wohl früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf, um seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten niedersausen zu lassen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn sicherlich in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte und mit einem Hieb erschlug er ihn. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte. Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Angewidert trat er dem Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus. Er hielt sich wacker in dieser Schlacht und eine Welle aus Kraft durchströmte plötzlich seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten. Langsam beschleunigte sich die Welt wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem riesigen Haufen von totem Fleisch. Er fror und zitterte am ganzen Körper, doch musst er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte.
Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab. Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  22.12.2015 17:25 22.12.2015 17:25
von Leveret Pale
|
  |
|
So ich schreibe gerade die letzten zwei Kapitel des vierhundert Seiten dicken, ersten Bandes der Eliriumsaga. Wahrscheinlich werde ich heute, oder morgen fertig mit der Rohfassung. Nebenbei bin ich aber immer wieder in alte Kapitel zurückgekehrt und habe auch das erste nochmal verbessert.
Wenn das Buch so beginnen würde ( natürlich kommt noch ein Lektorat), würde es euch in den Bann ziehen? Findet ihr noch Fehler?
Danke schon mal für jegliche Art von Rückmeldung, ich werde einiges davon brauchen, wenn ich mich daran mache den Roman zu überarbeiten und in ein paar Monaten herauszugeben.
Zu dem Eliriumuniversum habe ich übrigens noch ein paar andere Texte rein gestellt, nämlich:
Kunstsprache für Fantasyroman
Das Geständnis des Valentin Rosenthal
Elirium - Die Entstehung der Menschen
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme mit geöffneten Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen. Einen Moment lang bedauerte er es, doch hatte er Angst und diese überschattete sein Mitleid mit dem Tier.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskelete zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora. Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mannauf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappelte stürzte sich ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte und mit einem Hieb erschlug er ihn. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er fror und zitterte am ganzen Körper, doch musst er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Ihr Schwertarme wurden immer müder und die Schilde immer schwerer. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete. Er war ungefähr genauso groß wie Theodore und unter seinem schwarzen Umhang war ein bronzenes Brustharnisch, aber sonst war er unbewaffnet und ohne jegliche Rüstung. Seine Haut war blass und grau und trotz seiner schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. Doch was ihn am meisten verstörte waren die Augen, die wie glühende Kohle euchteten, während sie ihn musterten. Er spürte wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählte hatte und an die er sich schon längst nicht mehr erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil er schien ihn zu belächeln.
[ Das Kapitel ist doppelt solang, aber ich habe erstmal nur die erste Hälfte reingestellt ]
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gast
|
 22.12.2015 18:14 22.12.2015 18:14
von Gast
|
 |
|
Hallo Leveret!
Bin nicht sehr weit gekommen, muss ich sagen.
Das sind mir einfach viel zu viel Adjektive und Beschreibungen. Diesen Stil kann ich überhaupt nicht leiden.
Für mich als Leser sind die meisten Informationen, die du gibst, völlig belanglos. Ob nun einige der Ritter Helme mit offenem Visier tragen, ist mir völlig Schnuppe.
Die Intention dahinter verstehe ich schon. Du willst möglichst viel Informationen geben, alles detailliert beschreiben (vor allem das Aussehen der Charaktere, die Farbe der Umhänge, die Rüstung etc.), um ein Bild vor dem inneren Auge entstehen zu lassen, den Leser in deine Welt hineinziehen, ihn das sehen lassen, was du siehst.
Doch das schaffst du nicht, indem du den Leser zum Einschlafen bringst. Solche Informationen sind schlichtweg langweilig.
Hier ein Beispiel aus deinem Text:
| Zitat: | An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn
|
Fassen wir zusammen:
- der Umhang ist grau
- der Umhang ist träge (?) ... [evtl meintest du, dass er träge im Wind hängt, doch das ist ein Widerspruch in sich, vor allem, wenn man auf einem Pferd sitzt, welchem man gerade die Sporen gibt ... und einen trägen Umhang gibt es nicht.]
- der Umhang ist scharlachrot ... dachte, er wäre grau.
- der Umhang trägt ein Wappen
Ein so detailliert beschriebenes, doch eigentlich vollkommen belangloses Kleidungsstück ... was soll ich damit anfangen?
Ein weiterer Punkt: die vielen Namen. So viele Namen auf einmal zu nennen, und das zu Anfang, macht es extrem schwierig, in die Geschichte einzufinden. Diese Fülle verwirrt nur mehr, als dass sie mich deiner Welt näher bringt.
Hoffe, du bist mir meiner Worte nicht bös'. Dies ist schlichtweg nur mein Empfinden.
LG
AC
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  22.12.2015 18:18 22.12.2015 18:18
von Leveret Pale
|
  |
|
| Zitat: | | Hoffe, du bist mir meiner Worte nicht bös'. Dies ist schlichtweg nur mein Empfinden. |
Natürlich bin ich dir nicht böse. Ehrliche Kritik ist die einzig nützliche.
Okay Adjektive kürzen und weniger Beschreibungen, werde ich bei der Überarbeitung berücksichtigen.
| Zitat: |
Ein so detailliert beschriebenes, doch eigentlich vollkommen belangloses Kleidungsstück |
Vor allem da hast du komplett recht. Das Beispiel hat mir prima die Augen geöffnet. 
|
|
| Nach oben |
|
 |
Vidora
 Leseratte Leseratte

Alter: 36
Beiträge: 151
|
  22.12.2015 18:27 22.12.2015 18:27
von Vidora
|
 |
|
Hallo,
ich hab die letzte Version mal durchgeschmökert und ein paar Kommentare dagelassen. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
| Leveret Pale hat Folgendes geschrieben: |
THEODOR
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres. Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern auf ihnen, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem, von Staub grau und träge, im Wind hängenden, scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor [Okay, an diesem Punkt wird der Sprecher für mich zum Moderator einer Modenschau... "Und hier sehen Sie Viola, sie trägt eine fliederfarbene Bluse..." Mit anderen Worten: Hier wird es mir zu viel des Guten was die Beschreibung der heranreitenden Gruppe betrifft.] Helme mit geöffneten Visieren und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte selber natürlich auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selber hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der, er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen. Einen Moment lang bedauerte er es, doch hatte er Angst und diese überschattete sein Mitleid mit dem Tier.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Nicht selten zierten dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. [Ist mir auch wieder zu viel.] In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachthimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora. Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagierte zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mannauf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einen Baum am Wegesrand gedschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkeln wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue [ich denke die sind alle grau? Wieso erwähnst du es nochmal?], verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd, krallten sich fest und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappelte stürzte sich ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an dem harten Stahl seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich und sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte und mit einem Hieb erschlug er ihn. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihm die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch dem Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum Anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn eine sonderbare, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in die Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er fror und zitterte am ganzen Körper, doch musste er alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte [Ja doch, ich hab verstanden, dass ihm kalt ist  ]. ].
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Ihre Schwertarme wurden immer müder und die Schilde immer schwerer. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschreie brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete. Er war ungefähr genauso groß wie Theodore und unter seinem schwarzen Umhang war ein bronzenes Brustharnisch, aber sonst war er unbewaffnet und ohne jegliche Rüstung. [Klingt seltsam. Und generell sind hier etwas viele 'war/en' zu finden.] Seine Haut war blass und grau und trotz seiner schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. [Was? Er ist 19? Aus irgendeinem Grund hatte ich die ganze Zeit einen Mann mittleren Alters vor Augen... hmmm] Doch was ihn am meisten verstörte waren die Augen, die wie glühende Kohle euchteten, während sie ihn musterten. Er spürte wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählte hatte und an die er sich schon längst nicht mehr erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil er schien ihn zu belächeln.
|
So...
Also du schlamperst öfter an den Endungen herum. Ein paar Fehler habe ich markiert, aber ich hab sicherlich noch welche übersehen. 
Zu deiner Frage... ich glaube nicht, dass ich das Buch kaufen würde. Es ist zwar nicht langweilig (Das mit den Ghulen interessiert mich schon, und auch das magische, das du andeutest) und ich finde, du schreibst auch nicht schlecht, aber für meinen persönlichen Geschmack wird zu viel beschrieben. Insgesamt einfach einen Hauch zu langatmig.
Besonders all das was vor dem Angriff kommt würde ich zusammenkürzen, sonst gehen dir die Leser verloren, bevor die Action losgeht... zumindest die, die ungefähr so ticken, wie ich.
Die vielen langen Sätze und Formulierungen übertragen die Hektik des Gemetzels nicht so gut. Der Kampf gegen die Ghule ist mir zu gestreckt. Das halte ich nicht lange durch, vor allem, solange mir der Charakter noch so gleichgültig ist, wie dein Theodor im Moment.
_________________
Always be yourself! Unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn! |
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  22.12.2015 19:40 22.12.2015 19:40
von Leveret Pale
|
  |
|
@Vidora
Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
Hab die meisten kleinen Änderungen, die du vorgeschlagen hast, umgesetzt. Werde aber noch daran feilen, wie ich das Schlachttempo erhöhe und Informationsdumping vermeide ( wobei ich davon bereits extrem viel raus gestrichen habe, wenn du es mal mit meiner ersten Version vergleichen würdest oder den ursprünglichen ,die ich gar nicht erst rein gestellt habe), aber ich befürchte etwas Informationflut wird nötig sein.
Theodor
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora. Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mannauf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren, doch bevor er sich aufrappelte stürzte sich ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch und die Zähne zersplitterten an seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte und mit einem Hieb erschlug er ihn. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte und die seltsame Kraft, die ihn zuvor ergriffen und geleitet hatte, war verschwunden.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Ihr Schwertarme wurden immer müder und die Schilde immer schwerer. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gast
|
 22.12.2015 21:07 22.12.2015 21:07
von Gast
|
 |
|
Hallo Leveret,
ich glaube, mit diesem Text stimmt grundsätzlich etwas nicht: er hat keinen Rhythmus. Du erzählst alle Dinge in der gleichen Geschwindigkeit und mit dem gleichen Aufwand, wodurch die Aufmerksamkeit des Lesers leidet (mangelnde Abwechslung!) und es außerdem unmöglich wird, das Wichtige vom Beiwerk zu unterscheiden. Es wirkt wie ein unablässiges Dröhnen; ein Dauerton, wie von einer Sirene. Versuch doch mal, da etwas Form hineinzubringen - an manchen Stellen zu beschleunigen, an anderen abzubremsen, hier mal etwas zu erklären, da die reine Handlung sprechen zu lassen; je nach Bedürfnis des Textes.
Weniger werden sollten auf jeden Fall die Vergleiche! Auch da gilt: Nim dir Zeit, mach sie ordentlich und so, dass sie dem Text helfen; oder lass sie weg. Bis jetzt wirken sie, da du sie völlig wahllos einsetzt, wie Fremdkörper im Text und stören viel mehr, als sie helfen.
Und dann: Erzähle genauer. Einmal, grammatikalisch, dann aber auch weniger klischeehaft.
Alles zusammen findet sich hier ganz gut:
"Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters."
Das ist, entschuldige, völliger Quatsch.
- Der Ghul ist überbeschrieben
- Der Ghul reißt, grammatikalisch, dem Pferd den Helm vom Kopf
- die "Fontäne aus Blut" ist ein albernes Klischee aus der Mottenkiste
- "Mit seinen Klauen" - warum erwähnst du das? Sprich, womit sonst??
- Mit den Zähnen in der Kehle schießt nichts, dafür müssen sie wieder raus. Und warum in den Nachthimmel und nicht nach unten / vorn?!
Alles zusammen macht aus diesen wenigen Sätzen eine vollkommen unglaubwürdige Szene, und mehr als zwei oder drei davon läse ich sicherlich nicht, bevor ich den Text beiseite lege.
Gruß,
Ferdi
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  24.12.2015 19:00 24.12.2015 19:00
von Leveret Pale
|
  |
|
@ferdi Danke für deine offene und äußerst hilfreiche Kritik!
Also das hier
| Zitat: | | "Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss ihm mit seinen Klauen den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle, sodass eine Fontäne aus dunklem Blut in den Nachthimmel schoss, zusammen mit dem gurgelnden Schrei des Ritters." |
Habe ich geändert, den es ist wirklich murks. Danke das du mir dafür die Augen geöffnet hast.
| Zitat: | | ich glaube, mit diesem Text stimmt grundsätzlich etwas nicht: er hat keinen Rhythmus. Du erzählst alle Dinge in der gleichen Geschwindigkeit und mit dem gleichen Aufwand, wodurch die Aufmerksamkeit des Lesers leidet (mangelnde Abwechslung!) und es außerdem unmöglich wird, das Wichtige vom Beiwerk zu unterscheiden. Es wirkt wie ein unablässiges Dröhnen; ein Dauerton, wie von einer Sirene. Versuch doch mal, da etwas Form hineinzubringen - an manchen Stellen zu beschleunigen, an anderen abzubremsen, hier mal etwas zu erklären, da die reine Handlung sprechen zu lassen; je nach Bedürfnis des Textes. |
Rythmus und Geschwindigkeit sind Dinge, mit dem ich erst seit ein paar Wochen rumexperimentiere und dieses Kapitel ist mehr oder weniger ein halbes Jahr alt, wenn man von paar Korrekturen absieht. Ich tu mir etwas schwer es im nachhinein umzuschreiben, des Weiteren sollen die Kampfszenen bewusst langsam ablaufen, weil Theodor sie in "Zeitlupe" erlebt. Später in der Handlung stellt sich raus, das er ein verborgenes Talent hat die Zeit zu verlangsamen und teilweise für einige Sekunden einzufrieren. Diese Fähigkeit wird hier angedeutet, den er benutzt sie durch den Stress unterbewusst, tut dieses Zeitlupenempfinden aber als gewöhnlichen Schlachtrausch ab. Da werde ich noch ein bisschen rumwerkeln müssen um das dem Leser richtig zu vermitteln, ohne zu viel zu verraten. Etwas tricky, aber ich krieg das hin.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  26.12.2015 13:21 26.12.2015 13:21
von Leveret Pale
|
  |
|
Also ich hab nocheinmal daran gearbeitet und stell jetzt mal das komplette Kapitel ein.
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora. Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mannauf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte sich ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert. Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte. Mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste alleine 25 oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte und die seltsame Kraft, die ihn zuvor ergriffen und geleitet hatte, war verschwunden.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Ihr Schwertarme wurden immer müder und die Schilde immer schwerer. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt. Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete. Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass und grau und trotz seiner Schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. Doch was ihn am meisten verstörte waren die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich schon längst nicht mehr erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil er schien ihn zu belächeln.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  26.12.2015 13:42 26.12.2015 13:42
von Leveret Pale
|
  |
|
Teil 2:
Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig und fast weinerlich:.
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen.«
Der Mann brach in einem düstern Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefrieren ließ und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie Eiszapfen aussahen, gewährte, doch er blieb standhaft und bewegte sich keinen Zoll.
»Mensch« seine Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?« Seine Hand schnellte nach oben und packte die Spitze des Schwertes, doch anstatt sie fortzureißen wie es Theodor erwartete, umklammerte der Mann sie fest und Dampf zischte unter seinen knochigen Finger, an denen anstelle von Fingernägeln schwarze Klauen waren, hervor. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze. Theodor ließ das Schwert erschrocken fallen. »Ihr wisst doch nicht mal mit wem ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Er trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte ihn der Fremde an seinem Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzen Konchensplitter, Hirn und Blut zwischen seinen Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor und während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und das Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Mann blickte ihm gleichgültig nach und hob seine Flache Hand, an der keine Spuren mehr von Blut waren, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel auf und stürzten sich auf den Schatten des Mannes. Sein Schreien verstummte und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten es.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor und einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte er seine Arme aus, während die beiden sich hinter hin, wie zwei Fohlen hinter ihre Mutter, drängten. Er würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer waghalsiger Mut, wie ihn nur ein Junge, gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster.«, sagte Theodor und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diesen klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig, Absborger. Aber dennoch ein Narr. Für eure Unhöflichkeit muss ich euch eigentlich den Kopf abreißen oder schlimmeres. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald.«
Den Namen kannte Theodor, wie wahrscheinlich jeder und er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghuleepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahre auslöschte, entsandte ihn der König dorthin um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und abzubrennen.
Er kehrte niemals zurück. Als man einige Wochen später Kundschafter aussandte, fanden diese die Stadt bis auf die Grundmauern niedergebrannt und sowohl Menschen- als auch Ghulleer vor. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. All diese Gedanken schossen durch seinen Kopf, doch aus seinem trockenen Mund kam nur ein undeutlicher Laut, der bei Ignacio höhnische Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe hat man die Legenden nocht nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie der entsprechende Respekt.«
Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade als Vaenyr bezeichnet? Als einen der ausgestorbenen Totengötter? Doch der Mann ging gar nicht weiter darauf ein, sondern setzte unbekümmert fort »Nun wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, den mein König duldet keine Überlebenden.«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Toten von einem König gesprochen? Hoorn war seitjeher Neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Sein Herz schien für einen Moment auszusetzen und bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
Die beiden Männer hinter ihm stürmten zum Angriff hervor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrt, blieb reglos stehen. Er hatte keine Waffe und sein Blick fiel auf das verbogene Schwert zu seinen Füßen. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige stürmte mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte »Für Hoorn, du Bestie.«
Dann geschah etwas Unglaubliches und es geschah so schnell, dass Theodor später oft daran zweifeln sollte ob es sich wirklich zu getragen hatte.
Die Haut der Handfläche des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss.Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren, Bewegung durchtrennte sie den Schaft der Axt, sodass ihr Kopf wirbelnd durch die Luft an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte er das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren und bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte. Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand des Angreifers, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit den Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte ihn und eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Ein flacher Stein ,der über die glatte Oberfläche eines Sees sprang erschien ihm vor seinen Augen, während er immer wieder auf den Boden aufschlug und die Explosion ihn weiter schleuderte, bis er gegen irgendetwas feste prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass er dachte er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerung wieder zusammensetzte und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Gesicht. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesaugt im Mondlicht schimmerte. Er lag bis zur Hüfte im Morast an eine Birke gelehnt. Sein ganzer Körper schmerzte und war mit einer Kruste aus verbrannten und geronnen Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeulte und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte, doch wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz zu pulsieren schien und aus einer Platzwunde über seinen Auge Blut über sein Gesicht floss. Thedor hatte er einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgreiz ankämpfte.
Es war still und nur der Wind rauschte durchs Gras und die Blätter der Birken und dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen und selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing in der Luft und er glaubte, dass tausende schwarze Augen ihn beobachteten. Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang er sich aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und das Metall klirrte. Er zog das das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er nicht alleine rankam. Theodor hielt mehrmals inne um zu lauschen und sich umzusehen. Jedes Geräusch welches er verursachte, erschien ihn unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte. Doch passiert nichts und so fasst er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung und er wagte es nicht seinen Blick nach links oder nach rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs, bei deren Gedanken er allein schon feuchte Hände bekam und eine gespenstische Kälte sich in ihm ausbreitete. Während er den Weg starr fixierte, kam ihn irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er was eigentlich. Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, so fehlten jeglichen Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und er bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war noch als Untoter wiederauferstehen konnte. Sogar einen Krater den die Explosion, die ihn weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Seine Gedanken schweiften hin und her während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles kam konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen Nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte. Aber solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben. Aber Vaenyre und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyre , die nekromantischen Menschengötter, waren wie die anderen Göttern in den großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Seine Gedanken kreisten wild und er irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte wahr sein konnte oder ob er de Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch ein dunkler Weg zur Festung Hoorn, die über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihn griff und er erwacht aus seinem tranceartigen Zustand. Den Rest des Wegs rannte er vor Angst um sein Leben. Alles schien nach ihn greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie und seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Mooren, über die Große Brücke, die über den Vyl führte, dem großen Fluss der die Stadt nicht nur mit Wasser versorgte sondern sich auf vor ihr gabelte und so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser bildete.
Als er das große Stadttor erreichte, hämmerte er dagegen, während aus den Schießscharten über ihm Soldaten der Wache ihm zubrüllten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen. Es gab neben dem Hafen nur 3 große Tore, die den Zugang zur Stadt ermöglichten. Ein ganzer Belagerungsturm hätte hineingepasst und das hölzerne Tor war halb so dick wie ein Mann hoch und ließ sich nur mittels eines komplizierten Flaschenzugmechanismus innerhalb der Mauer durch mehrere Männer öffnen und schließen. Die ganze Festung Hoorn, war die größte der bekannten Welt und noch nie wurde sie eingenommen. Es hieß Riesen und Magier hätten damals geholfen sie zu erbauen, doch all das war Theodor in diesem Augenblick egal. Er schrie bis seine Lunge fast versagten, er sei ein hoher Ritter, der Sohn des Grafen von Absborgen und er bringe wichtige Kunde für den König. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Dahinter erwartete ihn ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet. Nur durch viele wage Erklärungen und den Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust konnte er die Männer letztendlich dazu überzeugen ihn nicht ins Verlies zu werfen. Ein Mann der über und über mit geronnen Blut überzogen war und der wirr und zitternd redete, war schwer zu vertrauen.
Er verlangte, dass man ihm sofort zum König brachte, wenn auch er nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstfortschriften der Mauer vorsahen. Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur das ihn eine Kutsche über die selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten Straßen fuhr. Alle Bauer der Umgebung hatten aufgrund der Ghulplage der letzten Monate in der riesigen Stadt Zuflucht gesucht und so waren alle Wirtshäuser überfüllt und viele schliefen in den Straßen. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zu den Schöpfer, welche die Welt erschaffen hatten, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen, schließlich war Hoorns das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor kein Auge, auch wenn er zum ersten Mal seit seiner frühsten Kindheit hier war. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er den König erklären konnte ,was passiert sei und ob man ihn Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der- König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen und man versprach ihn eine Audienz in aller Frühe, was ihn nicht davon abhielt weiterzugrübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um ihn zu entkleiden und zu waschen, war er wie in Trance. Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, der die ganze Zeit lächelte, wusch seine Verletzung am Kopf und nähte sie mit einer heißen Nadel zu, doch Theodor war zu sogar zu erschöpft um vor Schmerzen zu schreien und ließ als über sich ergehen. Langsam kam er wieder zu Verstand und während, die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Der Apotheker wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich. Theodor lag benommen einige Momente einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken und die schrecklichen Erinnerungen im Rausch zu vergessen war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte. Angewidert schüttete er seinen Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er wie vom Apotheker angeraten sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Doch fand er kaum Schlaf, wann immer er die Augen schloss sah er wieder die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer. Sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen, die brachen. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulichster als alles, was er zuvor erlebt hatte. All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch in dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaeyre und Ghule erzählt hatte. Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen drang. Zu seiner Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets schimpfte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war, und dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester,die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihn seine Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht. Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Diener Papier und Schreibzeug bringen. Wollte einen Brief aufsetzen um seine Familie zu warnen und brach nach einigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwacht schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwecken kam Niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Sein ganzer Körper verkrampfte sich und rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann ihn die Erschöpfung übermannte und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gast
|
 26.12.2015 14:23 26.12.2015 14:23
von Gast
|
 |
|
Hallo Leveret!
Es ist wirklich schön zu sehen, wie engagiert du bezüglich der Verbesserung deines Textes bist.
Sobald ich daheim bin, werde ich versuchen, dir anhand einer Überarbeitung eines deiner Textabschnitte aufzuzeigen,
wie einige Kürzungen, Streichungen und Umformulierungen, meiner Meinung nach, die Qualität deines Textes deutlich verbessern würden. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters und ist nicht allzu leicht durchzuführen, da dein Schreibstil selbstverständlich beibehalten werden soll.
LG
AC
|
|
| Nach oben |
|
 |
Gast
|
 26.12.2015 16:19 26.12.2015 16:19
von Gast
|
 |
|
Ich nehme Bezug zu folgendem Ausschnitt:
| Zitat: |
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen. |
Überarbeitung:
Die Hufen der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte, während sie auf die Stadt am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die starren Finger einer toten Hand gen Himmel.
Sie waren über acht Dutzend Reiter, die meisten mit den Kettenhemden der königlichen Armee ausgestattet. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in prunkvoll verzierter Rüstung, der scharlachrote Umhang von einem Leviathanwappen geschmückt. Seine wilde Mähne tänzelte im Wind, das glattrasierte Gesicht besaß trotz der Anstrengung eine weiche Schönheit.
An seiner Seite ritten Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Die Sonne war fast vollstängig hinter dem Horizont verschwunden, erste Nebelfetzen trieben bereits über die Moore. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satt hatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung anstoßen. Im Gegensatz zum Prinzen, hatte Theodor sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen.
Er seufzte.
Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein.
Theodor gab seinem Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, doch Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Abermals stieß er seinem Pferd die Sporen in die Seite, diesmal kräftiger. Das Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten Blutes zierten Weg und Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo aus sie die Wege neugierig beobachteten.
Deine Formulierungen behielt ich so gut wie es ging bei. Wenn Finger z.B. nach etwas greifen, sind sie gebeugt - du beziehst dich hierbei auf die Türme der Stadt. Ergo würde ich vor meinem inneren Auge schiefe Türme sehen.
Ich habe jenes gestrichen, das -meines Erachtens- für Handlung oder Atmosphäre nicht relevant ist.
Wie schon erwähnt, bleibt dies nur ein Vorschlag und ist Geschmackssache. Deshalb: falls du über die Zeilen wanderst und die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln musst, dann ist das völlig in Ordnung. Hier geht es um DEINE Geschichte, über das, was für dich eine gute Geschichte ausmacht ... und es nützt nichts, wenn dann irgendeiner daherkommt und dir ein Bild aufzwängen will, was überhaupt nicht deinen Vorstellungen entspricht.
Ich finde jedenfalls, dir sind einige Formulierungen gut gelungen und wenn du weiterhin so engagiert am Ball bleibst, dann wirst du mit Sicherheit Großes schaffen! Keep on the good work!
Liebe Grüße
AC
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  26.12.2015 18:03 26.12.2015 18:03
von Leveret Pale
|
  |
|
Danke Ashcloud für deine Bemühung ! 
Deine Neuformulierung des anfangs hilft mir viel weiter. Ich bezweifle zwar, dass ich sie 1:1 übernehmen werden, aber einen großen Teil davon.
| Zitat: | | Ich finde jedenfalls, dir sind einige Formulierungen gut gelungen und wenn du weiterhin so engagiert am Ball bleibst, dann wirst du mit Sicherheit Großes schaffen! Keep on the good work! |
Danke für das Lob und die Motivation 
Ich versuche das beste daraus zu machen. Ich habe nicht monatelang einen Roman geschrieben, damit er am Ende schlecht ist, weil ich mir bei der Überarbeitung keine Mühe gegeben habe.
|
|
| Nach oben |
|
 |
TZH85
 Eselsohr Eselsohr

Alter: 39
Beiträge: 300
Wohnort: Essen
|
  26.12.2015 21:52 26.12.2015 21:52
von TZH85
|
 |
|
So, ich wage mich mal an den ersten Teil. Wenn ich Zeit finde, folgt der nächste 
Vorne weg - ich finde, du hast eine sehr bildliche Sprache und ich konnte mir beim Lesen die meisten Szenen problemlos vorstellen.
Allerdings stecken noch einige Wortwiederholungen drin und du neigst an einigen Stellen zu übermäßig vielen, eingeschobenen Nebensätzen. Deine Schreibe könnte an Lesbarkeit gewinnen, wenn du dich an einigen Stellen ein wenig zurücknimmst. Ich markiere mal, was mir aufgefallen ist.
| Leveret Pale hat Folgendes geschrieben: | Also ich hab nocheinmal daran gearbeitet und stell jetzt mal das komplette Kapitel ein.
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend die matschige Erde auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Die Erde bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Dreimal "Erde" finde ich etwas viel für zwei Sätze. Vielleicht einmal "Boden" oder weglassen?
Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen griffen wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit den Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und selbst jetzt, wo er unter der Anstrengung keuchte, hatte es diese weiche Schönheit, für die es bei den Damen des Hofs so beliebt war. An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs. Ich würde das "ein" weglassen, das lässt die Person so beliebig klingen.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt, das Wappen der Grafschaft Absborgen, während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf, einem in den Sümpfen und Hochmooren von Hoorn heimischen Nager, der meist unter Wasser schwamm, sich von Fischen ernährte und bis zu 5 Fuß lang wurde. Der letzte Satz hat über fünfzig Wörter. Wird der Nager als Wappentier noch wichtig im Rest des Kapitels? Falls nicht, würde ich das weglassen. Der Leser kann seine eigene Fantasie benutzen, wenn du von einem "Bunyip" sprichst. Falls es später wichtig wird, kannst du immer noch Aufklärungsarbeit leisten.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen.
Hier ist ein Beispiel für die eingeschobenen Nebensätze, die dir Tempo klauen. Wie wäre z. B. "Die Straße vor ihnen schlängelte sich durch das Moor. Von der Küste her trieben blasse Nebelfetzen ins Land"?
Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten.
Die "Rückblende" könnte etwas kürzer sein. Du beschreibst sehr genau, was alles passiert ist, bevor die Erzählung einsetzt. Dass sie nicht viel Gepäck dabei haben, ist z. B. keine besonders wichtige Information. Ich würde hier kürzen, dann kommst du auch etwas schneller zur Action.
Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung. Der mittlere Satz ist ziemlich lang.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten oder in ihnen zu nächtigen war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten. Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Levi Hoorn ist der Prinz, oder? Dann würde ich den Satz mit "um seine Verlobung..." beenden, sonst verwirrt es etwas.
Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag an den Bergen im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Der Abschnitt gefällt mir.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn, des Königs von Hoorn , dem kleinen aber ältesten Königreich im Süden von Malestur. In der Dunkelheit konnte er zwar nicht mehr das Gesicht, aber dafür die aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhalten konnte, war ihm schleierhaft. Würde ich streichen, du hast eine ähnliche Beobachtung auch schon weiter oben im Text.
Die Sonne verschwand endgültig hinter dem Horizont. Am Nachhimmel erschienen, statt ihrer, zwischen den Wolkenfetzten, die beiden Monde Fratos und Sora. Fratos, der größere der beiden leuchtete voll und tränkte die Nacht in seinem leichenblassen Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing. Würde ich streichen.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten schneller reiten, doch sein Befehl ging im tosendem Lärm der Hufen unter und war sowieso sinnlos, da die Pferde bereits bis an ihre Grenze gingen. Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er, schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare waren so weiß, dass sie im Dunkeln leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. "Seine weißen Haare leuchteten in der Dunkelheit und seine Augen brannten wie Glut". Das ist eine eindringliche Beschreibung, ich würde das nicht relativieren. Aber vielleicht solltest du das "schemenhaft" weiter oben überdenken. Dafür ist die folgende Beschreibung nämlich ziemlich detailliert.
Bevor er über die Bedeutung dessen, was er sah, nachdenken konnte, riss er die Zügel seines Pferdes instinktiv zurück. "Instinktiv" bedeutet ja schon, "ohne nachzudenken", der erste Teil kann weg 
Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mannauf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand gedschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt. Ich würde das erste "und" streichen.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben. Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auch auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie fünf oder mehr Ghule sich auf sein Pferd stürzten. Sein Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte sich ein Ghul auf ihn. Das "auch" lässt die Szene wie einen Nachsatz klingen. Es wäre eine Überlegung wert, ob du nicht Theodors Szene weiter nach vorne stellst. In der ersten Überraschung ist er wahrscheinlich erst mal mit sich selbst beschäftigt und der Leser interessiert sich sicher mehr für das Schicksal der Figur, nach der das Kapitel benannt ist.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an seiner Unterarmschiene. Das Wesen, welches seiner Kleidung und Statur nach zu urteilen früher eine Bäuerin gewesen war, heulte vor Schmerz auf. Ich hatte diese komplett grotesken Figuren vor Augen, wenn du die Ghule beschreibst. Von daher finde ich "Bäuerin" etwas zu spezifisch. Wenn sie kaum noch menschlich aussehen, würde ich Theodor eher rätseln lassen, ob es überhaupt mal eine Frau war.
Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor, der dagegen ankämpfen musste, sich nicht in sein Visier zu übergeben. Der Satz verliert durch den Nebensatz zum Schluss wieder an Tempo. Ich denke, es reicht, einfach nur zu sagen, dass Theodor übel war.
Er taumelte davon, während ihn bereits zwei weitere Ghule ansprangen, die ihn in Stücke gerissen hätten, wäre nicht einer der Soldaten vorbeigeritten und hätte ihnen nicht mit seinem schwingenden Streithammer die Schädel zertrümmert.
Ein bisschen viel Konjunktiv. Vorschlag: "Er taumelte davon, zwei Ghule dicht auf seinen Fersen. Der Schnellere griff nach ihm - als plötzlich der Schädel der Kreatur explodierte. Ein Soldat ritt vorbei, sein Streithammer bereit für den nächsten Schlag"?
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an und einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Der Blaue Stoff fiel auf den Ghul, der sich darin verhedderte. "Das Monster verhedderte sich im Stoff" - dass der Mantel auf den Ghul gefallen ist, ist klar, wenn er sich darin verheddert.
Mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er fror in seiner Rüstung, aber er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das Blut. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, wobei schwarzer Schleim aus seinem Rachen auf Theodors Rüstung spritzte, und die Krallen über dem Stahl schabten. Das "wobei" bremst wieder etwas. "Der Junge kreischte, schwarzer Schleim spritzte auf Theodors Rüstung"
Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des dritten und durchtrennte die des vierten. Ich nehme mal an, Theodor wurde an dieser Stelle - rot markiert - von einer geheimnisvollen Macht/Figur gelenkt? Ich würde den Satz in Rot streichen. Es ist dann noch immer verständlich, aber etwas weniger offensichtlich für den Leser. Vielleicht ist Theodor im Blutrausch auch gar nicht bewusst, dass er plötzlich viel mächtiger ist? Er könnte hinterher darüber sinnieren und sich wundern. Dann rätselt der Leser mit.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste alleine 25 (würde ich ausschreiben) oder mehr von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule, von denen die meisten an ihm vorbei stürmten, zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte und die seltsame Kraft, die ihn zuvor ergriffen und geleitet hatte, war verschwunden.
Der letzte Satzabschnitt macht es etwas zu offensichtlich.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Ihr Schwertarme wurden immer müder und die Schilde immer schwerer. Nach und nach fiel ein Soldat nach dem anderen und wurde von den Ghulen fortgerissen. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Hier bist du plötzlich allwissender Erzähler und verlässt Theodors Perspektive. Vielleicht lieber "Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort."
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel, wobei er eine Spur aus Blut hinterließ. Seine Todesschrei brachen abrupt ab, kurz nachdem sein Schatten im Nebel verschwand. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter vor sich haltend. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte, doch er stand schweigend auf seinem gesunden Bein, während er sich mit einer Hand an seinem Kameraden festhielt und mit der anderen zitternd seine Streitaxt hielt.
Wie eine schwere Kette auf ihren Schultern schien die Angst sie zu erdrücken. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
In den beiden oberen Abschnitten verlierst du dich in Details. Dass die Kettenhemden klirrten oder dass es noch immer nach Tod riecht, zieht die Szene unnötig in die Länge. Wie wäre es stattdessen mit Dialog? Die Männer sind zwar geschockt, aber dass überhaupt niemand etwas sagt, finde ich etwas komisch. Vielleicht geschockte oder ungläubige Ausrufe oder panisches Lachen?
Keiner der Männer wagte es zu sprechen. Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Die beiden Monde schienen durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen auf sie hinab, wie die Zuschauer bei einem Duell.
Theodor blinzelte. Er meinte zu sehen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien angespannt. Fest umklammerte er sein Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete. Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass und grau und trotz seiner Schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. Doch was ihn am meisten verstörte waren die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich schon längst nicht mehr erinnern konnte. Das klingt komisch. Wenn er sich längst nicht mehr daran erinnern kann, wieso hat er sofort diese Assoziation?
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil er schien ihn zu belächeln. |
Uaaah. Alles bunt. Das sieht schlimmer aus, als es ist.
Im großen und ganzen hat mir der Text gefallen. Man wird an einigen Stellen nur von Details erschlagen.
Vielleicht findest du die ein oder andere Anmerkung ja hilfreich.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  26.12.2015 22:25 26.12.2015 22:25
von Leveret Pale
|
  |
|
@TZH85
Tausend Dank für die Anmerkungen!! 
Die sind Gold wert und damit kann ich auch erstmal eine Weile arbeiten.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  27.12.2015 19:42 27.12.2015 19:42
von Leveret Pale
|
  |
|
Ich poste im Laufe des Abends eine überarbeitete Version des Kapitels.
Hab gerade entdeckt, dass ,wenn ich mir das Manuskript auf dem Kindle als pdf durchlese, es so sehr verfremdet wirkt, dass mir alle Fehler und unschönen Formulierungen ins Auge springen. 
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  27.12.2015 21:55 27.12.2015 21:55
von Leveret Pale
|
  |
|
Also ich habe den kompletten Text überarbeitet und er ist jetzt um einiges besser als vorhin, viel viel besser. In einem Durchlauf habe ich glaub ich noch nie soviel geändert.
Theodor
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und seine berühmte, weiche Schönheit.
An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt -das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten.Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand hinterm Horizont. Am Nachhimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora zwischen den Wolkenfetzen.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufen unter.
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Instinktiv riss er die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken, doch andere übernahmen das für ihn.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben.
Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sich mehrere Ghule auf sein Pferd stürzten. Theodors Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an. Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich im Umhang und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim spritzte auf Theodors Rüstung und Krallen schabten über Stahl. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. So zog er seine blutigen Bahnen durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste dutzende von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule stürmten an ihm vorbei zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen die Todesschreie abrupt ab. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an seinem Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt. Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schulter und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte in seinen Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren. Seine Hand stärkte den Griff um das Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass und gräulich. Trotz seiner Schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. Was ihn am meisten verstörte waren die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien ihn zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:.
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« seine Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?« Seine Hand schnellte nach oben und packte die Spitze des Schwertes. Dampf zischte unter seinen knochigen Finger, an denen, anstelle von Fingernägeln schwarze Klauen waren, hervor. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbeln durch den Nebel davon.
»Ihr wisst doch nicht mal mit wem ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte ihn der Fremde an seinem Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzen Konchensplitter, Hirn und Blut zwischen seinen Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor und während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und das Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine Flache Hand, an der keine Spuren mehr von Blut waren, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten es.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor und einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte er seine Arme aus, während die beiden sich hinter hin, wie zwei Fohlen hinter ihre Mutter, drängten. Er würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer waghalsiger Mut, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diesen klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig. Aber dennoch ein Narr. Für eure Unhöflichkeit muss ich euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch Häuten und Pfählen bevorzugen würde. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald.«
Den Namen kannte Theodor, wie wahrscheinlich jeder in dem südlichen Königreichen. Er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghuleepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahre auslöschte, entsandte ihn der König dorthin um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und abzubrennen.
Er kehrte niemals zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. All diese Gedanken schossen durch seinen Kopf, doch aus seinem trockenen Mund kam nur ein undeutlicher Laut, der bei Ignacio höhnische Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie der entsprechende Respekt.«
»Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade als Vaenyr bezeichnet? Als einen der ausgestorbenen Totengötter? Doch der Mann ging gar nicht weiter darauf ein, sondern setzte unbekümmert fort »Nun wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, den mein König duldet keine Überlebenden.«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Toten von einem König gesprochen? Hoorn war seitjeher Neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Sein Herz schien für einen Moment auszusetzen und bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an du Scheusal«
Die beiden Männer hinter ihm stürmten zum Angriff hervor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrt, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte : »Für Hoorn, du Bestie.«
Das folgende geschah so schnell, dass Theodor später oft daran zweifeln sollte, ob es sich wirklich zu getragen hatte.
Die Hand des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss. Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung durchtrennte sie den Schaft der Axt, sodass ihr Kopf wirbelnd durch die Luft an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte er das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte. Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit den Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte ihn und eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Ein flacher Stein ,der über die glatte Oberfläche eines Sees sprang erschien ihm vor seinen inneren Augen, während er immer wieder auf den Boden aufschlug und die Explosion ihn weiter schleuderte, bis er gegen irgendetwas feste prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass er dachte er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerung wieder zusammensetzte und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesaugt im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine Birke gelehnt. Sein ganzer Körper schmerzte und war mit einer Kruste aus verbrannten und geronnen Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeulte und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte und aus einer Platzwunde über seinen Auge Blut über sein Gesicht floss. Thedor hatte er einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgreiz ankämpfte.
Es war still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die Blätter der Birken und dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing in der Luft und er glaubte von abertausenden, schwarze Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang er sich aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und das Metall klirrte. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er allein nicht rankam. Theodor hielt mehrmals inne um zu lauschen und sich umzusehen. Jedes Geräusch welches er verursachte, erschien ihn unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte. Doch passiert nichts und so fasst er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung und er wagte es nicht seinen Blick nach links oder nach rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs, bei deren Gedanken er allein schon feuchte Hände bekam und eine gespenstische Kälte sich in ihm ausbreitete. Während er den Weg starr fixierte, kam ihn irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er was eigentlich. Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jeglichen Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und er bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war noch als Untoter wiederauferstehen konnte. Sogar einen Krater den die Explosion, die ihn weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten.
Seine Gedanken schweiften hin und her während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles kam konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen Nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben.
Aber Vaenyre und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyre , die nekromantischen Menschengötter, waren wie die anderen Göttern in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Seine Gedanken kreisten wild und irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte wahr sein konnte oder ob er den Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch ein dunkler Weg zur Festung Hoorn, die über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihn griffen und er erwacht aus seinem tranceartigen Zustand.
Den Rest des Wegs rannte er vor Angst um sein Leben. Alles schien nach ihn greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie und seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Mooren, über die Große Brücke, die über den Vyl führte, dem großen Fluss der die Stadt nicht nur mit Wasser versorgte sondern sich auf vor ihr gabelte und so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser bildete.
Als er das große Stadttor erreichte, hämmerte er wild dagegen. Das Tor war riesig, ein ganzer Belagerungsturm hätte hineingepasst und das hölzerne Tor war halb so dick wie ein Mann hoch und ließ sich nur mittels eines komplizierten Flaschenzugmechanismus innerhalb der Mauer durch mehrere Männer öffnen und schließen. Die ganze Festung Hoorn, war die größte der bekannten Welt und noch nie wurde sie eingenommen. Es hieß Riesen und Magier hätten damals geholfen sie zu erbauen, doch all das war Theodor in diesem Augenblick egal.
Aus den Schießscharten über ihm riefen ihm Soldaten zu, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Er schrie bis seine Lunge fast versagten, er sei ein hoher Ritter, der Sohn des Grafen von Absborgen und er bringe wichtige Kunde für den König. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Dahinter erwartete ihn ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet. Nur durch viele vage Erklärungen und den Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust konnte er die Männer letztendlich dazu überzeugen ihn nicht ins Verlies zu werfen. Ein Mann der über und über mit geronnen Blut überzogen war und der wirr und zitternd redete, war schwer zu vertrauen.
Er verlangte, dass man ihm sofort zum König brachte, wenn auch er nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstfortschriften der Mauer vorsahen. Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zu den Schöpfer, welche die Welt erschaffen hatten, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen, schließlich war Hoorns das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber kein Auge. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er den König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihn Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen und man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Das hielt ihn nicht davon ab weiterzugrübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um ihn zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, der die ganze Zeit lächelte, wusch seine Verletzung am Kopf und nähte sie mit einer heißen Nadel zu, doch Theodor war zu sogar zu erschöpft um vor Schmerzen zu schreien und ließ als über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihn noch einen Aufguss aus beruhigenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und während die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen einige Momente einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken und die schrecklichen Erinnerungen im Rausch zu vergessen war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte.
Angewidert schüttete er seinen Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er ,wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos` schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Doch fand Sir Theodor Absborgen kaum Schlaf. Wann immer er die Augen schloss, sah er wieder die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer. Sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen, die brachen. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulichster als alles, was er zuvor erlebt hatte. All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch in dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyre und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen drang. Zu seiner Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets schimpfte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihn seine Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Diener Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen um seine Familie zu warnen und brach nach einigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwacht schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwecken kam Niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Sein ganzer Körper verkrampfte sich und rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung ihn übermannte und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
Leveret Pale
 Klammeraffe Klammeraffe

Alter: 25
Beiträge: 786
Wohnort: Jenseits der Berge des Wahnsinns
|
  02.01.2016 20:13 02.01.2016 20:13
von Leveret Pale
|
  |
|
Hab nochmal daran gearbeitet.
Theodor
Die Hufe der Pferde rissen schmatzend den matschigen Untergrund auf, warfen Schlamm und Erdbrocken in die Luft. Der Boden bebte unter ihnen, während sie auf die entfernte Stadtmauer am Horizont zu donnerten. Die königliche Hauptstadt Hoorn mit ihrer über sechshundert Fuß hohen Stadtmauer ragte wenige Meilen vor ihnen auf. Ihre unzähligen Türme und Festungsanlagen zeigten wie die erstarrten Finger einer toten Hand zum Himmel. Dahinter funkelte ein dünner, dunkelblauer Streifen des dynerischen Meeres.
Sie waren über acht Dutzend Pferde mit ebenso vielen Reitern, die meisten in den Kettenhemden und den dunkel grünen Umhängen der königlichen Armee. An ihrer Spitze ritt ein Reiter in einer prunkvoll verzierten Rüstung und einem scharlachroten Umhang mit dem Leviathanwappen des Königshauses Hoorn. Er trug keinen Helm und seine wilde haselnussbraune Mähne kräuselte sich im Wind. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Sein Gesicht war glatt rasiert und seine berühmte, weiche Schönheit.
An seiner Seite ritten er, Sir Theodor, der Sohn des Grafen Absborgen, und Sir Wilmar Bylbon, ein Ritter und Vasall des Königs.
Im Gegensatz zum Prinzen trugen Wilmar und Theodor Helme und schlichte Stahlrüstungen. Theodors Umhang war dunkelblau mit dem goldenen Einhorn bestickt -das Wappen der Grafschaft Absborgen - während Sir Bylbon einen beigen Umhang trug mit dem schwarzen Bunyip drauf.
Am Horizont ging die Sonne neben der Stadt im dunklen dynerischen Meer unter.
Bald würde die Nacht über sie hereinbrechen. Die ersten blassen Nebelfetzen trieben von der Küste über die Moore, durch die sich ihre Straße schlängelte, zu ihnen. Immer wieder warfen die Männer einen flüchtigen Blick auf die Straße zurück, doch sie war dort genauso leer wie vor ihnen. Sie waren viel zu spät aus Bylbon aufgebrochen. Nur wegen diesen verdammten Feiern, die Theodor gründlich satthatte. Bei jeder noch so kleinen Ritterburg, an der sie hielten, musste der Prinz mit dem Burgherr auf seine Verlobung mit Alekta Kasteron anstoßen. Theodor hatte auch mit den anderen Rittern das Glas erhoben, aber im Gegensatz zum Prinzen hatte er sich nicht betrunken und war bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen gewesen, um die letzte Etappe ihrer Reise zurück nach Hoorn anzutreten. Der Prinz selbst hatte sich vor Mittag nicht sehen lassen. Sollten die Gerüchte stimmen, dann würde der Zorn des Königs über ihre Verspätung ihr geringstes Problem sein, wenn sie sich nach Sonnenuntergang noch außerhalb der Stadt aufhielten. Zumindest hatten sie kaum Gepäck bei sich, welches sie verlangsamte, da sie von Burg zu Burg ritten. Theodor gab seinem schweißbedeckten Pferd die Sporen, um mit dem Prinzen mitzuhalten. Kater hin oder her, der Prinz war sattelfest wie eh und je.
Theodors Schenkel verkrampften sich vor Schmerz und seine durchgescheuerte Haut brannte. Er verfluchte sich dafür, dass er die schwere Rüstung angezogen hatte, unter der er in seinem eigenen Schweiß badete, anstelle einer leichten Reitkleidung, aber Sir Bylbon hatte aus Sicherheitsgründen darauf bestanden. Wütend stieß er seinem Pferd abermals die Sporen in die Seite. Das arme Tier wieherte vor Schmerzen und Erschöpfung.
Die Aussicht bei Nacht durch die Moore zu reiten, oder in ihnen zu nächtigen, war alles andere als verlockend. Alle Dörfer, durch die sie hindurchritten, waren verlassen. Einige waren niedergebrannt worden. Nur noch schwarze, verkohlte Holzskellette zeugten von ihrer einstigen Existenz. Bei anderen waren die Türen und Fenster eingebrochen oder zerkratzt. Dunkle Flecken und Pfützen getrockneten, dunkelroten Blutes zierten den Weg und die Wände. Leichen gab es nicht, weder von Tieren noch von Menschen. Selbst die Krähen hielten sich fern von den Dörfern. Sie saßen auf den umstehenden Birken von wo sie aus die Wege neugierig zu beobachten schienen.
Wann immer die Männer durch solch ein Dorf kamen, drängten sie sich so dicht beieinander, dass sie sich fast gegenseitig über den Haufen ritten.Sie blickten sich angsterfüllt um, wie kleine Kinder, die sich im Wald verlaufen hatten. Theodor jedoch starrte genauso entschlossen wie der Prinz nach vorne, auf ihr Ziel, die Stadt seines Königs Cornelius Hoorn. Die Berichte über die Verschlimmerung der Ghulplage, die sie vereinzelt in Absborgen erhalten hatten, erwiesen sich mehr als richtig, auch wenn Niemand von ihnen solche Ausmaße erwartet hatte.
Als sie vor nicht mal zwei ganzen Mondtänzen abreisten, waren Ghule außerhalb ihrer Grüfte keine Bedrohung. Aber irgendetwas war geschehen und niemand wusste warum. Er schüttelte den Kopf.
Lange war die Reise in den kalten Norden gewesen, auf die er den Prinzen begleitet hatte, um die Verlobung zwischen Levi Hoorn und Alekta Kasteron zu beschließen. Allein bei den Gedanken an die drei weißhaarigen Töchter des alten Grafen Kasterons, mit Augen wie Schneeflocken und Herzen wie Eisbrocken, fröstelte es ihn. An Levis Stelle würde er sich wahrscheinlich auch betrinken. Kasteron lag in den Ryphyneengebirge im Norden, wo Eisbären und Mammuts aneinander zerfleischten und die klirrende Kälte einen ins Grab begleitete. Ein kaltherziger Ort, der kaltherzige Menschen heranzog.
Seine feuchten Hände klebten an der Innenseite der Lederhandschuhe, mit denen er die Zügel seines weißen Hengstes umklammerte. Er warf einen Blick rüber zu Prinz Levi Hoorn, genannt der Schönling und zweitältester Sohn des Königs von Hoorn. In der Dunkelheit konnte er nur noch die selbstbewusste Körperhaltung ausmachen. Wie Levi diese trotz des vielen Weins und des schnellen Galopps aufrechterhielt, war ihm schleierhaft.
Die Sonne verschwand hinterm Horizont. Am Nachhimmel erschienen die beiden Monde Fratos und Sora zwischen den Wolkenfetzen.
Fratos, der größere der beiden, leuchtete voll und tränkte die Nacht in sein braunes Licht, während Sora noch als kleine blaue Sichel tief am Horizont hing.
Die einzelnen Nebelfäden verdichteten sich zu dicken Nebelschwaden und bald war ihre Sicht auf wenige Schritte beschränkt.
Sir Bylbon brüllte über die Schulter zu seinen Männern, sie sollten vorsichtiger sein, doch sein Befehl ging im tosenden Lärm der Hufen unter.
Sie donnerten so schnell um eine Abbiegung, dass Theodor erst im letzten Augenblick die Gestalt sah, die sich vor ihnen auf den Weg aufgebaut hatte. Für einen Moment glaubte er schemenhaft einen Mann in schwarzer Kleidung im Mondlicht zu sehen. Die Haut und die Haare so weiß, dass sie im Dunkeln beinah leuchteten und er meinte zu erkennen, dass die Augen des Mannes wie Glut brannten. Instinktiv riss er die Zügel seines Pferdes zurück. Es kam gerade noch so zum Stehen, ohne ihn abzuwerfen, doch der Prinz vor ihm reagiert zu langsam. Sein Pferd strauchelte und stieß fast mit dem Unbekannten zusammen. Entsetzt sah Theodor wie der Mann auf der Straße mit seiner Hand, oder eher Pranke, nach dem Pferd schlug, sodass es samt Reiter gegen einem Baum am Wegesrand geschleudert wurde. Die Beine des Prinzen knackten laut, wie dünne Äste, die man fürs Feuermachen zerbrach, unter der Last des toten Pferdes. Levis schöner Kopf schlug gegen den Baumstamm und platze auf wie eine überreife Frucht.
In Theodors Kehle blieb ein Schrei stecken, doch andere übernahmen das für ihn.
Ein lautes markerschütterndes Heulen ertönte und das Klirren von Stahl als Schwerter gezogen worden. Alles zog sich in Theodor vor Angst zusammen. Pferde wieherten. Kaum hatte er das Visier seines Helms heruntergeklappt, sah er dunkle Schemen überall um sie herum. Guhle lösten sich aus dem Nebel und stürmten kreischend vom Moor auf die Straße. Graue, hässliche und haarlose Gestalten, die einst Menschen gewesen waren und deren kohleschwarzen Augen gierig nach Blut funkelten. Theodor zog sein Schwert und holte nach dem ersten Ghul aus, der auf ihn zugesprungen kam, und durchtrennte dessen Körper mit einem sauberen Schnitt.
Einige von den Soldaten schrien, andere weinten, wieder andere begannen laut stark zum Schöpfer oder zu Göttern zu beten, während sich viele vergebens gegen die Flutwelle aus Untoten, die über ihnen hereinbrach, wehrten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden kreischend von ihren Pferden gerissen und unter einem Haufen hungriger Ghule begraben.
Theodor sah aus den Augenwinkel wie Sir Bylbon versuchte, sein vor Angst wahnsinniges, Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Ghule, eine kleine graue, verkrümmte Gestalt, bis auf eine zerrissene Hose nackt, sprang auf Sir Wilmars Bylbons Pferd und riss dem Ritter den Helm vom Kopf. Die scharfen Zähne gruben sich in die Kehle und ein gurgelnder Schrei des Ritters hallte über das Schlachtfeld. Weitere Untote sprangen auf das wiehernde Pferd und rissen es bei lebendigem Leib in Stücke. Die Luft war mit Blut und Todesschreien getränkt.
Auf Theodors Pferd sprangen Ghule und krallten sich fest, schnappten nach Theodor. Blut rann über das weiße Fell. Das Tier drehte laut wiehernd durch und trat nach ihnen. Theodor Absborgen versuchte sich verzweifelt an seinem Pferd festzuhalten, während er mit einer Hand nach den Ghulen stach. Vergeblich. Mit einem hohen Bogen flog er über den Kopf des Pferdes. Seine schwere Rüstung schepperte im blutgetränkten Staub der Straße. Für einen Augenblick blieb ihn die Luft weg und er schnappte nach ihr, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er drehte sich auf seinen Rücken und sah, wie sich mehrere Ghule auf sein Pferd stürzten. Theodors Schädel dröhnte und er hatte sein Schwert verloren. Bevor er sich aufrappeln konnte, stürzte ein Ghul auf ihn.
Instinktiv riss er seinen Arm hoch. Die Zähne zersplitterten an der Unterarmschiene. Das Wesen, welches entfernt an eine Frau erinnerte, heulte vor Schmerz auf. Theodor warf es von sich, sprang auf und ließ seinen schweren gepanzerten Stiefel auf den Schädel der Untoten unter ihm niedersausen. Der Kopf des Ghuls zerbrach unter dem Fuß laut knackend wie eine Nuss und die schwarze, gräuliche Masse, die einst ein Hirn gewesen war, quoll und spritzte in alle Richtungen. Abscheu und Übelkeit überkamen Theodor.
Er taumelte davon, zwei weitere Ghule auf den Fersen, der schnellere der beiden griff bereits nach ihm, als sein Schädel mit einem lauten Krachen zersprang. Der Soldat, der an Theodor vorbeigeritten war, schwang seinen Hammer gegen den zweiten Ghule, sodass Sir Absborgen entkommen konnte.
Theodor sah sein Schwert im Mondlicht auf dem Boden funkeln. Gerade als er das Heft mit seiner Hand umschloss, griffen ihn die Ghule wieder an. Einer zerrte an seinem Umhang. Theodor wirbelte mit seiner Klinge herum und befreite sich mit einer flüssigen Bewegung sowohl von Umhang als auch vom Ghul. Das Monster verhedderte sich im Umhang und mit einem Hieb durchstach Theodor den Stoff und den Ghul darunter. Mit schnellen Schwertschnitten entledigte er sich drei weiteren Ghulen. Er erledigte einen nach den anderen, während er sich seinem Weg über das Schlachtfeld bahnte.
Leichen von Pferden, Ghulen und Soldaten stapelten sich auf dem Weg, dennoch strömte für jeden toten Ghul ein Dutzend Neuer nach. Woher kamen sie? Ghule hatte es zwar schon immer gegeben, aber nie in diesem Ausmaß und nie hatten sie ihre Gruften und Katakomben verlassen, warum jetzt und warum so viele, schoss ihn die Frage in den Kopf. Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen. Sein Herz raste und in seinen Ohren rauschte das But. Der Geruch von Verwesung, Tod, Blut und der Gestank des Moores umhüllten ihn, genauso wie die Schreie von sterbenden Männern und Untoten. Diesen Kampf konnten sie nicht mehr gewinnen, stellte er verbittert fest, während er sich seinen Weg zum Herzen der Kämpfe bahnte, wo eine Gruppe von Soldaten in geschlossener Kreisformation noch den Ansturm standhielt. Er hieb nach einem Ghul, der auf ihn zusprang und das verzerrte Gesicht eines jungen Mannes in seinem Alter hatte, doch das Schwert blieb im Hals des Untoten stecken. Der Junge kreischte, schwarzer Schleim spritzte auf Theodors Rüstung und Krallen schabten über Stahl. Er trat den Ghul von sich und riss das Schwert mit einem Ruck heraus.
Plötzlich durchströmte eine Welle aus Kraft seinen Körper, sein Herz schlug schneller, sein Blick wurde schärfer. Die ganze Welt schien sich, bis auf ihn, nur noch in Zeitlupe zu bewegen, während er blitzschnell mit seinem Schwert herumwirbelte und Gliedmaßen und Körper wie Gras mähte. Er tanzte über das Schlachtfeld zu einer Musik, die nur er hören konnte und bei jedem Paukenschlag versenkte er die Schwertspitze in einem anderen Untoten. Es war, als würde er von einem Tanzpartner zum anderen wechseln und immer wissen, wo sich der Nächste befand. Als würde ihn ein sonderbar, alte Kraft lenken. Seine Klinge fraß sich in der Kehle eines Ghuls und wirbelte herum, um den zu enthaupten, der sich von hinten angeschlichen hatte, parierte die Klauen des Dritten und durchtrennte die des Vierten. So zog er seine blutigen Bahnen durch die untoten Horden.
Die Welt beschleunigte sich wieder. Der Schlachtrausch klang ab. Theodor stand keuchend und zitternd in einem Haufen toten Fleisches. Er musste dutzende von ihnen erschlagen haben. Außer ihm befand sich in seiner Nähe niemand Lebendiges mehr. Nur einige Ghule stürmten an ihm vorbei zu der Mitte des Weges, wo das Schlachten noch tobte. Eine Gruppe Überlebender hatte sich in der Mitte der Straße gesammelt und kämpfte ohne ihre Pferde am Boden. So konnten sie sich gegenseitig mit den Schildern Deckung geben. Er machte zwei weitere Ghule vor ihnen nieder, nun viel langsamer. Der sonderbare Blutrausch, der ihn vorhin gepackt hatte, hatte sich verflüchtigt und hatte dabei seinen Tribut eingefordert. Theodors ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung und Kälte.
Die Soldaten öffneten die Formation, in die er sich lückenlos eingliederte. Rücken an Rücken im Kreis versuchte Theodor mit den Männern den Angriffen stand zuhalten. Ihre stumpfer werdenden Klingen zurrten durch die Luft und schlugen, die nach ihnen greifenden, Klauen und Köpfe ab, während schwarzes, untotes Blut ihre Rüstungen bespritzte. Theodors Schwertarm wurde schwerer und schwerer. Die Ghule rissen einen seiner Mitstreiter nach dem anderen fort. Gerade als Theodor sich bereits zu Tode verurteilt wähnte, brach der Angriff plötzlich ab.
Langsam, mit geneigtem Kopf, und knurrend wie geschlagene Hunde, zogen sich die Ghule rückwärts in den Nebel zurück. Einen schreienden Mann, dem ein Arm und beide Beine fehlten, zerrten sie dabei mit sich in dem Nebel. Er hinterließ eine Spur aus Blut. Kaum war seine Gestalt im Nebel verschwunden, brachen die Todesschreie abrupt ab. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Weg.
Nur noch vier Männer, von beinahe hundert, waren übrig geblieben. Sie drängten sich dicht aneinander, die blutverschmierten Schilder und die Schwerter fest am Körper. Ihr Atem war schwer. Einer von ihnen hatte eine klaffende Wunde dort, wo ihm ein Ghul das Schienbein herausgerissen hatte. Schweigend hielt er sich mit einer Hand an seinem Kameraden fest, während er mit der anderen eine Streitaxt hielt. Die Angst lag wie eine schwere Kette auf ihren Schulter und drückte sie hinab in den Boden. Langsam blickten sich die überlebenden Männer um und blinzelten ungläubig. Ihre Kettenhemden klirrten leise. Dichter Nebel umgab sie und sie standen in einem Meer aus Blut, toten Ghulen und vielen zerfetzten und aufs unkenntliche zerstückelten Fleischhaufen, die einst Menschen oder Pferde gewesen waren. Ihre Angreifer waren verschwunden. Nur noch ihr Gestank nach Verwesung und Tod hing in der Luft.
Keiner der Männer wagte es zu sprechen, selbst Theodor stockte der Atem, während er auf mögliche Geräusche der Ghule lauschte. Lediglich das Schlagen seines Herzen dröhnte in seinen Ohren.
Der Dampf ihres hechelnden Atems stieß aus ihren Mündern in die kalte Nachtluft und ihre Arme, mit denen sie ihre Schwerter fest umklammerten, wie verschreckte Mädchen ihre Puppen, bebten vor Angst. Durch ein großes Loch in der Nebeldecke über ihnen schienen die beiden Monde.
Theodor blinzelte. Er meinte zu erkennen wie sich ihnen etwas durch den Nebel, der mittlerweile so dick wie Milch war, näherte. Eine merkwürdige Kälte umspülte ihn, anders als das gewöhnliche frieren, als ob sich eine tödliche Präsenz nähern würde. Die Luft schien vor Anspannung zu vibrieren. Seine Hand stärkte den Griff um das Schwert.
Wenige Schritte vor ihnen löste sich eine Gestalt aus dem Nebel. Der Mann mit den roten Augen, den Theodor beinahe vergessen hatte. Ein Ruck ging durch die Männer, als sie einen Schritt zurückwichen, bis auf Theodore Absborgen, der die Spitze seines Schwertes auf die Kehle des Angreifers richtete.
Er war ungefähr genauso groß wie Theodor, trug aber nur einen schwarzen Mantel ohne Rüstung oder Waffen. Seine Haut war blass und gräulich. Trotz seiner Schneeweißen Haare wirkte er keinen Tag älter als Theodor, mit seinen 19 Jahren. Was ihn am meisten verstörte waren die Augen. Glühende Kohle, deren Blick ihn durchbohrte. Er spürte, wie eine Gänsehaut sich über seinen Körper spannte, unglaubliche Angst ergriff sein Herz, doch blieb standhaft. Ängste waren dazu da sie zu überwinden, hatte ihm sein Vater immer eingeschärft. Doch noch nie hatte er gesehen oder davon gehört, dass Menschen aus ihren Augen leuchteten, höchsten in irgendwelchen Legenden, die ihm seine Amme als kleines Kind erzählt hatte und an die er sich nur noch vage erinnern konnte.
Die Spitze berührte fast den Kehlkopf des Mannes und doch schien dieser keines Wegs beeindruckt, im Gegenteil, er schien ihn zu belächeln. Theodor versuchte den Fremden einzuschüchtern, doch seine Stimme klang brüchig, fast weinerlich:.
»Im Namen der Majestät des Königs Cornlius Hoorn verhafte ich euch für den Mord an Prinz Levi. Ergebt Euch und kniet nieder, dann werde ich Gnade walten lassen«
Der Mann brach in düsteres Gelächter aus, welches Theodor das Blut in den Adern gefror und ihm einen Blick auf seine unzähligen Spitzen Zähne, die wie Eiszapfen aussahen, gewährte. Ein Impuls drängte ihn dazu alles fallen zu lassen und um sein Leben zu rennen, doch er blieb standhaft und bewegte sich keine Fingerbreite.
»Mensch« seine Stimme war düster, arrogant und jede Silbe war wie ein Stich ins Herz »Glaubt ihr wirklich, dass euer Stahl gegen mich auch nur das geringste ausrichten könnte?« Seine Hand schnellte nach oben und packte die Spitze des Schwertes. Dampf zischte unter seinen knochigen Finger, an denen, anstelle von Fingernägeln schwarze Klauen waren, hervor. Die Klinge begann zu glühen und er verbog die Spitze, als wäre das Schwert ein Grashalm. Theodor ließ das Schwert erschrocken los. Es flog wirbeln durch den Nebel davon.
»Ihr wisst doch nicht mal mit wem ihr es zu tun habt. Oder etwa doch?« Der Fremde trat einen Schritt auf die Männer zu und sie wichen zurück bis auf einen, der sich schützend vor Theodor stellte. Bevor er reagieren konnte packte ihn der Fremde an seinem Kopf und zerdrückte diesen in seiner Faust wie eine große Weintraube. Mit einem lauten Knacken, wie wenn man eine Walnuss öffnete, spritzen Konchensplitter, Hirn und Blut zwischen seinen Finger hindurch. Es zischte laut und schwarze Flammen zügelten aus dem Stupf hervor und während die Leiche leblos zu Boden fiel verwandelte sie sich zu Asche, noch eh sie ihn berührt hatte. Nichts war mehr von dem Mann übrig geblieben, außer dem Blut und Hirn, welches sowohl an seinem Mörder als auch an seinen Mitstreitern klebte.
Einer der Soldaten kreischte panisch wie ein kleines Mädchen und stürmte davon in den Nebel. Der Fremde blickte ihm gleichgültig nach und hob seine flache Hand, an der kein Blut mehr war, als ob es von ihr aufgesaugt worden wäre. Ein Heulen ertönte in der Nacht und hunderte schwarze Augen funkelten im Nebel. Die Schreie verstummten und gieriges Schmatzen und ein verstörendes Kichern ersetzten es.
Nur noch zwei Männer standen hinter Theodor und einer davon hatte lediglich ein Bein. Schützend streckte er seine Arme aus, während die beiden sich hinter ihn, wie zwei Fohlen hinter ihre Mutter, drängten. Theodorr würde nicht zulassen, dass noch mehr Männer an seiner Stelle starben. Er hob aufrührerisch den Kopf. Neuer waghalsiger Mut, wie ihn nur ein Junge, der gerade das Erwachsenenalter erreicht hatte, haben konnte, machte sich in ihm breit.
»Mit einem Monster«, sagte Sir Theodor Absborgen und spuckte das letzte Wort wie Schmutz aus. Wenn er schon sterben würde, dann zumindest wie ein aufrechter Mann und nicht wie ein Feigling auf seinen Knien. Mut und Verantwortung für seine Männer waren Werte, auf die er sein ganzes Leben lang gedrillt worden war und an diesen klammerte er sich nun verzweifelt fest.
»Ihr seid wahrlich mutig. Aber dennoch ein Narr. Für eure Unhöflichkeit muss ich euch eigentlich den Kopf abreißen, wenn ich auch Häuten und Pfählen bevorzugen würde. Denn ihr sprecht mit General Ignacio Fronwald.«
Den Namen kannte Theodor, wie wahrscheinlich jeder in dem südlichen Königreich. Er konnte sich sogar noch an die Geschichten erinnern, die Ammen unartigen Kinder erzählten, um ihnen Angst zu machen. Die Geschichten vom grausamen und jungen Fronwald, der seine Feinde bei lebendigen Leib pfählen und sowohl Frauen als auch Kinder häuten ließ. Als eine Ghuleepidemie Rosenthal vor beinahe hundert Jahre auslöschte, entsandte ihn der König dorthin um die Seuche auszurotten, da nur jemand wie Fronwald damals die Härte, oder eher den Wahnsinn besaß, Ghule und infizierte Zivilisten gleichermaßen niederzumetzeln und abzubrennen.
Er kehrte niemals zurück. Ignacio Fronwald müsste um die 120 Jahre alt sein, sollte er noch leben, vorausgesetzt er wäre noch ein Mensch. Was er offenkundig nicht war. All diese Gedanken schossen durch Theodors Kopf, doch aus seinem trockenen Mund kam nur ein undeutlicher Laut, der bei Ignacio höhnisches Gelächter auslöste.
»Wie ich sehe hat man die Legenden noch nicht vergessen und mit Monster habt Ihr gar nicht so unrecht, auch wenn der Begriff Vaenyr hier der angebrachtere wäre, genauso wie der entsprechende Respekt.«
»Theodors Atem stockte. Hatte dieser Mann sich gerade als Vaenyr bezeichnet? Als einen der ausgestorbenen Totengötter? Doch der Mann ging gar nicht weiter darauf ein, sondern setzte unbekümmert fort »Nun wie dem auch sei. Ihr sterbt sowieso, den mein König duldet keine Überlebenden.«
König? Hatte dieser selbst ernannte Gott der Toten von einem König gesprochen? Hoorn war seitjeher Neutral und hatte Nichtangriffspakte mit allen anderen vier Königreichen Malesturs. Wie war das möglich und welcher König hatte die Macht über Tote, Götter und Ghule? Sein Herz schien für einen Moment auszusetzen und bevor er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, zerriss ein Gebrüll die tödliche Stille.
»Diesen Blödsinn hören wir uns nicht an du Scheusal«
Die beiden Männer hinter ihm stürmten zum Angriff hervor, während Theodor, der gelähmt in die flammenden Augen Ignacios starrt, reglos stehen blieb. Er hatte keine Waffe. Was sollte er tun? Selbst der Einbeinige fiel mit seiner Axt wirbelnd auf Ignacio zu und brüllte: »Für Hoorn, du Bestie.«
Das Folgende geschah so schnell, dass Theodor später oft daran zweifeln sollte, ob es sich wirklich zu getragen hatte.
Die Hand des Vaenyrs zerriss in blutige Fetzen, als eine lange lilaschwarze Klinge aus Obsidian herausschoss. Mit einer schnellen, für das Auge kaum wahrnehmbaren Bewegung, durchtrennte sie den Schaft der Axt, sodass ihr Kopf wirbelnd durch die Luft an Ignacio vorbeiflog. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit, parierte er das Schwert des anderen Soldaten und stieß ihm die Spitze seiner Kristallklinge in die Kehle, sodass dieser glucksend und blutspuckend zu Boden ging. Alles schien gleichzeitig zu passieren, bevor Theodors Körper sich zu irgendeiner Reaktion entscheiden konnte. Ein rot-goldener Feuerball erschien in der Hand Ignacios, den er gegen den Boden schmetterte. Zusammen mit dem Ball zersprang die ganze Welt in Scherben. Blendendes Licht erfüllte ihn und eine gewaltige Druckwelle riss ihn mit sich. Ein flacher Stein ,der über die glatte Oberfläche eines Sees sprang erschien ihm vor seinen inneren Augen, während er immer wieder auf den Boden aufschlug und die Explosion ihn weiter schleuderte, bis er gegen irgendetwas Festes prallte und das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, war das Visier seines Helmes so zerbeult und verschoben, dass er dachte er wäre erblindet, weil er nichts sehen konnte. Erst als sich langsam seine Erinnerung wieder zusammensetzte und er den Stahl auf seinem Gesicht spürte, zerrte er sich keuchend den Helm vom Kopf. Sein Herz raste, als er den Weg im Nebel sah, der sich vor ihm erstreckte und mit Blut vollgesogen im Mondlicht schimmerte. Theodor lag bis zur Hüfte im Morast an eine Birke gelehnt. Sein ganzer Körper schmerzte und war mit einer Kruste aus verbranntem und geronnenem Blut überzogen. Seine Rüstung war so verbeult und stellenweise von Feuer geschwärzt, dass kein Schmied der Welt sie wohl noch reparieren könnte. Wie durch ein Wunder schien keiner seiner Knochen gebrochen zu sein, wenn auch sein ganzer Rücken vor Schmerz pulsierte. Aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge floss Blut über sein Gesicht. Theodor hatte einen eisernen Geschmack auf den Lippen. Zynisch dachte er daran zurück, wie er diese Rüstung, die ihm das Leben gerettet hatte, noch vor wenigen Stunden verflucht hatte, während er zugleich gegen einen Würgreiz ankämpfte.
Es war still, nur der Wind rauschte durchs Gras und die Blätter der Birken und dennoch wagte Theodor es nicht sich zu bewegen. Selbst den Atem hielt er an. Die Präsenz der Ghule hing in der Luft und er glaubte von abertausenden, schwarzen Augen beobachtet zu werden.
Als nach einiger Zeit nichts passierte, zwang er sich aufzustehen. Seine Rüstung ächzte und das Metall klirrte. Er zog das nutzlose Metall aus, bis auf seinen Brustharnisch, an dessen Bindung am Rücken er allein nicht rankam.
Jedes Geräusch welches er verursachte, erschien ihm unglaublich laut und nach jedem versuchte er zu lauschen, ob es die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf ihn gezogen hatte.
Doch es geschah nichts und so fasste er seinen gesamten Mut zusammen und ging in die Richtung, in der er Hoorn vermutete. Es kostete ihn viel Überwindung und er wagte es nicht seinen Blick nach links oder nach rechts zu wenden, vor Furcht dort das gierige schwarze Funkeln von Ghulaugen zu sehen, oder noch schlimmer, die feurige Glut der Augen des Vaenyrs. Bei diesen Gedanken allein bekam er schon feuchte Hände.
Während er den Weg starr fixierte, kam ihn irgendetwas merkwürdig vor, doch erst nach einiger Zeit realisierte er, was es war.
Obwohl die Erde vor Blut getränkt im Mondlicht schwarz glänzte, fehlten jegliche Leichen oder Waffen. Ein Schaudern überkam ihn. Was hatten die Ghule mit den Leichen gemacht? Sie verschleppt und komplett verzerrt, sie zu neuen Ghulen gemacht? Nein, zu einem Ghul wurde gewöhnlich nur jemand der von einen Ghul gebissen wurde und dann überlebte, um einige Tage darauf an Fieber zu sterben und in seinem Grab wiederzuerwachen, doch dies kam selten vor und Theodor bezweifelte, dass jemand, der in Stücke gerissen worden war, noch als Untoter wiederauferstehen konnte.
Sogar einen Krater, den die Explosion, die ihn weggeschleudert hatte, hätte verursachen müssen, konnte er nicht ausmachen.
Der Weg war eben und glatt und frei von Körpern und Gegenständen, wie ein ordentlich sauber genagter Hühnerknochen, den man mit geronnen Blut überzogen hatte.
Er kam sich vor wie in einen irren Fiebertraum und wäre nicht die Schmerzen gewesen, hätte er es für einen gehalten.
Seine Gedanken schweiften hin und her während er wie in Trance durch den Nebel wanderte und seinen Blick nie von dem Boden unter seinen Füßen wandte.
Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Ghule waren ja nichts Besonderes und vor allem in den letzten Monaten war ihre Zahl exponentiell in die Höhe geschossen. Früher rissen sie vielleicht einmal alle paar Monate einen einzelnen Bauer, doch in letzter Zeit streuten sie in Scharen nachts über das Land und vertrieben die Menschen in die Städte.
Solche Ghulepidemien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben.
Aber Vaenyr und Helden vergangener Tage, die aus ihrem Grab auferstanden waren? Vor allem Vaenyr, die nekromantischen Menschengötter, waren wie die anderen Götter in den Großen Kriegen des ersten Zeitalters ausgelöscht worden. Das lag nun zweitausend Jahre zurück. Niemals konnten sie zurückgekehrt sein, auch wenn Vaenyr in der alten Sprache die lebendige Finsternis bedeutet.…
Seine Gedanken kreisten wild und irgendwann war er sich nicht sicher, ob das alles was erlebt hatte wahr sein konnte oder ob er den Wahnsinn verfallen war. Lediglich der pulsierende Schmerz in seiner Stirn, aus der unnachgiebig warmes Blut strömte, nahm ihn immer wieder die Hoffnung zu träumen.
Nach Stunden der Wanderung trat er aus dem Nebel heraus, vor ihm nur noch ein dunkler Weg zur Festung Hoorn, die über allem aufragte. Das Licht von Fackeln und Leuchtfeuern erhellte die Mauer, und tausende Schießscharten blickten auf ihn hinab wie die Augen eines gewaltigen Ungeheuers. Auf einmal spürte er, wie die bleichen Hände des Nebels wieder nach ihn griffen und er erwachte aus seinem tranceartigen Zustand.
Den Rest des Weges rannte er vor Angst um sein Leben. Alles schien nach ihn greifen und ihn töten zu wollen. Die Wurzeln am Boden, die grotesken Gesichter der Bäume, das Licht der Monde. Trotz seiner Erschöpfung und des schweren Brustpanzers lief er so schnell wie noch nie und seine Lungen schienen zu platzen. Er rannte heraus aus den düsteren Mooren, über die Große Brücke, die über den Vyl führte, dem großen Fluss der die Stadt nicht nur mit Wasser versorgte sondern sich auf vor ihr gabelte und so einen gewaltigen Graben mit tosendem Wasser bildete.
Als er das große Stadttor erreichte, hämmerte er wild dagegen. Das Tor war riesig, ein ganzer Belagerungsturm hätte hineingepasst und es war halb so dick wie ein Mann hoch und ließ sich nur mittels eines komplizierten Flaschenzugmechanismus innerhalb der Mauer durch mehrere Männer öffnen und schließen. Die ganze Festung Hoorn war die größte der bekannten Welt und noch nie wurde sie eingenommen.
Aus den Schießscharten über ihm riefen Soldaten, die Tore seien bis zum Sonnenaufgang geschlossen.
Theodor schrie bis seine Lungen fast versagten, dass er ein hoher Ritter sei, der Sohn des Grafen von Absborgen, und er würde wichtige Kunde für den König bringen. Sie konnten alles mit ihm tun, bloß ihn nicht hier draußen bei den Ghulen lassen.
Man öffnete schließlich ein kleines Ausfalltor und ließ ihn herein. Dahinter erwartete ihn ein grimmiger Kommandant, mit einem ebenso schlecht gelaunten Trupp Soldaten, die das Grün der königlichen Armee trugen. Ein Dutzend Speere war auf ihn gerichtet. Nur durch viele vage Erklärungen und dem Wappen der Familie Absborgen auf seiner Brust konnte er die Männer letztendlich davon überzeugen ihn nicht ins Verlies zu werfen.
Ein Mann der über und über mit geronnen Blut überzogen war und der wirr und zitternd redete, war schwer zu vertrauen.
Theodor verlangte, dass man ihm sofort zum König brachte, wenn auch er nichts über den Verbleib des Prinzen oder seine Erlebnis sagte. Man protokollierte sein nächtliches Erscheinen und seine vagen Aussagen, wie es die strengen Dienstvorschriften der Mauer vorsahen.
Am Ende konnte er sich nur noch dunkel daran erinnern wie er in das Gästezimmer in der Riesenfeste, dem Königsschloss im Zentrum der Stadt, gekommen war, nur dass ihn eine Kutsche über die, selbst zu dieser Uhrzeit mit Menschen überfüllten, Straßen fuhr. Die vielen Festungen und Kathedralen, in denen die Menschen zum Schöpfer, welcher die Welt erschaffen hatte, beteten und die hoch zum Himmel ragten und des Tages die Sonne zu verdecken pflegten, waren selbst bei Nacht mit Laternen beleuchtet und schön anzusehen.
Hoorn war das älteste der fünf Königreiche und damit der Ursprung aller Kultur der freien Menschheit. Dank seiner Handelbeziehungen kamen Architekten und Künstler vom ganzen Kontinent hierher. Dafür hatte Theodor aber kein Auge. Mit seinem Kopf war er nur damit beschäftigt, wie er den König erklären konnte, was passiert sei und ob man ihn Glauben schenken würde, selbst dann wenn er sich selbst kaum glaubte. Zur seiner Erleichterung war der König zur der späten Stunde, die dem Morgen näher als dem Abend war, nicht mehr zu sprechen und man versprach ihm eine Audienz in aller Früh. Das hielt ihn nicht davon ab weiterzugrübeln. Seine Gedanken kamen immer wieder zu der Schlacht zurück, immer wieder sah er vor seinen Augen das Blutvergießen und Ignacios Gestalt im Nebel.
Selbst als die Diener kamen, um ihn zu entkleiden und zu waschen, fühlte er sich wieder wie in einem Fiebertraum.
Der Hofapotheker, ein dicker Mann mit einem stoppeligen Doppelkinn, der die ganze Zeit lächelte, wusch Theodors Verletzung am Kopf aus und nähte sie mit einer heißen Nadel zu, doch Theodor war sogar zu erschöpft um vor Schmerzen zu schreien und ließ alles über sich ergehen. Der Hofapotheker gab ihm noch einen Aufguss aus beruhigenden Kräutern, wies ihn an, sich schlafen zu legen und die Wunde nicht zu berühren, dann verabschiedete er sich.
Langsam kam Theodor wieder zu Verstand und während die Wunde unter einer Schicht aus Kräutersalben an seinem Schädel pochte, kreiselten darunter bereits wieder die Gedanken. Theodor lag benommen einige Momente einfach nur da, bis er langsam aufstand und einen Diener rief. Er ließ sich einen Wein bringen, denn das Verlangen seinen Schmerz über den Verlust seiner Kameraden und des Prinzen zu ertränken und die schrecklichen Erinnerungen im Rausch zu vergessen war überwältigend. Doch als er den Becher in der Hand hielt und in den dunkelroten Wein starrte, fühlte er sich an Blut erinnert und an die Feste, die er mit seinen nun toten Freunden früher gefeiert hatte.
Angewidert schüttete er seinen Wein weg.
Theodor war müde und ausgelaugt, daher beschloss er, wie vom Apotheker angeraten, sich zu Bett zu legen. Der Vollmond Fratos schien durch die Vorhänge in sein Zimmer.
Doch fand Sir Theodor Absborgen kaum Schlaf. Wann immer er die Augen schloss, sah er wieder die flammenden Augen des sich selbst ernannten Vaenyr und hörte die Todesschreie der Männer. Sah das schwarze matschige Hirn der Ghulin, welches unter seinem Stiefeln hervorquoll und hörte das Knacken und Knirschen von Knochen. Er erinnerte sich über den rätselhaften Blutrausch der ihn gepackt hatte, aber so musste es sich voll anfühlen wenn man in einem Kampf versinkt. Es war die erste Schlacht, die er in seinem Leben geschlagen hatte und gräulichster als alles, was er zuvor erlebt hatte.
Wie viele Untote hatte er erschlagen? Er wusste es nicht, aber dabei waren sie alle einst Menschen gewesen. Das Gesicht des Jungen, in dem sein Schwert stecken geblieben war, erschien ihm vor seinen inneren Augen. Er fühlte sich dreckig.
All die jungen Soldaten waren gestorben, die meisten kaum älter als er und noch mit dem jugendlichen Übermut, der einen glauben lässt man wäre unbesiegbar, der gleiche Übermut, den auch er noch vor wenigen Stunden gehabt hatte. Bei den Gedanken, wie er trotzig Ignacio bedrohte und sich vor seine Soldaten stellte, zuckte er zusammen. Unruhig und ängstlich wälzt er sich in seinem Bett, grübelte immer wieder über die Geschichten nach, die man ihm als kleines Kind über Ignacio Fronwald, Vaenyre und Ghule erzählt hatte.
Dann drifteten seine Gedanken zu seiner Familie ab. Zu seinem Vater Graf Adolf Absborgen mit seinem grauen Locken und seinen spitzen Bart durch den oft ein fröhliches Lachen drang. Zu seiner Mutter, die strenger als sein Vater war und ihn stets schimpfte, wenn er als Junge immer mit den Kindern der Diener durch die Sümpfe des Vyl streute, während sein Vater nur lachte und meinte, dass er in seinem Alter genauso gewesen war. Dann zu Elsa, seiner kleinen Schwester, die erst vor wenigen Monden ihren zehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Erinnerungen an ihr kindliches und unschuldiges Lachen, als der Hofnarr Hugo ihr eine Rose aus seinen Ärmel zauberte, kamen hoch. Er dachte an die schönen Blumengärten des Schlosses Absborgen. Tränen stiegen ihn seine Augen, während das Bild in sein Kopf eindrang, wie Ghule unter der Führung Ignacios die Burg stürmten und seine Familie schlachteten. Die Burg lag nur wenige Tagesritte von Hoorn entfernt und die Ghule waren nicht weit davon. Am liebsten wäre er jetzt zuhause um auf seine Familie acht zu geben, aber wie sollte er sie vor solch einem Übel beschützen, wenn nicht mal hundert der besten Soldaten der Armee es schafften. Wie konnte er sie beschützen, wenn er selbst gelähmt war vor Furcht?
Rastlos stand er auf, lief unruhig hin und her. Setzte sich an einen Schreibtisch und ließ sich von Diener Papier und Schreibzeug bringen. Er wollte einen Brief aufsetzen um seine Familie zu warnen und brach nach einigen Sätzen ab. Er konnte selber kaum glauben, was er erlebt hatte und es schien ihm unmöglich es in Worte zu fassen. Wütend zerknüllte er das Papier.
Er legte sich hin und schlief immer wieder ein, nur um kurz darauf erneut schreiend aus einem Albtraum zu erwachen, in dem er oder Elsa von Ghulen zerrissen wurden, während Ignacios Gelächter durch seinen Schädel drang. Er hörte Elsa in seinen Träumen schreien und erwachte schweißgebadet, um dann in Tränen auszubrechen. Die ersten paar Male war ein besorgter Diener in der Tür erschienen, doch Theodor schickte ihn jedes Mal weg und spätestens beim vierten Erwecken kam Niemand mehr, um sein Elend mit anzusehen. Theodors ganzer Körper verkrampfte sich und er rollte sich auf dem Bett zusammen wie ein Säugling im Schlaf. Weinkrämpfe und die Bilder der Schlacht quälten ihn bis irgendwann die Erschöpfung ihn übermannte und er in einen traumlosen und tiefen Schlaf sank.
|
|
| Nach oben |
|
 |
|
  |
| Seite 1 von 2 |
Gehe zu Seite 1, 2 |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
In diesem Forum darfst Du keine Ereignisse posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
|
| Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | Buch |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






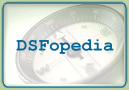





 Login
Login








